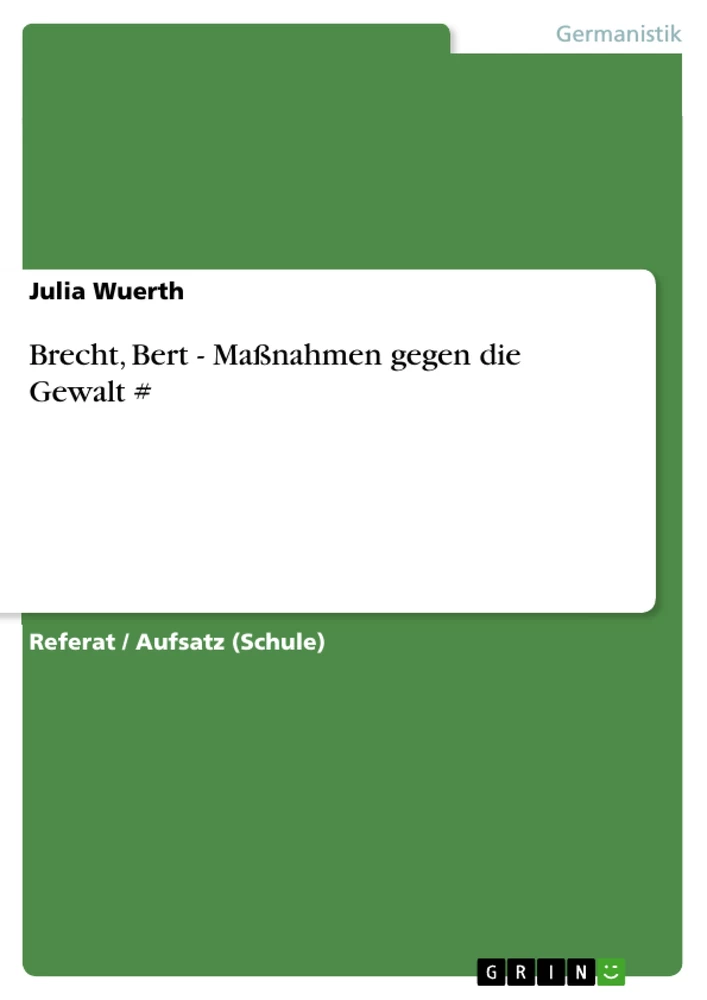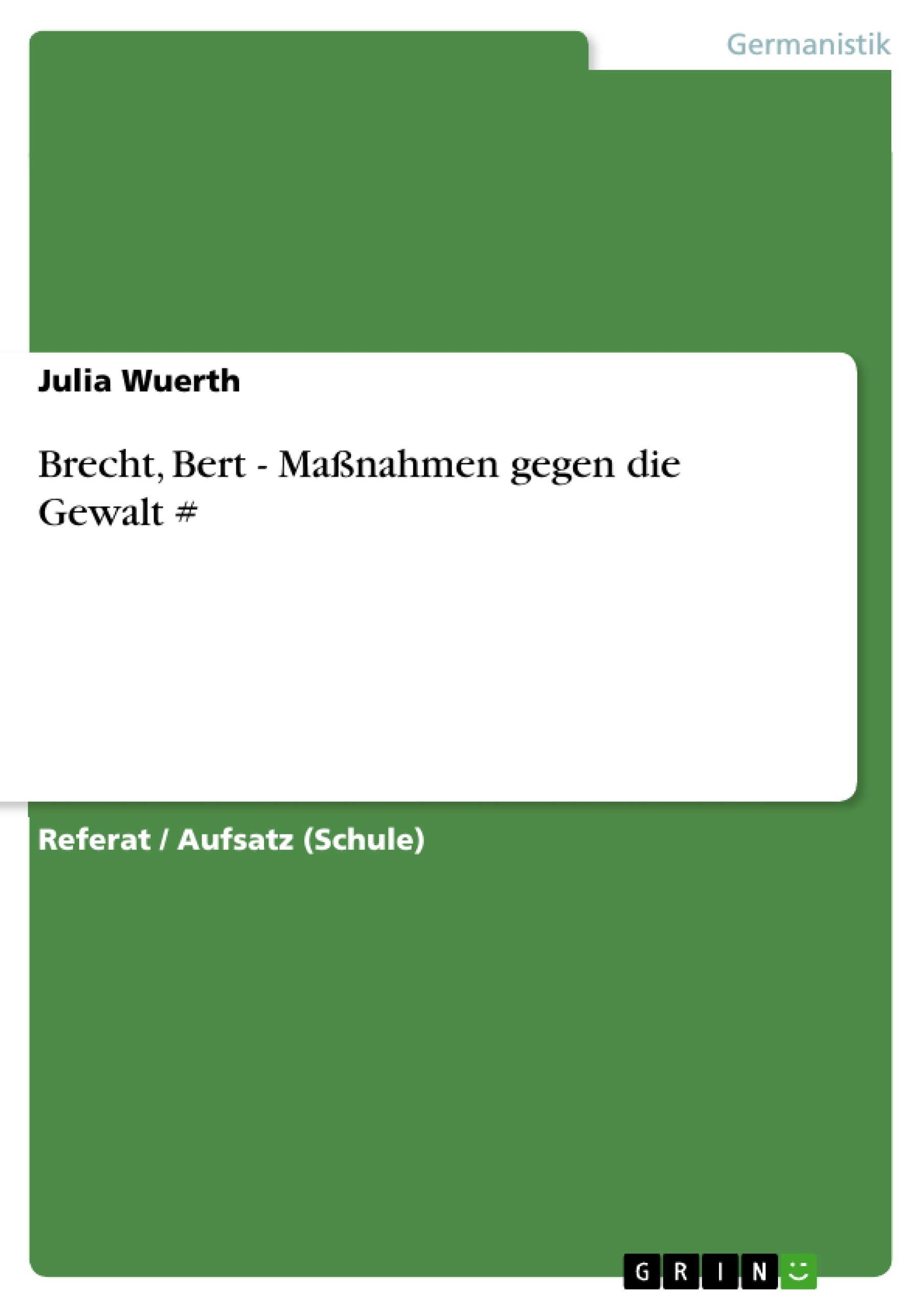Was, wenn Mut nur eine Frage des richtigen Moments ist? In einer Welt, die von Macht und Unterdrückung geprägt ist, ringt Herr Keuner, ein vermeintlicher Verfechter der Gewaltlosigkeit, mit einem erschreckenden Dilemma. Als die Gewalt in Person vor ihm steht, knickt er ein und widerruft seine Überzeugung. Doch warum? Um seinen Schülern seine fragwürdige Entscheidung zu erklären, erzählt er die Geschichte von Herrn Egge, einem Mann, der einst gelernt hatte, Nein zu sagen, aber im Angesicht der Autorität verstummt. Durchdrungen von der Atmosphäre der „Zeit der Illegalität“ – eine subtile Anspielung auf die dunkelste Epoche Deutschlands – entfaltet Bertolt Brecht in „Maßnahmen gegen die Gewalt“ ein beklemmendes Kammerspiel um Feigheit, Opportunismus und den Preis der Anpassung. Ist Keuners Verhalten ein Akt der Selbsterhaltung oder ein Verrat an seinen Idealen? Spiegeln sich in Egges bedingungslosem Gehorsam die Verblendung und das Wegducken der Gesellschaft wider? Brechts meisterhafte Parabel, reich an Ironie und hintergründigem Humor, zwingt uns, über die Mechanismen von Macht, die subtilen Formen der Unterdrückung und die moralische Verantwortung des Einzelnen nachzudenken. Eine zeitlose Analyse menschlichen Verhaltens in Extremsituationen, die den Leser mit unbequemen Fragen zurücklässt: Wie würden wir uns verhalten, wenn die Gewalt vor unserer Tür steht? Welche Kompromisse sind wir bereit einzugehen, um unser eigenes Überleben zu sichern? Ein Muss für alle, die sich mit den Themen Widerstand, Zivilcourage und der dunklen Seite der menschlichen Natur auseinandersetzen wollen. Tauchen Sie ein in Brechts eindringliche Welt und entdecken Sie die erschreckende Wahrheit über die Verführbarkeit des Menschen durch Macht und Angst.
Julia Würth
1. Bertolt Brecht, 1898 - 1956, ist einer der bekanntesten und wohl wichtigsten Autoren der deutschen Geschichte und vor allem des 20. Jahrhunderts. Durch die Unterbrechung seines unsystematischen Studiums der Naturwissenschaften, Medizin und vor allem Literatur aufgrund seines Dienstes als Sanitätssoldat in einem Lazarett während des Krieges wurde er bekennender Kriegsgegner. Durch seine satirischen Romane, Hörspiele, Dialoge und Prosa beeinflusste und erheiterte er auch oft das Leben der Menschen. Er legte besonderen Wert auf Humor und erreichte damit oft mehr bei den Lesern als andere mit „seriösen“ Werken. Das wird unterstrichen durch seinen Ausspruch: „Ein Theater, in dem man nicht lachen soll, ist ein Theater, über das man lachen soll. Humorlose Leute sind lächerlich.„ ( 1: Zitat Brechts, http://www.puk.de/turjalei/bb_schr.htm ) Zu seinen zahlreichen Werken zählen auch die Geschichten von Herrn Keuner, Prosa die über Freundschaftsdienste, Verlässlichkeit, Konsequenz und Eigentumstrieb handeln. Auch die folgende Textinterpretation verfasse ich über ein jener Geschichten. Herr Keuner ist gegen die Gewalt und gibt das auch laut bekannt, doch als die Gewalt ihn zur Rede stellt, hat er plötzlich genau die entgegengesetzte Einstellung. Seine Schüler fragen ihn wieso er das getan hat und er erzählt von Herrn Egge. Meiner Meinung spielt diese Handlung während des Nationalsozialismus in Deutschland und Bertolt Brecht möchte den Menschen mit dieser Kurzgeschichte etwas vermitteln. Dies und weitere Aspekte möchte ich im folgenden in Bezug auf Keuners Verhalten und Parallelen dessen zu dem Herrn Egge in seiner Erzählung erörtern.
2. Für den Einstieg fange ich logischerweise mit der Analyse des Gedichts an, wobei ich zunächst auf den Titel „Maßnahmen gegen die Gewalt“ (2: In Bertolt Brecht: Gesammelte Werk ein 20 Bänden, Bd. 12. S. 375f Z.1, Frankfurt am Main: Surkamp 1967) eingehen möchte. In erster Linie ist der Titel Hinweis für den Leser auf die Handlung. Wobei trotzdem ein Wiederspruch entsteht, denn der Text handelt zwar von der Gewalt, es werden aber keine wirklichen Maßnahmen erwähnt, weder in der Haupt- noch in der Nebenhandlung. Es geht vielmehr um die fehlenden Maßnahmen gegen die Gewalt, die Herr Keuner und Herr Egge zu feige beziehungsweise zu intelligent sind zu vollziehen. Des weiteren wird die Gewalt nicht etwa als Nomen verwendet oder als Tätigkeit, nein, Brecht stellt sie als Person da, um ihre Allgegenwart, Bedrohung und Kraft zu verdeutlichen. Er verwendet so das Stilmittel der Personifikation, wobei wir auch schon beim nächsten Punkt wären. Er verwendet neben der Personifikation auch Metaphern wie bei der Antwort Herr Keuners auf die Frage der Schüler nach seinem Rückrat: „Ich habe kein Rückgrat zum Zerschlagen. (...)“ (3: In Bertolt Brecht: Gesammelte Werk ein 20 Bänden, Bd. 12. S. 375f Z.7, Frankfurt am Main: Surkamp 1967) um die Bilder der Geschichte zu verdeutlichen. Auch der folgende Satz von Herr Keuner : „Gerade ich muß länger leben als die Gewalt“ (4: In Bertolt Brecht: Gesammelte Werk ein 20 Bänden, Bd. 12. S. 375f Z.7f, Frankfurt am Main: Surkamp 1967) ist nur bildlich gesprochen, denn niemand kann die Gewalt überleben, sie war immer unter uns und wird es auch immer sein, es unterstützt wieder die Personifikation der Gewalt, die Menschlichkeit und somit auch Vergänglichkeit. In der Geschichte des Herr Keuner springt dem Leser sofort der komplizierte und verschachtelte Satzbau ins Auge. Die Verschachtelung dient zur näheren Bestimmung der Personen, des Ortes und der Zeit, auch der Umstände des Zusammentreffens des Agenten und Herrn Egge. Jedoch weist diese komplizierte Satzstruktur dennoch parallelen auf, demnach die Stilfigur Parallelismus. Zum Beispiel in dem Satz:
„In die Wohnung des Herrn Egge,
der gelernt hatte, nein zu sagen,
kam eines Tages in der Zeit der Illegalität ein Agent,
der zeigte einen Schein vor,
welcher ausgestellt war im Namen derer,
die die Stadt beherrschten,
und auf dem stand, dass ihm gehören soll, jede Wohnung,
in die er seinen Fuß setzte,
ebenso sollte ihm auch jedes Essen gehören,
das er verlange (...)
(5: In Bertolt Brecht: Gesammelte Werk ein 20 Bänden, Bd. 12. S. 375f Z.9ff, Frankfurt am Main: Surkamp 1967) erkennt man zum einen den komplexen Satzbau, zum anderen aber auch die unverkennbaren Parallelen. Der Satzbau soll die Kompliziertheit der Lage darstellen, in der sich die Personen befinden, wie sie handeln sollen wenn sie der Gewalt beziehungsweise dem bösen Agenten gegenüber stehen. Auf der anderen Seite drückt der Parallelismus die Einfachheit ihrer Reaktionen da, den „taktischen“ Rückzug, den sie sofort, um sich selbst zu retten, ohne an die Konsequenzen für andere zu denken, machen. Um nun auf die Textgattung einzugehen, stelle ich die These auf, dass es sich hierbei um eine Parabel (vgl.6) handelt. Meiner Meinung nach, ist dies offensichtlich, denn es handelt sich um zwei Handlungsstränge die verknüpft nebeneinander auftreten um eine moralische Wahrheit zu verdeutlichen.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Textinterpretation von Julia Würth über Bertolt Brechts "Maßnahmen gegen die Gewalt"?
Die Textinterpretation analysiert Bertolt Brechts Kurzgeschichte "Maßnahmen gegen die Gewalt" hinsichtlich der Thematik der Gewalt, der Reaktion der Charaktere Herr Keuner und Herr Egge auf diese, und der möglichen Parallelen zur Zeit des Nationalsozialismus. Es wird untersucht, wie Brecht durch Stilmittel wie Personifikation, Metaphern und Parallelismus seine Botschaft vermittelt und wie die Form der Parabel dazu beiträgt, eine moralische Wahrheit zu verdeutlichen.
Welche Stilmittel werden in der Geschichte "Maßnahmen gegen die Gewalt" verwendet und wie tragen sie zur Bedeutung bei?
Brecht verwendet Stilmittel wie Personifikation (Gewalt als Person), Metaphern (fehlendes Rückgrat), und Parallelismus (verschachtelter Satzbau mit Parallelen) um die Geschichte zu verdeutlichen und die Komplexität der Situation darzustellen. Die Personifikation der Gewalt verdeutlicht ihre Allgegenwart und Bedrohung. Der Parallelismus spiegelt die Einfachheit der Reaktionen der Charaktere auf die Gewalt wider.
Warum wird die Geschichte als Parabel betrachtet?
Die Geschichte wird als Parabel betrachtet, da sie zwei Handlungsstränge (Herr Keuner und Herr Egge) verknüpft, um eine moralische Lehre zu vermitteln. Durch das Beispielhafte der Erzählung möchte Brecht eine Kritik am Verhalten der Menschen während des Nationalsozialismus äußern.
Welche Rolle spielt der Titel "Maßnahmen gegen die Gewalt"?
Der Titel "Maßnahmen gegen die Gewalt" weist den Leser auf das Thema hin, erzeugt aber gleichzeitig einen Widerspruch, da der Text eher die fehlenden Maßnahmen gegen die Gewalt thematisiert. Die Gewalt wird personifiziert, um ihre Macht und Bedrohung hervorzuheben.
Wie verhalten sich Herr Keuner und Herr Egge gegenüber der Gewalt?
Herr Keuner bekennt sich zunächst öffentlich gegen die Gewalt, revidiert seine Meinung aber, sobald er mit ihr konfrontiert wird. Herr Egge, der gelernt hatte, "nein" zu sagen, gehorcht einem Agenten aufgrund eines gefälschten Dokuments und dient ihm jahrelang, ohne Widerstand zu leisten. Beide Charaktere zeigen eine Art von Feigheit oder opportunistische Anpassung an die Macht.
Welchen historischen Kontext hat die Geschichte "Maßnahmen gegen die Gewalt"?
Die Textinterpretation geht davon aus, dass die Geschichte im Kontext des Nationalsozialismus spielt. Brecht, ein bekennender Kriegs- und Nationalsozialismusgegner, kritisiert durch die Parabel das Verhalten der Menschen in dieser Zeit und die daraus resultierenden Konsequenzen.
Welche Kritik übt Brecht mit der Geschichte an der Gesellschaft aus?
Brecht kritisiert mit der Geschichte das opportunistische Verhalten und die Anpassung an die Macht während des Nationalsozialismus. Er thematisiert die Feigheit und den fehlenden Widerstand gegen die Unterdrückung, indem er das Verhalten der Charaktere Herr Keuner und Herr Egge aufzeigt.
- Quote paper
- Julia Wuerth (Author), 2001, Brecht, Bert - Maßnahmen gegen die Gewalt #, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/103014