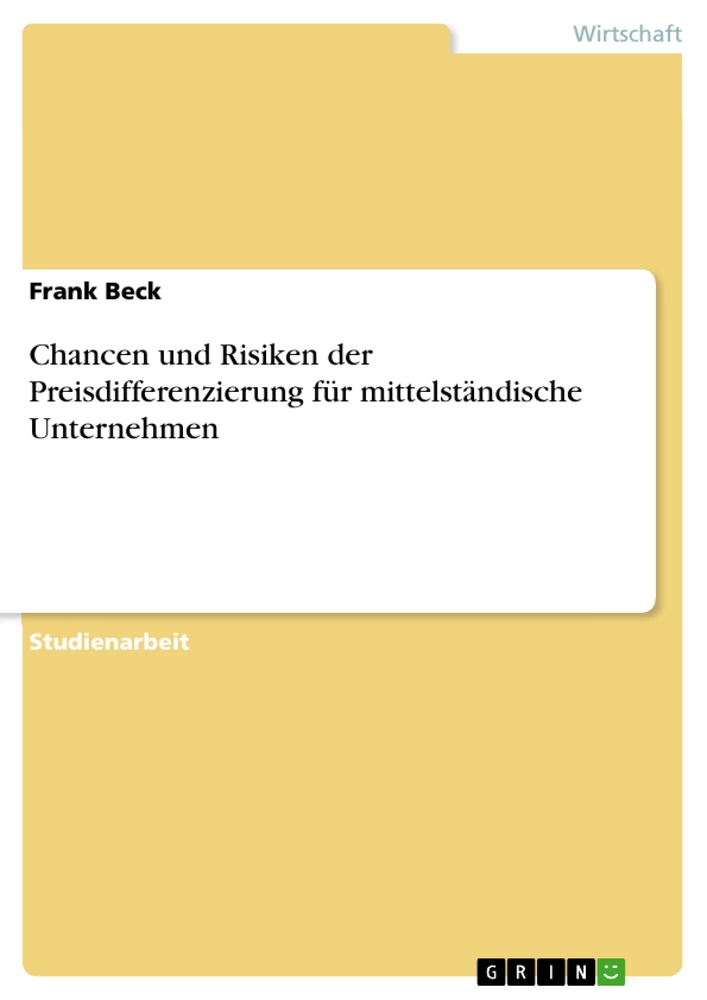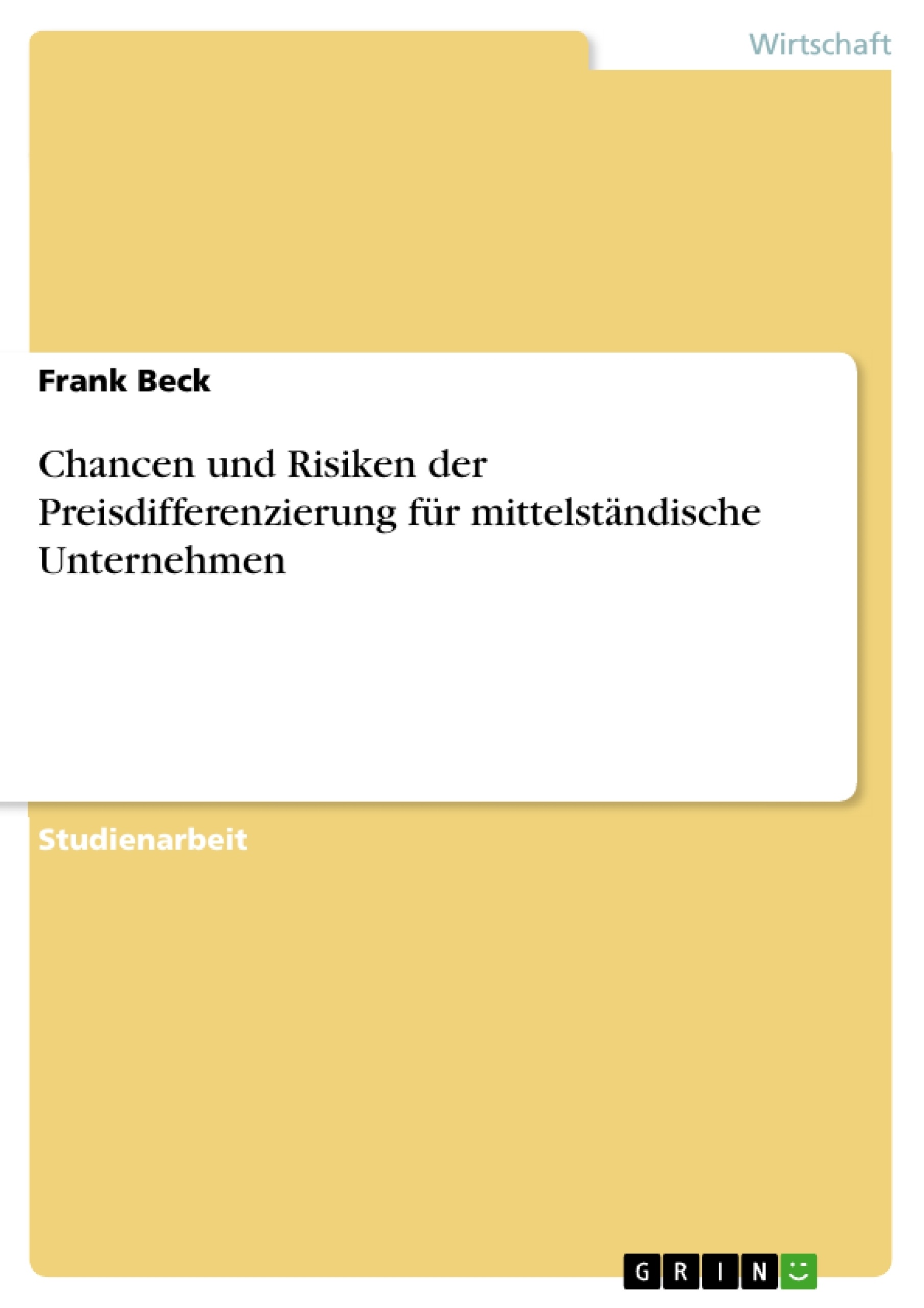In einer Welt, in der Märkte immer enger und Preise immer transparenter werden, stellt sich die entscheidende Frage: Wie können Unternehmen, insbesondere mittelständische Betriebe, im Wettbewerb bestehen und ihre Marktposition ausbauen? Diese tiefgreifende Analyse beleuchtet die strategische Bedeutung der Preisdifferenzierung als ein wirksames Instrument zur Absatzmarkterweiterung und Gewinnsteigerung. Die Untersuchung beginnt mit einer fundierten Auseinandersetzung mit dem Begriff der Preisdifferenzierung in der klassischen Literatur, wobei verschiedene Definitionen und Interpretationen von renommierten Ökonomen wie Heinrich von Stackelberg, Erich Schneider, Martin Fassnacht und Wolfgang Cezanne gegenübergestellt werden. Anschließend werden die quantitativen Merkmale mittelständischer Unternehmen gemäß den Kriterien des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn detailliert dargelegt, um den Kontext für die Anwendung der Preisdifferenzierung zu schaffen. Ein zentraler Aspekt der Analyse ist die Herausarbeitung der wesentlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Preisdifferenzierung, einschließlich der Heterogenität der Nachfragergruppen, der Abgrenzbarkeit der Teilmärkte, der eingeschränkten Markttransparenz und der unterschiedlichen Preiselastizität. Darauf aufbauend werden die vielfältigen Arten der Preisdifferenzierung – von der personenbezogenen über die räumliche und zeitliche bis hin zur leistungs- und mengenbezogenen Differenzierung sowie der Preisbündelung – umfassend erläutert und mit praxisnahen Beispielen illustriert. Die Arbeit untersucht die zentralen Ziele der Preisdifferenzierung, insbesondere die Gewinnmaximierung durch die Abschöpfung der Konsumentenrente, und beleuchtet die damit verbundenen Chancen und Risiken, insbesondere für mittelständische Unternehmen. Es werden sowohl die potenziellen Vorteile der Absatzmarkterweiterung und Gewinnsteigerung als auch die Herausforderungen durch Transaktionskosten, internationale Preisunterschiede und Arbitragehandel kritisch diskutiert. Abschließend wird betont, dass Preisdifferenzierung ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Implementierungsformen darstellt und dass neben einer durchdachten Preispolitik auch Faktoren wie Service, Know-how, Flexibilität und Individualität eine entscheidende Rolle für den Unternehmenserfolg spielen. Diese essentielle Lektüre bietet somit einen umfassenden Überblick über die Preisdifferenzierung und ihre Bedeutung für mittelständische Unternehmen in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Marktumfeld.
1. Einleitung
Es ist festzustellen, daß die Märkte immer enger und die Preise immer transparenter werden. Dazu tragen die vielfältigen Medien, der Euro und die Bevölkerungsdichte in vielen Gebieten bei. Es ist schwer, Produkte über Leistungs- und Imagemerkmale zu verkaufen. Mittelständische Unternehmen müssen sich gegenüber Großunternehmen behaupten. Die Preisdifferenzierung bietet gegenüber dem Einheitspreis die Möglichkeit, den Absatzmarkt zu erweitern.
Ich möchte in dieser Arbeit folgende Fragen beantworten: Wie sieht die klassische Literatur den Begriff Preisdifferenzierung? Wie werden mittelständische Unternehmen quantitativ eingeordnet? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um Preisdifferenzierung durchführen zu können? Welche Arten der Preisdifferenzierung gibt es und wie sind sie zu verstehen? Welche Ziele verfolgt die Preisdifferenzierung?
Welche Chancen und Risiken bieten sich dadurch gerade auch mittelständischen Unternehmen?
2. Definitionen
2.1. Preisdifferenzierung
Heinrich von Stackelberg:
... geht davon aus, dass der monopolistische Markt sachliche, räumliche und zeitliche Differenzierungen aufweisen kann. Diese Differenzierungen ermöglichen es dem Monopolisten, auf den „... Elementarmärkten seines Gesamtmarktes verschiedene Preise zu fordern, die sich nicht nach seinen Produktionskosten, sondern nach der Preiswilligkeit der Nachfrager richten. Man nennt diese Art monopolistischer Preispolitik Preisdifferenzierung.“1
Erich Schneider:
... bezeichnet als Preisdifferenzierung die Erscheinung, dass „... ein Anbieter im Rahmen seines Wirtschaftsplanes in der Pdgleiche Gut verschiedenen Käufern bzw. Käufergruppen zu verschiedenen Preisen anbietet.“2
Martin Fassnacht:
„Preisdifferenzierung liegt vor,
- wenn ein Anbieter ein Produkt, das hinsichtlich der räumlichen, zeitlichen, leistungs- und mengenbezogenen Dimensionen identisch ist, zu unterschiedlichen Preisen verkauft oder
- wenn ein Anbieter Varianten eines Produktes, die sich zumindest in einer der vier Dimensionen unterscheiden, ohne dass dabei andere Produkte entstehen, zu unterschiedlichen Preisen verkauft.“3
Dr. Wolfgang Cezanne:
„Gerade der Monopolist zeichnet sich häufig dadurch aus, dass er Differenzierungen unter der Kundschaft durchsetzen kann. Der Monopolist ist z.B. in der Lage, in räumlich getrennten Märkten unterschiedliche Preise zu verlangen. Oder er ist in der Lage, aufgrund persönlicher Beziehungen höhere Preise zu realisieren. Oder er ist in der Lage, ein Produkt als einen sog. Markenartikel zu präsentieren und bei einer gewissen Kundschaft höhere Preise zu realisieren, obwohl das Produkt im übrigen billigeren Alternativangeboten völlig gleichwertig ist. All dies bedeutet, dass das Vollkommenheitskriterium der Homogenität nicht mehr erfüllt ist. Die Konsequenz ist, dass sich dem Anbieter die Möglichkeit der Preisdifferenzierung eröffnet.“4
Da die oben genannten Definitionen nicht alle miteinander übereinstimmen, möchte ich folgende Graphik zur Veranschaulichung heranziehen:
5 In Fall A wird ein monopolistischer Markt ohne Preisdifferenzierung dargestellt. Der Anbieter hat den Preis P1 festgesetzt und erreicht damit nur die Nachfrage N1. Differenziert der Anbieter nun seine Preise und legt P1, P2 und P3 fest, so veräußert er zusätzlich seine Ware bzw. Dienstleistung auf den Märkten II und III. Die Nachfrager N3 sind bereit, den höheren Preis P3 zu bezahlen. Der Anbieter erzielt einen zusätzlichen Gewinn. Zudem erreicht er mit dem Preis P2 das etwas schwächere Kaufkraftpotential der Nachfrage N2. Läßt sich der Markt in noch mehr klar zu definierende Teilmärkte aufteilen, so kann der Gewinn maximiert werden.
Zusammenfassend spric ht man von Preisdifferenzierung, wenn ein Anbieter ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Leistung an unterschiedliche Kunden zu unterschiedlich hohen Preisen veräußert.6
2.2 mittelständische Unternehmen
Zur Definition des Begriffs „mittelständische Unternehmen“ möchte ich die quantitative Bewertung gemäß den Veröffentlichungen des „Instituts für Mittelstandsforschung Bonn“ heranziehen.
Diese besagen, dass ein Unternehmen mittlerer Größe 10-499 Beschäftigte hat und 1 bis 100 Mio. DM/Jahr Umsatz macht.
Im Jahre 1999 gab es ca. 3,2 Mio. mittelständische Unternehmen mit gut 20 Mio. Beschäftigten.
„Unter diese Definition fallen 99,3% aller umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen Sie tätigten 44,8% aller steuerpflichtigen Umsätze
Sie beschäftigten 69,3% aller Arbeitnehmer und bildeten 80,0% aller Lehrlinge aus
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Mittelstand leistet 57,0% der Bruttowertschöpfung aller Unternehmen und tätigt 46,0% der Investitionen.“7
3. Voraussetzungen der Preisdifferenzierung
1. Die Nachfrager müssen sich in heterogene Gruppen einteilen lassen, deren Nachfrageverhalten unterschiedlich ist.
2. Die einzelnen Teilmärkte müssen so voneinander abgegrenzt sein, dass ein Wechsel der Kunden unmöglich ist.
3. Es darf keine Markttransparenz vorliegen.
4. Es muss eine unterschiedliche Preiselastizität der Nachfrager gegeben sein.8
4. Arten der Preisdifferenzierung
Sobald dedenen Marktsegmenten verschiedene Preise realisieren. Die entsprechenden Segmentierungskriterien, oder auch Arten der Preisdifferenzierung bzw9. Implementationsformen sind wie folgt zu nennen:
1. personenbezogene Preisdifferenzierung
2. räumliche Preisdifferenzierung
3. zeitliche Preisdifferenzierung
4. leistungsbezogene Preisdifferenzierung
5. mengenbezogene Preisdifferenzierung
6. Preisbündelung
Zu 1.
Personenbezogene Preisdifferenzierung liegt vor, wenn ein Anbieter ein Produkt unterschiedlichen Nachfragern oder -gruppen aufgrund personenbezogener Merkmale zu verschiedenen Preisen anbietet. Merkmale können die Höhe des Einkommens, der Ausbildungsstatus, das Geschlecht, die Berufszugehörigkeit, das Alter oder die Zugehörigkeit zu bestimmten Nachfragergruppen sein.
Zu 2.
Räumliche Preisdifferenzierung liegt vor, wenn von einem Anbieter in verschiedenen Gebieten verschiedene Preise verlangt werden. Voraussetzung hierfür ist die Trennbarkeit der Gebiete. Ein Spezialfall ist die internationale Preisdifferenzierung. Die Notwendigkeit ergibt sich aus den unterschiedlichen Preisgefügen der Länder.
Zu 3.
Man spricht von zeitlicher Preisdifferenzierung, wenn für ein Produkt im Verlauf einer bestimmten zeitlichen Periode verschiedene Preise verlangt werden. Sie wird häufig nach Tageszeiten, Wochentagen oder Saison vorgenommen. Zweck ist der Ausgleich zeitlicher Nachfrageschwankungen.
Zu 4.
Weist ein Produkt leistungsmäßige (produktpolitische) Unterschiede auf und wird es zu unterschiedlichen Preisen angeboten, so spricht man von leistungsbezogener Preisdifferenzierung. Hierbei muß darauf geachtet werden, dass die Unterschiede nicht so gravierend sein, dass aus der Sicht des Kunden neue Produkte/Leistungen entstehen.
Zu 5.
Sobald ein Anbieter den Preis bei unterschiedlichen Abnahmemengen eines Produktes staffelt, spricht man von mengenbezogener Preisdifferenzierung. Man kann folgende Formen unterscheiden:
- Mengenrabatt
- Bonus
- Zweiteiliger Tarif
- Preispunkte.
Zu 6.
Preisbündelung liegt vor, wenn mehrere Produkte zu einem Bündel zusammengefasst und zu einem Einheitspreis veräußert werden. „In der Regel ist der Bündelpreis niedriger als die Summe der Einzelpreise der Produkte.“10
5. Ziele
Die Preisdifferenzierung verfolgt das Ziel, den Gewinn gegenüber dem Gewinn bei der Einheitspreissetzung zu steigern.
Die Umsetzung erfolgt durch die bessere Abschöpfung der Konsumentenrente.
Zur Verdeutlichung möchte ich noch einmal obige Graphik heranziehen. Würde der Nachfrager N3 ausschließlich die Möglichkeit haben zum Preis P1 einzukaufen, würde er eine Konsumentenrente erhalten. Er ist ja bereit, zum Preis P3 zu kaufen.
6. Chancen und Risiken
Auch in einem mittelständischen Unternehmen ist es möglich, dass ein Vorhaben nicht stattfinden kann, da der Umsatz (ohne Preisdifferenzierung) nicht ausreicht, die fixen Kosten zu decken. Preisdifferenz ermöglicht die Abschöpfung der Konsumentenrenten und vielleicht auch die Erzielung zusätzlicher Gewinne.
Allerdings verursacht die tatsächliche Durchführung der Preisdifferenz
(Transaktions-) Kosten, allein z.B. durch die unterschiedliche Etikettierung oder Preisangaben in Prospekten.
Der Wunsch, den Absatzmarkt zu erweitern, besteht bei fast jedem Unternehmen. Eine Möglichkeit ist es, nicht nur im Inland Ware oder Dienstleistungen anzubieten, sondern auch im Ausland.
Bei der Preisdifferenzierung, die über Ländergrenzen hinweg stattfindet besteht das Problem, dass das Preisgefüge im Ausland anders ist. So sind z.B. Autos in Italien ca. 20% billiger als in Deutschland. Das Unternehmen muß sich diesen Preisen anpassen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Gerade mittelständischen Unternehmen könnte es Schwierigkeiten bereiten sich ausländischen Gegebenheiten anzupassen, da ja auch höhere Kosten (für z.B. Vertrieb, Versand) anfallen.
Andererseits bieten ausländische Märkte auch Chancen. In England sind z.B. Kunststoffhalbzeuge wesentlich teurer als in Deutschland. Ein Versand der Produkte lohnt jedoch erst bei größeren Abnahmemengen (ca. eine Lkw-Ladung).
Problematisch ist die o.g. Voraussetzung, dass die Teilmärkte absolut voneinander abgegrenzt sind. In der Praxis lässt sich dies nicht in allen Fällen umsetzen. Es besteht die Gefahr, dass Arbitragehandel stattfindet. Unter Arbitrage versteht man die „Ausnutzung von Kurs- oder Preisunterschieden an verschiedenen Börsen bzw. Märkten.“11
Dies bedeutet, dass ein Gut zum niedrigeren Preis auf Teilmarkt II (vgl. hierzu obige graphische Darstellung) eingekauft und auf dem Teilmarkt III zum höheren Preis veräußert wird. Dem Unternehmen gehen dadurch grundsätzlich Gewinne verloren. In diesem Fall gilt es für das Unternehmen zu entscheiden, ob dieser sog. Unterhändler massiv die fremde Kundschaft ansteuert, oder ob das Unternehmen sich die Präferenzen des A-Kunden zunutze macht.
Denn es kommt immer wieder vor, dass man nicht jeden Auftrag erhält, da der persönliche Kontakt fehlt oder gefordertes Know-How nicht vorhanden ist. Soll eine solche Zusammenarbeit funktionieren, gilt es Abkommen bzgl. Kundeschutz, Preisuntergrenzen usw. zu treffen.
Man sieht, dass der Arbitragehandel nicht nur Risiken birgt, sondern im besonderen auch Chancen bietet.
Preisdifferenzierung wird von vielen Unternehmen aller Branchen betrieben. Durch die Einführung des Euro wird diese Differenzierung dem Kunden deutlich gemacht, da der Euro die Preistransparenz erhöht. Daraus entsteht ein Preisdruck, dem entgegengewirkt werden muß. Für mittelständ ische Unternehmen bedeutet dies, sich als ein besonders leistungsfähiger Anbieter/Partner zu präsentieren. Denn es ist nicht immer der Preis entscheidendes Kaufargument, sondern vor allem auch Service, Image und Know-How. In der Umsetzung bzw. Verdeutlichung beim Kunden liegt der Erfolg.
7. Fazit
Es ist festzustellen, daß Preisdifferenzierung sich nicht nur auf eine Implementationsform bezieht, sondern ein Zusammenspiel mehrerer Implementationsformen ist. So wird ein Produkt bei großen Abnahmemengen nicht nur billiger, sondern im Winter ist es zudem auch noch günstiger als im Sommer. Die Ausführungen im Kapitel „Chancen und Risiken“ zeigen auf, daß Preisdifferenzierung einem mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit bietet, seinen Markt zu erweitern und seinen Gewinn zu erhöhen.
Doch ist Preispolitik und im speziellen die Preisdifferenzierung nicht allein
ausreichend, das zentrale Unternehmensziel „Gewinnmaximierung“ zu erreichen. Es spielen Faktoren wie Service, Know-How, Flexibilität, Individualität, ... eine entscheidende Rolle.
8. Literaturverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
1 Von Stackelberg (Grundlagen der theoretischen Volkswirtschaftslehre, 1951), S. 223 f.
2 Schneider (Einführung in die Wirtschaftstheorie, 1949),S. 122
3 Fassnacht (Preisdifferenzierung bei Dienstleistungen, 1996), S. 25
4 Cezanne (Allgemeine Volkswirtschaftslehre 1997), S. 162
5 Karlowitsch (http://www.uni.duesseldorf.de) Bibliotheksdienst 33, 1999, Heft 8, S. 1299-1312
6 Lötters (Grundlagen des Marketing, 1998), S. 139
7 Institut für Mittelstandsforschung Bonn (http://www.ifm-bonn.de)
8 Lötters (Grundlagen des Marketing, 1998), S. 139
9 Fassnacht (Preisdifferenzierung bei Dienstleistungen, 1996), S. 55 ff.
10 Fassnacht (Preisdifferenzierung bei Dienstleistungen, 1996), S. 82
Häufig gestellte Fragen zu Preisdifferenzierung im Mittelstand
Was ist Preisdifferenzierung?
Preisdifferenzierung liegt vor, wenn ein Anbieter ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Leistung an unterschiedliche Kunden zu unterschiedlich hohen Preisen veräußert.
Wie werden mittelständische Unternehmen definiert?
Gemäß dem Institut für Mittelstandsforschung Bonn sind mittelständische Unternehmen solche, die 10-499 Beschäftigte haben und 1 bis 100 Mio. DM/Jahr Umsatz machen.
Welche Voraussetzungen müssen für Preisdifferenzierung erfüllt sein?
Die Voraussetzungen sind:
- Die Nachfrager müssen sich in heterogene Gruppen einteilen lassen, deren Nachfrageverhalten unterschiedlich ist.
- Die einzelnen Teilmärkte müssen so voneinander abgegrenzt sein, dass ein Wechsel der Kunden unmöglich ist.
- Es darf keine Markttransparenz vorliegen.
- Es muss eine unterschiedliche Preiselastizität der Nachfrager gegeben sein.
Welche Arten der Preisdifferenzierung gibt es?
Es gibt folgende Arten der Preisdifferenzierung:
- Personenbezogene Preisdifferenzierung
- Räumliche Preisdifferenzierung
- Zeitliche Preisdifferenzierung
- Leistungsbezogene Preisdifferenzierung
- Mengenbezogene Preisdifferenzierung
- Preisbündelung
Was ist personenbezogene Preisdifferenzierung?
Personenbezogene Preisdifferenzierung liegt vor, wenn ein Anbieter ein Produkt unterschiedlichen Nachfragern oder -gruppen aufgrund personenbezogener Merkmale zu verschiedenen Preisen anbietet (z.B. Einkommen, Alter, Beruf).
Was ist räumliche Preisdifferenzierung?
Räumliche Preisdifferenzierung liegt vor, wenn ein Anbieter in verschiedenen Gebieten verschiedene Preise verlangt.
Was ist zeitliche Preisdifferenzierung?
Zeitliche Preisdifferenzierung liegt vor, wenn für ein Produkt im Verlauf einer bestimmten zeitlichen Periode verschiedene Preise verlangt werden (z.B. nach Tageszeiten oder Saison).
Was ist leistungsbezogene Preisdifferenzierung?
Leistungsbezogene Preisdifferenzierung liegt vor, wenn ein Produkt leistungsmäßige Unterschiede aufweist und zu unterschiedlichen Preisen angeboten wird.
Was ist mengenbezogene Preisdifferenzierung?
Mengenbezogene Preisdifferenzierung liegt vor, wenn ein Anbieter den Preis bei unterschiedlichen Abnahmemengen eines Produktes staffelt (z.B. Mengenrabatt, Bonus).
Was ist Preisbündelung?
Preisbündelung liegt vor, wenn mehrere Produkte zu einem Bündel zusammengefasst und zu einem Einheitspreis veräußert werden. In der Regel ist der Bündelpreis niedriger als die Summe der Einzelpreise der Produkte.
Welche Ziele verfolgt die Preisdifferenzierung?
Die Preisdifferenzierung verfolgt das Ziel, den Gewinn gegenüber dem Gewinn bei der Einheitspreissetzung zu steigern, insbesondere durch die bessere Abschöpfung der Konsumentenrente.
Welche Chancen und Risiken bietet Preisdifferenzierung mittelständischen Unternehmen?
Chancen: Erweiterung des Absatzmarktes, Erzielung zusätzlicher Gewinne durch Abschöpfung der Konsumentenrenten.
Risiken: (Transaktions-) Kosten durch die unterschiedliche Etikettierung oder Preisangaben, Arbitragehandel (Ausnutzung von Preisunterschieden an verschiedenen Märkten).
Was ist Arbitragehandel und wie wirkt er sich aus?
Arbitragehandel ist die Ausnutzung von Preisunterschieden an verschiedenen Märkten. Ein Gut wird zum niedrigeren Preis auf einem Teilmarkt eingekauft und auf einem anderen Teilmarkt zum höheren Preis veräußert. Dies kann zu Gewinnverlusten für das Unternehmen führen, birgt aber auch Chancen durch die Erschließung neuer Kundengruppen.
- Quote paper
- Frank Beck (Author), 2001, Chancen und Risiken der Preisdifferenzierung für mittelständische Unternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/102934