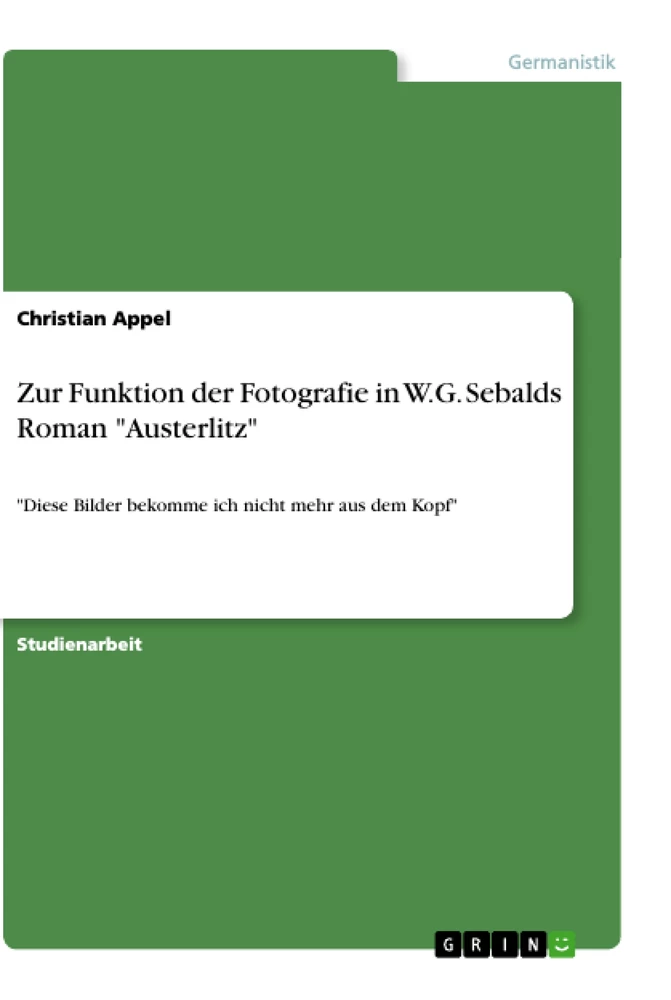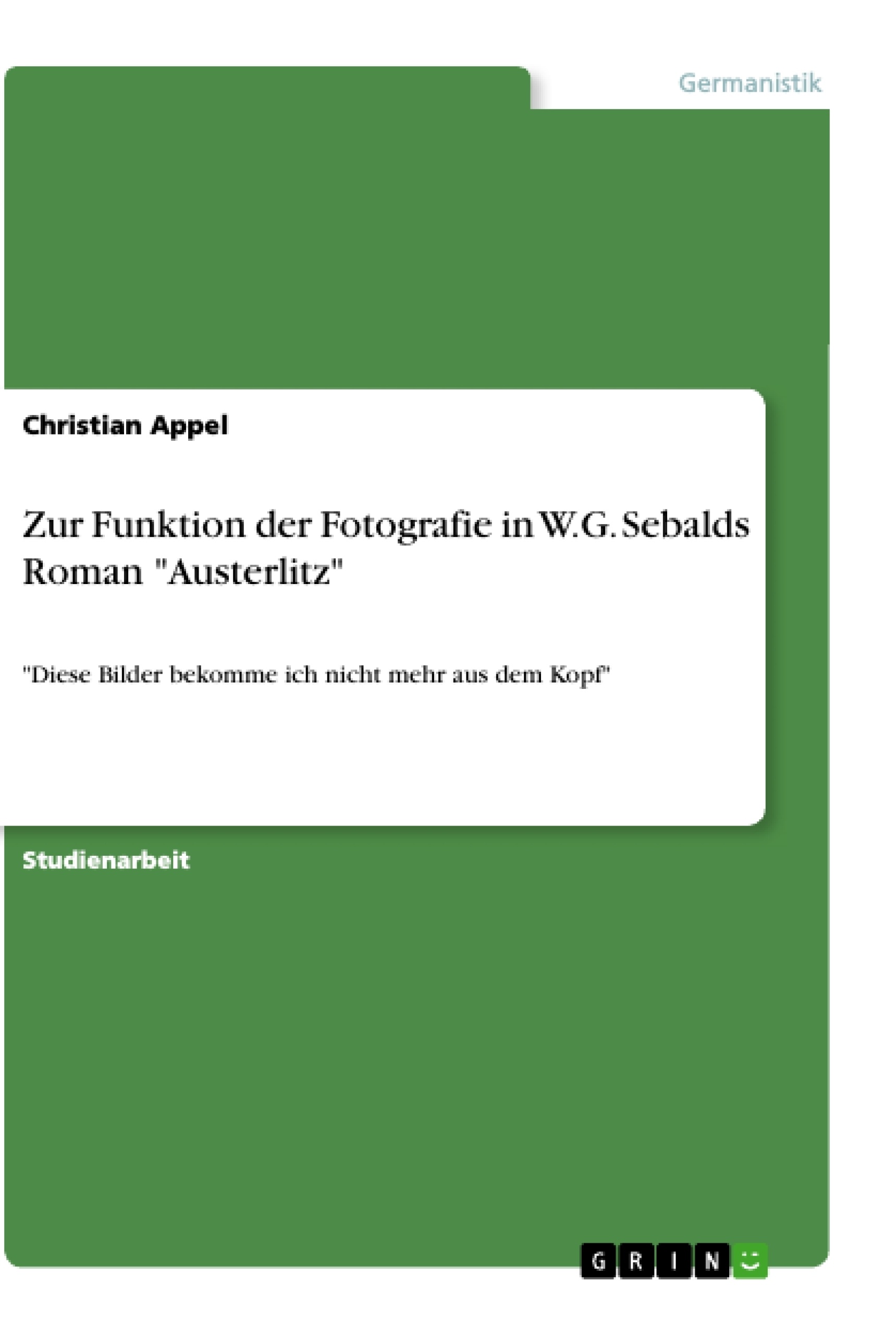W. G. Sebald lässt sich als einer der erfolgreichsten und bedeutendsten deutschen Autoren des 20. Jahrhunderts bezeichnen. Doch wozu verwendet Sebald das Motiv der Fotographie innerhalb seines Romans "Austerlitz"? Fungieren die Fotographien lediglich als Illustration oder spielen sie auf verschiedene, vom Autor intendierte Themen an, die er in seinem Roman verarbeiten wollte? Dieser zentralen Fragestellung soll im Verlauf der Arbeit nachgegangen werden.
Im Gegensatz dazu blieb die deutsche Version von „Austerlitz“ hinter den Erwartungen der Literaturwissenschaft zurück. Gegenüber den bis dato publizierten Werken von Sebald wurde dessen letzter Roman als ein Rückschritt betrachtet, der auf altbekannte sebaldsche Erzählmotive zurückgreift und quasi als "opus magnum" des Schriftstellers betrachtet werden kann. Als Kern des letzten literarischen Werkes des Autors sieht die Literaturwissenschaft die Behandlung zentraler, existenzphilosophischer Themen wie „Vergänglichkeit, Versäumnis oder Zerfall“, die innerhalb des Romans in der Form unterschiedlichster Motive erarbeitet werden. Ein zentrales Motiv und zugleich ein Aspekt, der innerhalb der Forschung am stärksten diskutiert wurde, findet sich in der Nutzung einer Reihe von verschiedensten Fotographien, die Sebald in seinen Roman integriert. Etwa 80 Abbildungen begegnen dem Leser im Verlaufe des Buches, teilweise füllen sie sogar ganze Doppelseiten. Alle Abbildungen sind in Schwarz und Weiß gehalten und zeichnen sich bei genauerer Betrachtung durch einen gewissen Grad an Unschärfe aus.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Motiv der Fotographie in W.G. Sebalds „Austerlitz“
- Die Fotographie als Werkzeug der Narration
- Die Fotographie bei „Austerlitz“ als Beleg der authentischen Narration
- Die Fotographie bei „Austerlitz“ im Rahmen des „dokumentarischen Lyrismus“
- Die Fotographie als Medium der Erinnerung
- „So ist es gewesen“ – Fotographie als Abbild der Wahrheit?
- „Erinnerungslücken schließen“ – Fotographie als Initiator von Erinnerungsprozessen?
- Fotographie gegen die Entbildlichung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Funktion der Fotographie in W.G. Sebalds Roman „Austerlitz“. Der Fokus liegt auf der Analyse der Rolle der Fotographie als Werkzeug der Narration, als Medium der Erinnerung und als Mittel zur Bekämpfung der Entbildlichung.
- Die Rolle der Fotographie in der Konstruktion der Narration
- Das Potential der Fotographie für die menschliche Erinnerung
- Der Einsatz der Fotographie zur Bekämpfung der Entbildlichung von Opfern des Nationalsozialismus
- Die Beziehung zwischen Text und Bild in „Austerlitz“
- Der „dokumentarische Lyrismus“ in Sebalds Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Bedeutung der Fotographie für die Konstruktion der Narration in „Austerlitz“ untersucht. Dabei wird die Beziehung zwischen dem Erzähltext und den Fotographien analysiert und der Roman in die Tradition des „dokumentarischen Lyrismus“ eingeordnet. Im zweiten Kapitel wird die Frage nach dem Potential der Fotographie für die menschliche Erinnerung behandelt. Anhand der Romanhandlung wird der Wahrheitsgehalt von fotographischen Abbildungen im Werk Sebalds beleuchtet.
Schlüsselwörter
Fotographie, Narration, Erinnerung, Entbildlichung, „dokumentarischer Lyrismus“, „Austerlitz“, W.G. Sebald, Romananalyse,
- Quote paper
- Christian Appel (Author), 2013, Zur Funktion der Fotografie in W.G. Sebalds Roman "Austerlitz", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1027099