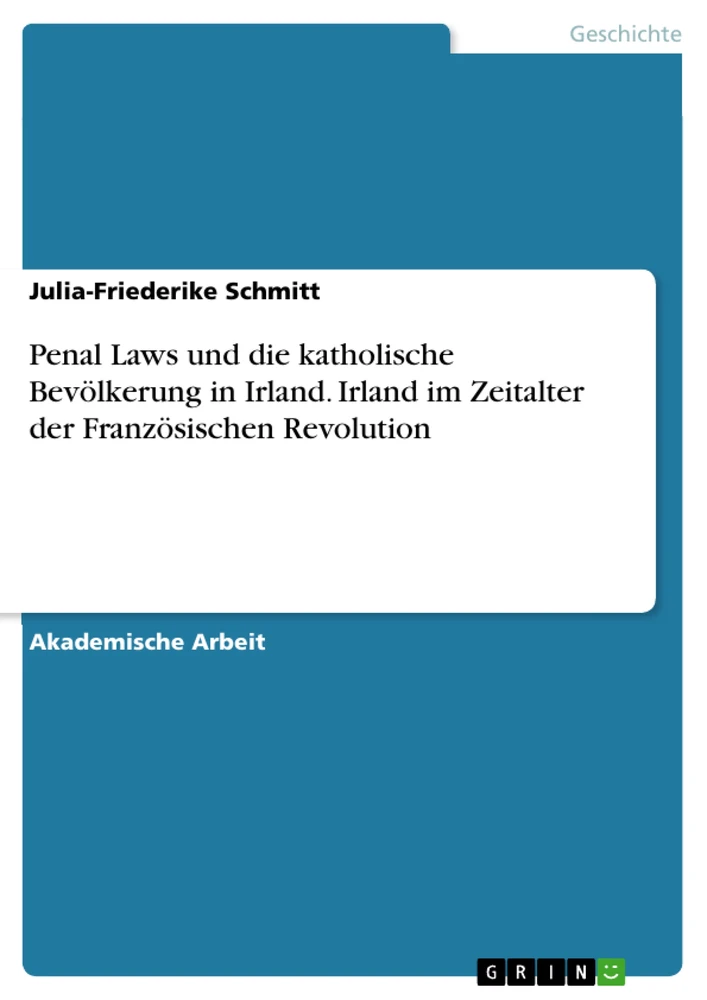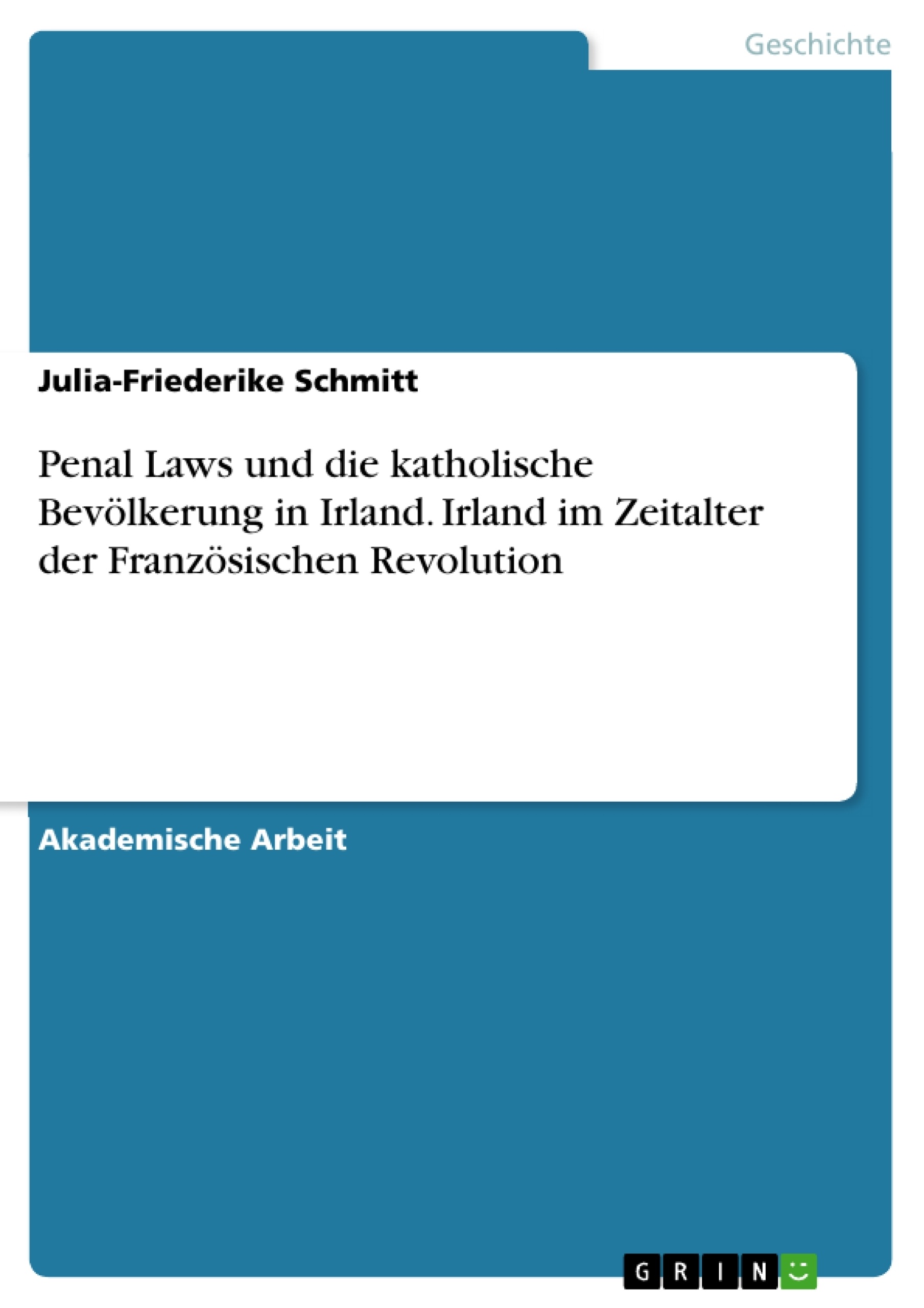Diese Arbeit zeigt anhand einiger ausgewählter 'Penal Laws' auf, wie sich diese de facto auf das Alltagsleben der nicht-klerikalen katholischen Iren ausgewirkt haben. Begonnen wird dabei mit dem 'Treaty of Limerick' von 1691, der den besiegten Iren zunächst gute Konditionen anbot, sich jedoch durch eine Reihe von anschließend erlassenen Penal Laws als unnütz herausstellte. Danach folgt eine allgemeine Einführung zum Thema Penal Laws, deren Auswirkungen anhand ausgewählter, existentieller Lebensbereiche wie etwa dem Besitz von Land oder der Berufswahl erläutert werden sollen.
England war schon seit dem ersten Jahrhundert vor Christus bestrebt, Irland für sich einzunehmen. Jedoch wurde dieses Vorhaben erst im 15. Jahrhundert mit der Tudor-Dynastie erfolgreich vorangetrieben, unter anderem auch, da man Irland als Basis potenzieller feindlicher Angriffe gegen England erkannt hatte. Die Tudors setzten 1494 Sir Edward Poyning als Vize-König in Irland ein, der sein Vorhaben, die englische Vorherrschaft in Irland aufzubauen, noch im selben Jahr im sogenannten 'Poynings Law' zum Ausdruck brachte.
Dieses Gesetz sah vor, dass alle Entscheidungen des irischen Parlaments nur dann Gültigkeit besaßen, wenn auch der englische König ihnen zustimmte. Den nächsten Schritt tat dann Heinrich VIII. 1541, als er sich vom Parlament in Irland zum König von Irland ausrufen ließ und nach ihm Elisabeth I., die sich die Durchsetzung der Reformation in Irland zur Aufgabe gemacht hatte, aber trotz drastischen Maßnahmen keine nennenswerten Erfolge erzielten konnte. So war es vor allem der religiöse Aspekt, der die katholischen Iren zusammenhielt und die Kirche zum Führer des Widerstandes aufstiegen ließ.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der treaty of Limerick (1691)
- 3. Penal laws
- 3.1 Allgemeines zu den penal laws
- 3.2 Ihre Auswirkungen in ausgewählten Bereichen des Lebens der Katholiken
- 3.2.1 Land, Erbe und Ehe
- 3.2.2 Handel
- 5. Resumè
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der Penal Laws auf das Alltagsleben der katholischen Bevölkerung Irlands. Sie fokussiert sich auf die de facto Konsequenzen dieser Gesetze, ausgehend vom Treaty of Limerick und analysiert deren Einfluss auf verschiedene Lebensbereiche der betroffenen Bevölkerungsgruppe.
- Der Treaty of Limerick und sein Bruch
- Die allgemeinen Ziele und die Umsetzung der Penal Laws
- Auswirkungen der Penal Laws auf Landbesitz und Erbrecht
- Auswirkungen der Penal Laws auf Handel und wirtschaftliche Aktivitäten
- Der Einfluss der Penal Laws auf die soziale und religiöse Identität der Iren.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext der englischen Eroberung Irlands und die Rolle der katholischen Kirche als Zentrum des Widerstands gegen die englische Herrschaft. Sie führt in das Thema der Penal Laws ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, die konkreten Auswirkungen dieser Gesetze auf das Alltagsleben der katholischen Bevölkerung zu analysieren. Der Fokus liegt dabei auf der Diskrepanz zwischen den theoretischen Bestimmungen und den tatsächlichen Folgen der Gesetze. Die Arbeit kündigt den methodischen Ansatz an, der auf bereits vorhandener Literatur basiert, aufgrund von Schwierigkeiten beim Zugang zu originalen Quellenmaterialien.
2. Der treaty of Limerick (1691): Dieses Kapitel analysiert den Treaty of Limerick von 1691, der den Williamite War beendete und den katholischen Iren zunächst gute Konditionen anbot. Der Fokus liegt auf den widersprüchlichen Bestimmungen des Vertrages, insbesondere der scheinbar garantierten Religionsfreiheit, die jedoch durch den Zusatz "as are consistent with the laws of Ireland" bereits die Möglichkeit der späteren Aushebelung durch neue Gesetze in sich trug. Die Analyse vertieft sich in die militärischen und zivilen Artikel des Vertrages und untersucht deren Bedeutung und spätere Nichtigkeit im Lichte der nachfolgenden Penal Laws. Der Vertrag wird als Ausgangspunkt der späteren Entwicklungen dargestellt, die zum Bruch des Vertrages und zur Etablierung der protestantischen Vorherrschaft führten.
3. Penal laws: Dieses Kapitel beginnt mit einer allgemeinen Einführung in die Penal Laws, welche als Antwort auf den Treaty of Limerick und aus den Ängsten der protestantischen Minderheit vor der zahlenmäßig überlegenen katholischen Bevölkerung entstanden. Es wird dargelegt, dass die Gesetze, vordergründig konfessionell motiviert, tatsächlich darauf zielten, die Macht der katholischen Iren zu brechen. Die Analyse beleuchtet die unterschiedlichen Aspekte der Penal Laws und deren schrittweise Einführung. Die Bezeichnung Limericks als "city of the broken treaty" wird im Kontext der Nichtigkeit der im Vertrag zugesicherten Konditionen durch die neuen Gesetze erläutert. Der Abschnitt unterstreicht die Etablierung der protestantischen Vorherrschaft und die Bedeutung der Penal Laws als Instrument zur Aufrechterhaltung dieser Dominanz.
3.1 Allgemeines zu den penal laws: Der Abschnitt beschreibt die allgemeine Unzufriedenheit der protestantischen Bevölkerung mit den Zugeständnissen des Treaty of Limerick und deren Forderungen zur Sicherung ihrer Interessen. Die protestantischen Ängste vor der katholischen Mehrheit und die Stärkung ihres Selbstbewusstseins durch den Sieg Williams III. werden als entscheidende Faktoren für die Formulierung der Penal Laws dargestellt. Der Abschnitt betont den Prozess der Interessensbildung und der Festlegung der Strategien im Umgang mit der katholischen Bevölkerung.
Schlüsselwörter
Penal Laws, Irland, Treaty of Limerick, Katholische Bevölkerung, Protestantische Vorherrschaft, Religionsfreiheit, Landbesitz, Handel, Alltagsleben, historischer Kontext, de facto Auswirkungen, Konfession, politische Macht.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Auswirkungen der Penal Laws auf das Alltagsleben der katholischen Bevölkerung Irlands
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Auswirkungen der Penal Laws auf das Alltagsleben der katholischen Bevölkerung Irlands. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse der tatsächlichen Konsequenzen der Penal Laws, ausgehend vom Treaty of Limerick (1691).
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende zentrale Themen: den Treaty of Limerick und seinen Bruch, die Ziele und Umsetzung der Penal Laws, deren Auswirkungen auf Landbesitz und Erbrecht, deren Einfluss auf Handel und wirtschaftliche Aktivitäten, sowie den Einfluss der Penal Laws auf die soziale und religiöse Identität der Iren. Die Analyse konzentriert sich auf die Diskrepanz zwischen den theoretischen Bestimmungen der Gesetze und ihren tatsächlichen Folgen im Alltag der katholischen Bevölkerung.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, die den historischen Kontext und die Zielsetzung der Arbeit beschreibt. Es folgt ein Kapitel über den Treaty of Limerick (1691) und dessen Bedeutung im Hinblick auf die späteren Entwicklungen. Das Hauptkapitel behandelt die Penal Laws, ihre allgemeinen Ziele und ihre Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche der katholischen Bevölkerung (Land, Erbe, Ehe, Handel). Das Dokument schließt mit einem Resumè ab.
Welche Quellen wurden verwendet?
Das Dokument basiert auf bereits vorhandener Literatur. Aufgrund von Schwierigkeiten beim Zugang zu originalen Quellenmaterialien wurde auf Sekundärliteratur zurückgegriffen.
Was ist die Kernaussage des Dokuments?
Die Kernaussage des Dokuments ist, dass die Penal Laws weitreichende und negative Auswirkungen auf das Alltagsleben der katholischen Bevölkerung Irlands hatten. Sie führten nicht nur zu wirtschaftlicher Benachteiligung, sondern auch zu einem Verlust an sozialer und religiöser Identität. Der Bruch des Treaty of Limerick markierte den Beginn dieses Prozesses, und die Penal Laws wurden als Instrument zur Etablierung und Aufrechterhaltung der protestantischen Vorherrschaft eingesetzt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Penal Laws, Irland, Treaty of Limerick, Katholische Bevölkerung, Protestantische Vorherrschaft, Religionsfreiheit, Landbesitz, Handel, Alltagsleben, historischer Kontext, de facto Auswirkungen, Konfession, politische Macht.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in jedem einzelnen?
Das Dokument umfasst folgende Kapitel:
- 1. Einleitung: Historischer Kontext, Zielsetzung der Arbeit, methodischer Ansatz.
- 2. Der Treaty of Limerick (1691): Analyse des Vertrags, widersprüchliche Bestimmungen, spätere Nichtigkeit.
- 3. Penal laws: Allgemeine Einführung, Ziele der Gesetze, schrittweise Einführung, Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche.
- 3.1 Allgemeines zu den penal laws: Unzufriedenheit der protestantischen Bevölkerung, Ängste vor der katholischen Mehrheit, Interessensbildung.
- 5. Resumè: Zusammenfassung der Ergebnisse.
- Quote paper
- Julia-Friederike Schmitt (Author), 2013, Penal Laws und die katholische Bevölkerung in Irland. Irland im Zeitalter der Französischen Revolution, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1026869