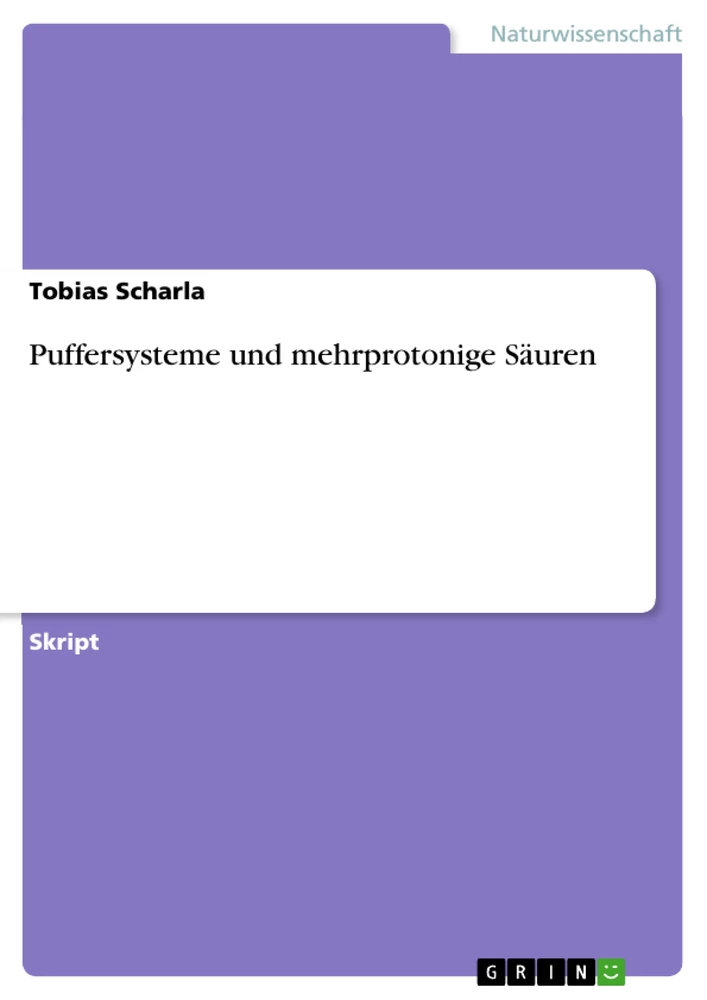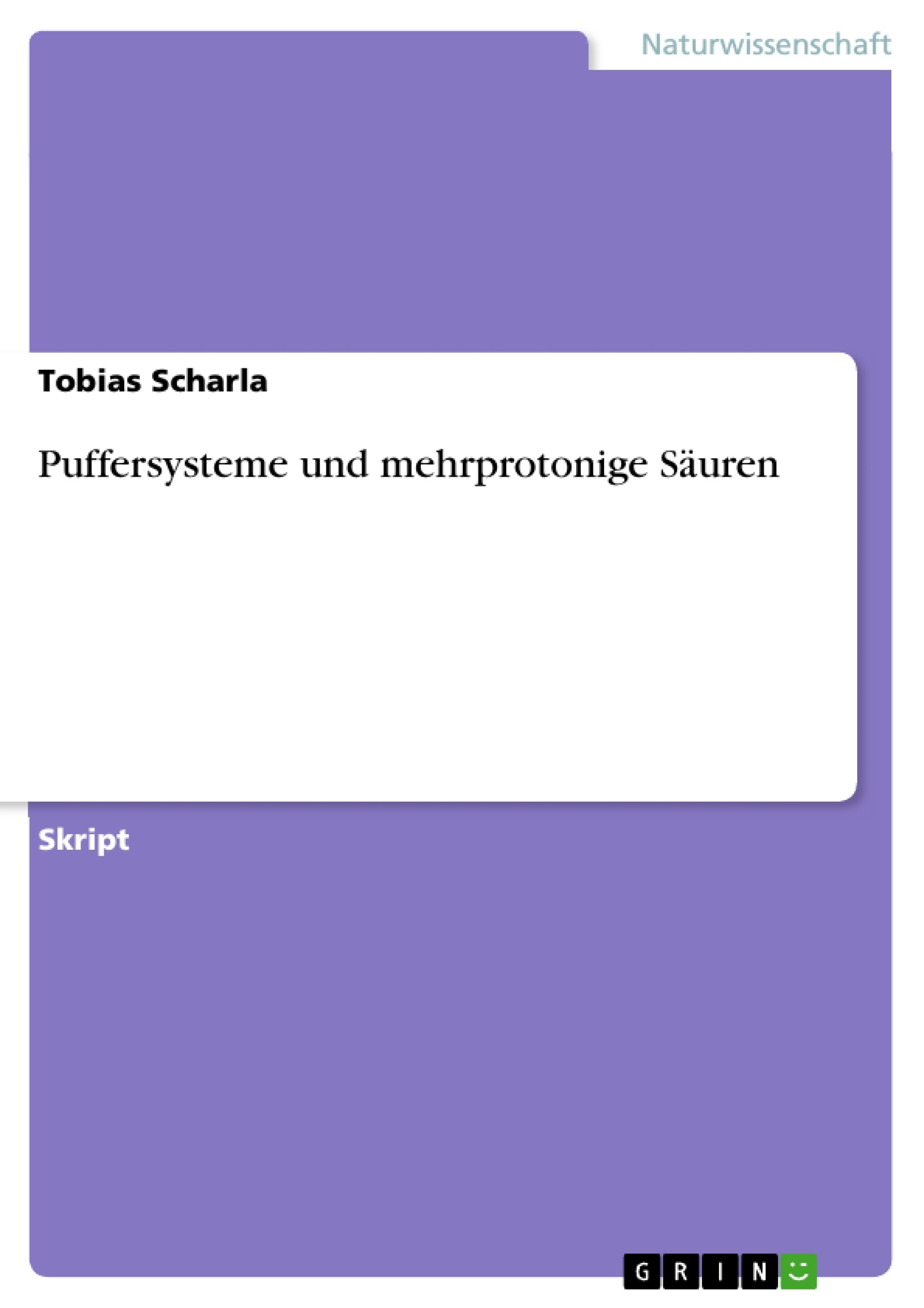Enthüllen Sie die Geheimnisse der unsichtbaren Kräfte, die das Leben selbst im Gleichgewicht halten! Dieses Buch ist eine fesselnde Reise in die faszinierende Welt der Puffersysteme und mehrprotonigen Säuren, ein unverzichtbares Wissen für jeden, der die Feinheiten chemischer Reaktionen und ihre Bedeutung in biologischen Systemen verstehen möchte. Von der detaillierten Untersuchung der Funktionsweise von Acetatpuffern bis zur präzisen maßanalytischen Bestimmung von Phosphorsäure (H3PO4) und der Ableitung ihrer Säurekonstanten (pK1 und pK2) bietet dieses Werk einen umfassenden Einblick in die Prinzipien und Anwendungen der Säure-Base-Chemie. Anhand klarer Erklärungen, anschaulicher Diagramme und praxisorientierter Experimente, einschließlich detaillierter Beschreibungen von Titrationen mit Natronlauge (NaOH) und der Analyse von Titrationskurven, werden komplexe Konzepte wie Äquivalenzpunkte und Halbneutralisationspunkte zugänglich gemacht. Entdecken Sie, wie Pufferlösungen den pH-Wert stabilisieren und somit lebenswichtige Prozesse in unserem Körper und in der Umwelt ermöglichen. Tauchen Sie ein in die Welt der Protonenübertragungen und lernen Sie, wie man Säurekonstanten berechnet und interpretiert, um die Reaktivität und das Verhalten chemischer Spezies vorherzusagen. Egal, ob Sie Student, Forscher oder einfach nur neugierig auf die Chemie des Lebens sind, dieses Buch bietet Ihnen das Rüstzeug, um die verborgenen Mechanismen hinter den Reaktionen zu entschlüsseln, die unsere Welt formen. Lassen Sie sich von der Präzision der Messungen und der Eleganz der Berechnungen begeistern, während Sie die fundamentalen Prinzipien der analytischen Chemie und ihre Bedeutung für die moderne Wissenschaft und Technologie erkunden. Dieses Buch ist Ihr Schlüssel zum Verständnis der chemischen Grundlagen des Lebens und eröffnet Ihnen eine neue Perspektive auf die Welt um Sie herum, von den einfachsten Laborversuchen bis hin zu den komplexesten biologischen Prozessen. Erforschen Sie die Welt der Säure-Base-Chemie und entdecken Sie das verborgene Gleichgewicht, das alles zusammenhält.
Puffersysteme und mehrprotonige Säuren
(Proben Nr. 26)
Teil A: Funktionsweise von Puffersystemen
Puffer sind Kombinationen aus einer Säure oder Base und einem Salz der gleichen Säure oder Base, das konjugierte Säure-Base-Paar. Der Puffer bewirkt nach Zugabe von einer Säure oder Base, dass sich der pH-Wert des Puffersystems fast nicht ändert, pH ±0,2.
Arbeitsgeräte und Chemikalien
- Bürette, 50ml
- Becherglas, 150ml
- pH-Meter
- äquimolarer Acetatpuffer, 1M CH3COOH – 1M CH3COONa
- 1M HCl
- 1M NaOH
1. Durchführung
Hier benötigt man ein Becherglas, in dem sich ca. 20ml äquimolarer Acetatpuffer befindet. Nun gibt man die Salzsäure, 1M HCl, bzw. die Natronlauge, 1M NaOH, in den bestimmten Mengen hinzu. Bei den einzelnen Mengen an Säure bzw. Base wird der pH-Wert gemessen, mit einem pH-Meter.
2. Gemessene pH-Werte
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abweichungen der Werte von den theoretischen Werten können sich so erklären, dass eine 0,1M NaOH bereitgestellt wurde, anstatt eine 1M NaOH.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Mögliche Fehlerquellen:
Der Acetatpuffer hat theoretisch den pH-Wert pH=4,74, da bei äquimolaren Puffern gilt: pH = pKs. Hier kann es zu Abweichungen kommen, da die pH-Meter-Elektrode in der letzten signifikanten Stelle „wackelt“, d.h. ungenau ist um ca. 3 Einheiten.
Teil B: Maßanalytische Bestimmung von H3PO4 und Bestimmung der beiden Säurekonstanten pK1 und pK2.
Arbeitsgeräte und Chemikalien
- Bürette, 50ml
- Becherglas, 400ml
- Magnetrührer
- pH-Meter
- Analyselösung
- 0,1M NaOH
Fehlerbetrachtung: Auch hier wackelt die letzte Stelle nach dem Komma um ca. 3 Einheiten, da auch hier wieder die pH-Elektrode benutzt wurde.
1. Durchführung
Zuerst wird der Messkolben, der die Analyenlösung beinhaltet, auf 250ml mit dest. Wasser aufgefüllt. Danach wird ein aliquoter Teil, 25ml, mit einer Vollpipette in das Becherglas überführt. Im Becherglas füllt man diese 25ml mit dest. Wasser auf ca. 100ml auf und titriert diese Lösung mit NaOH. Dies wird dann noch einmal wiederholt, denn die erste Titration dient nur zur ungefähren Bestimmung der Äquivalenzpunkte und die zweite Titration ist dann zur genauen Bestimmung der Äqui- valenzpunkte. Hieraus kann man dann die Äquivalenzpunkte, den genauen Gehalt an H3PO4 und die Konzentration von H3PO4 in der Probenlösung berechnen.
2. Gemessene pH-Werte während der schnellen Titration
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3. Gemessene pH-Werte während der langsamen Titration
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4. Titrationskurve mit 1. und 2. Ableitung
Überall, wo die 1. Ableitung ihr Maximum, die 2. Ableitung ihre Nullstellen, hat ist ein Äquivalenzpunkt.
Titration von H3PO4 mit NaOH als Maßlösung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aus der Titrationskurve folgt durch Ablesen an den Strichen durch die Maxima der
1. Ableitung die Äquivalenzpunkte (ÄP). Hier sind sie bei:
ÄP1 = 20,5ml NaOH
ÄP2 = 41,0ml NaOH
5. Berechnungen
Aus den Äquivalenzpunkten kann man jetzt die gesuchten Größen ermitteln.
1. Reaktionsgleichung für die Äquivalenzpunkte
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
6. pKs Werte aus der Titrationskurve und der 1. Ableitung
Es gilt; an den Halbneutralisationspunkten pH = pKs. Die Halbneutralisationspunkte liegen rechnerisch genau zwischen den Äquivalenzpunkten, bzw. beim ersten Halbneutralisationspunkt zwischen 0 und dem 1. Äquivalenzpunkt. Rechnerisch wären diese Punkte bei:
pK1: 2,38
pK2: 6,97,
da gilt pH = pKs. Natürlich sind hier die Messungenauigkeiten mit einbezogen, somit kann man davon ausgehen, dass man einen geringen Fehler in die Rechnungen mit einbezieht. Jetzt kommen die zeichnerischen Werte. Diese Werte haben einen größeren Fehler, als die errechneten, denn hier gibt es noch die Ablesegenauigkeit. Nun werden die pK-Werte abgelesen. Dazu fällt man das Lot bei den stöchiometrischen Äquivalenzpunkten und wenn man dann genau in der Mitte dieser beiden Lote bzw. zwischen der y-Achse und dem Lot des 1. ÄP wiederum ein Lot fällt, so ist der Schnittpunkt dieses Lotes und der Titrationskurve der pK-Wert.
Meine zeichnerischen Ergebnisse: pK1: 2,4
pK2: 6,9
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Leseprobe mit dem Titel "Puffersysteme und mehrprotonige Säuren"?
Diese Leseprobe behandelt zwei Hauptthemen: erstens, die Funktionsweise von Puffersystemen, und zweitens, die maßanalytische Bestimmung von Phosphorsäure (H3PO4) sowie die Bestimmung ihrer Säurekonstanten pK1 und pK2.
Was sind Puffer und wie funktionieren sie?
Puffer sind Lösungen, die aus einer Mischung einer schwachen Säure oder Base und ihrem konjugierten Salz bestehen. Sie widerstehen Änderungen des pH-Werts, wenn kleine Mengen Säure oder Base hinzugefügt werden. Die Leseprobe beschreibt die Verwendung eines Acetatpuffers als Beispiel.
Welche Materialien werden für die Experimente mit Puffersystemen benötigt?
Für den Teil über Puffersysteme werden Büretten, Bechergläser, ein pH-Meter, äquimolarer Acetatpuffer (1M CH3COOH - 1M CH3COONa), 1M HCl und 1M NaOH benötigt.
Was sind mögliche Fehlerquellen bei der Arbeit mit Puffersystemen?
Mögliche Fehlerquellen umfassen Ungenauigkeiten bei der pH-Messung (Schwankungen der letzten signifikanten Stelle des pH-Meters) und Abweichungen in der Konzentration der verwendeten Reagenzien (z. B. Verwendung von 0,1M NaOH anstelle von 1M NaOH).
Was wird im Teil über die maßanalytische Bestimmung von H3PO4 behandelt?
Dieser Teil befasst sich mit der Titration von Phosphorsäure mit Natronlauge (NaOH), um die Äquivalenzpunkte zu bestimmen und daraus die Konzentration von H3PO4 sowie die Säurekonstanten pK1 und pK2 zu berechnen.
Welche Materialien werden für die maßanalytische Bestimmung von H3PO4 benötigt?
Für die Titration von H3PO4 werden Büretten, Bechergläser, ein Magnetrührer, ein pH-Meter, eine Analyselösung und 0,1M NaOH benötigt.
Wie werden die Äquivalenzpunkte und pKs-Werte aus der Titrationskurve bestimmt?
Die Äquivalenzpunkte werden durch Analyse der Titrationskurve (oder ihrer ersten und zweiten Ableitung) bestimmt, wobei die Maxima der ersten Ableitung und die Nullstellen der zweiten Ableitung auf die Äquivalenzpunkte hinweisen. Die pKs-Werte können näherungsweise an den Halbneutralisationspunkten abgelesen werden, an denen pH = pKs.
Wie beeinflusst die Ablesegenauigkeit die Ergebnisse der Titration?
Die Ablesegenauigkeit des pH-Meters, insbesondere die Schwankungen der letzten Stelle nach dem Komma, kann die Genauigkeit der bestimmten Äquivalenzpunkte und pKs-Werte beeinflussen. Daher werden sowohl rechnerische als auch zeichnerische Methoden zur Bestimmung der pKs-Werte verglichen, wobei die rechnerischen Werte tendenziell genauer sind.
- Arbeit zitieren
- Tobias Scharla (Autor:in), 2001, Puffersysteme und mehrprotonige Säuren, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/102635