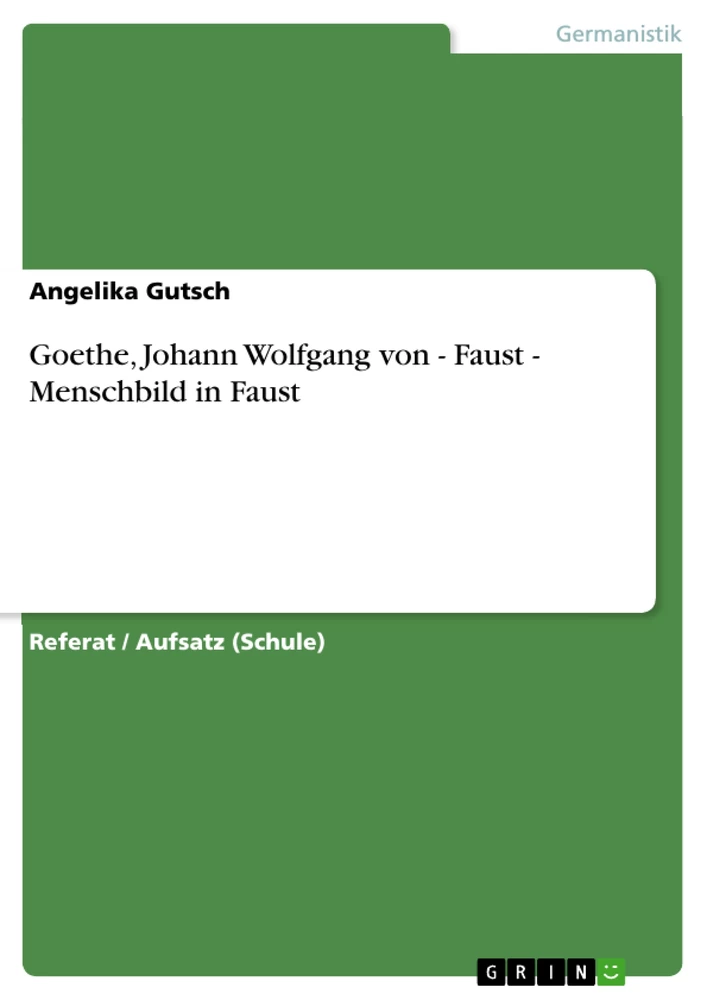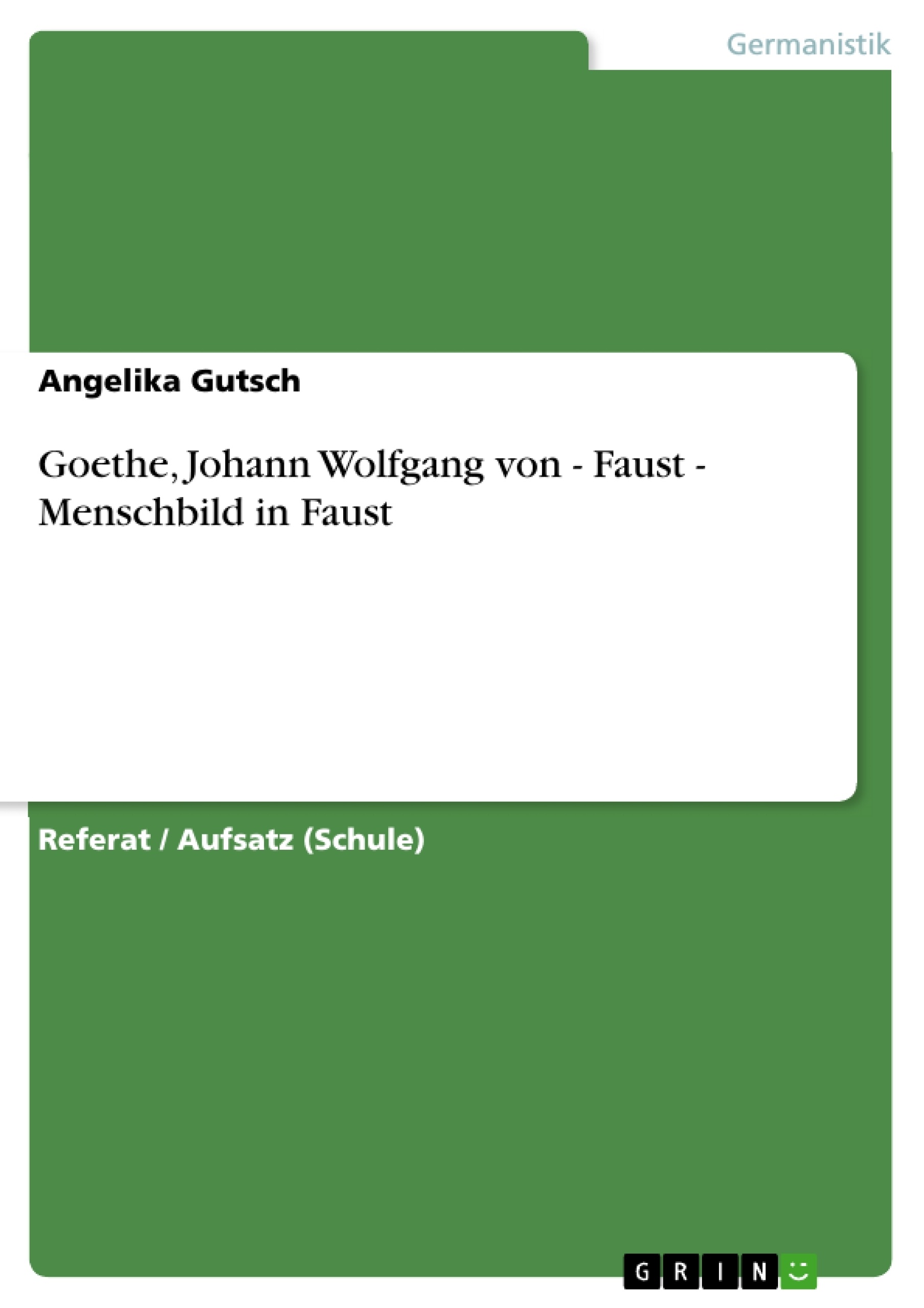Was bedeutet es, Mensch zu sein, wenn man nach unendlicher Erkenntnis und irdischer Lust strebt? Goethes "Faust", ein zeitloses Menschheitsdrama, entführt den Leser in die rastlose Seele des Dr. Faust, einem Gelehrten, der nach dem Sinn des Lebens sucht. Getrieben von dem unstillbaren Durst nach Wissen und Erfahrung, schließt Faust einen Pakt mit Mephisto, dem Teufel, und begibt sich auf eine Reise, die ihn durch die Höhen und Tiefen der menschlichen Existenz führt. Die Geschichte, angesiedelt in der Epoche der deutschen Klassik, verwebt auf meisterhafte Weise die Ideale von Humanität und Harmonie mit den dunkleren Aspekten der menschlichen Natur. Im Zentrum steht die Frage, ob der Mensch durch ständiges Streben und trotz aller Irrtümer seine Bestimmung erfüllen kann. Der Leser erlebt Fausts Verzweiflung in seinem Studierzimmer, seine flüchtigen Momente des Glücks in der Natur, seine tragische Liebe zu Gretchen und seine rastlose Suche nach immer neuen Erfahrungen. Von Auerbachs Keller bis zur Walpurgisnacht, von der Erschaffung des Homunculus bis zur Landgewinnung am Meer – Fausts Weg ist geprägt von Ekstase, Verzweiflung und dem unaufhörlichen Kampf zwischen Vernunft und Gefühl. Das Werk analysiert das Menschenbild der Klassik, indem es die Dualität des Menschen, seine Zerrissenheit zwischen Geist und Trieb, und sein Verhältnis zur Natur untersucht. Es ist eine Geschichte über Schuld und Sühne, über die Grenzen der Erkenntnis und die Bedeutung der Gemeinschaft. Die Tragödie beleuchtet die Beziehung zwischen Kunst, Politik und Gesellschaft und dient als Anregung für eine Revolution, die zu menschenwürdigeren Verhältnissen führt. "Faust" ist mehr als nur ein literarisches Meisterwerk; es ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit der menschlichen Natur, die den Leser auch heute noch in ihren Bann zieht und zum Nachdenken anregt. Tauchen Sie ein in Goethes Welt und entdecken Sie die zeitlose Relevanz dieses Dramas für unsere heutige Gesellschaft. Erleben Sie eine fesselnde Geschichte über die menschliche Psyche, die tiefgründige Charaktere und die philosophischen Fragen des Lebens.
Aufgabe: Wie wird im Faust das Menschenbild der Klassik verwirklicht?
Die Epoche der deutschen Klassik, auch Weimarer Klassik genannt, beginnt in etwa mit Goethes erster Reise nach Italien (1786 - 1788) und endet streng genommen mit dem Tod Schillers 1805.
Voraussetzungen für die Blütezeit der deutschen Literatur waren der Rationalismus, der Sturm und Drang sowie die Leistungen Klopstocks, Wielands, Lessings und Herders.
Im engen Sinne gehören nur Goethe und Schiller zur deutschen Klassik. Menschenbildung und Menschenerziehung durch die Darstellung von Persönlichkeiten, die wahre Humanität und Harmonie verkörpern, war ihr Ziel. Eine dieser Persönlichkeiten war Dr. Johannes Faust, der als Arzt und Gelehrter in Deutschland umherzog und als Zauberkünstler großes Aufsehen erregte. Schon zu seinen Lebzeiten wurde er eine Sagengestalt und die Geschichten über ihn Grundlage eines Volksbuches. Goethe legte den Stoff als Menschheitsdrama in zwei Teilen (Faust I 1808, Faust II 1832) an.
Bereits im Prolog wird der Leser mit den Merkmalen des Menschenbildes des Sturm und Drang, welches in der Klassik zum Humanitätsideal weiterentwickelt wurde, vertraut gemacht. Im Dialog zwischen Herr und Mephisto wird die Stellung des Menschen innerhalb der Schöpfung durch seine Möglichkeiten und Grenzen gekennzeichnet. Durch seine Vernunft hat er Teil am Unendlichen, unterliegt aber der Endlichkeit alles Lebenden durch Raum und Zeit. Außerdem ist er den Gesetzen der Sinnlichkeit unterworfen. Daraus ergibt sich seine Doppelnatur: „Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,“ (Z. 1112).
Der Herr ist der Ansicht, dass der Mensch durch ständiges Streben, aufgrund der Teilhabe am „Himmelslicht“ (Z. 284), seine Anlagen und sein Wesen verwirklicht. Verwirrung und Irrtum sind Teil des Strebens und führen zur Klarheit (=positives Menschenbild). Dem gegenüber steht Mephistos Auffassung vom „wunderlichen Wesen“ (Z. 282), welches sich durch die Vernunft vom Tier unterscheidet, im Handeln ihm aber gleicht (=negatives Menschenbild). Durch den Herrn wird das Göttliche, durch Mephisto das Tierische im Menschen beschrieben. Die Wette um das Wesen des Menschen, in der Mephisto die Erlaubnis erhält, zu prüfen, ob ein Mensch auf das Element seiner dualistischen Wesensbestimmung (auf die tierische Existenz) reduziert werden kann, ist die Folge.
Faust ist das „Opfer“ dieser Wette, denn er fordert „vom Himmel...die schönsten Sterne“ und zugleich „von der Erde jede höchste Lust“ (Z. 304/305). Sein Wunsch und Ziel ist es, Erkenntnis über alles Irdische zu erlangen („Dass ich nicht mehr mit sauerm Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß; dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält“ Z 380-383), obwohl er bereits Philosoph, Jurist, Mediziner und Theologe (Z. 354-356) ist. Die Entwicklung zur harmonischen Persönlichkeit wird zur Lebensaufgabe, indem er mit dem Teufel paktiert. Mephisto will dem alle Lebenswerte verfluchenden Faust alle irdischen Wünsche erfüllen. Doch er ahnt nicht, dass Faust nie befriedigt wird und schmerzlichster Genuss ihn immer weiter treibt. Die Erfindung des Papiergeldes (Faust II, Lustgarten), die Erschaffung des Homunculus’ (Faust II, Rittersaal) sowie der Gedanke an die Landgewinnung aus dem Meer (Faust II, Hochgebirg) sind Beispiele für den zur Tat drängenden Geist Fausts.
Auf seiner „Weltreise“ wendet sich Faust ebenso angeekelt von der bornierten Studentenrunde in „Auerbachs Keller“ wie vom Spuk der „Hexenküche“ ab und duldet nur widerwillig die Verjüngung durch den Hexentrank. Doch ihn reizt die Möglichkeit der Überschreitung von Grenzen durch den Gebrauch der Magie. Die Harmonie von Geist und Natur, die ein weiteres Merkmal des klassischen Menschenbildes ist, wird vor allem in den Szenen „Vor dem Tor“ (Faust I), „Wald und Höhle“ (Faust I) und „Anmutige Gegend“ (Faust II) deutlich. Faust heilt seine seelische Erschütterung, in dem er die Schönheit der Natur bewundert, die ihn zu neuem Handeln anregt: „Schon tut das Meer sich mit erwärmten Buchten vor den erstaunten Augen auf. Doch scheint die Göttin endlich wegzusinken; allein der neue Trieb erwacht, ich eile fort, ihr ew’ges Licht zu trinken“ (Z. 1082-1086).
Die „Anmutige Gegend“ stellt den Beginn des zweiten Teils des Faustdramas dar. Faust erwacht an einem Frühlingsmorgen nach dem Heilschlaf des Vergessens zu neuem Leben und badet „in Lethes Flut“ (Z. 4604). Die Einigkeit mit der Natur ermuntert ihn erneut zu höchstem Daseinsstreben. Die Szene „Wald und Höhle“ zeigt außerdem die Hin- und Hergerissenheit Fausts zwischen seinem maßlosen Unendlichkeitsdrang und der Liebe zu Gretchen: „So tauml’ ich von Begierde zu Genuss, und im Genuss verschmacht ich nach Begierde“ (Z. 3249/3250). Sie stellt den Widerstreit zwischen Vernunftgebot und Gefühl, ein weiteres Merkmal des Menschenbildes, dar. Dies wird auch im Arkadienglück des traumhaften Bundes mit Helena in der klassisch - romantischen Phantasmagorie des dritten Aktes deutlich. Auf wolkenumgebenen Gipfel wendet sich Faust von der tieferfahrenden Sinnenschönheit zu der aus der Erinnerung als höchstes Gut aufsteigenden Seelenschönheit Gretchens.
Der Pakt mit dem Teufel lässt den Antagonismus zwischen Sittengesetz und Antrieben erkennen. Dieses Kennzeichen des klassischen Menschenbildes veranschaulicht Goethe außerdem noch im Wunsch Fausts nach einem Zaubermantel (Z. 1122) und dem vorehelichen Geschlechtsverkehr mit dem 14jährigen Gretchen, die daraufhin ein Kind bekommt.
Pflichtgefühl und Neigungen lassen Faust den Versuch unternehmen, Gretchen aus dem Kerker zu retten, denn er ist sich seiner Schuld bewusst. Goethe stellt den Bezug zur Antike, der die Epoche der Klassik ebenfalls kennzeichnet, in der Selbstdarstellung der Helena im dritten Akt durch die Verwendung antiker Versmaße (Trimeter) her.
Faust steigert sich vom geld- und besitzlosen Doktor zum angesehenen Menschen in würdigeren Verhältnissen.
Der gute Wille und die sittliche Gesinnung der Faustfigur wird vor allem in der Todesszene (Großer Vorhof des Palastes) deutlich. Er löst sich von aller titanischen Selbstverwirklichung, erhebt sich vom Tatengenuss nach außen zum Schöpfungsgenuss nach innen und bekennt sich zum Glück der Gemeinschaftsverantwortung auf neu geschaffenem freiem Land. „Im Vorgefühl solchen hohen Glücks“ genießt er „den höchsten Augenblick“ (Z. 11585/11586) und schreitet somit innerlich weiter.
Fausts Zwienatur wandelt sich zu fortwirkender Geisteskraft, und sein irrendes Streben hebt sich als Gleichnis konfliktreicher Menschheitsentwicklung in den ätherischen Dimensionen des schöpferischen Urquells auf.
Häufig gestellte Fragen zu "Faust" und dem Menschenbild der Klassik
Was ist die Epoche der deutschen Klassik?
Die deutsche Klassik, auch Weimarer Klassik genannt, begann um 1786 mit Goethes Italienreise und endete 1805 mit Schillers Tod. Sie baute auf Rationalismus, Sturm und Drang sowie den Werken von Klopstock, Wieland, Lessing und Herder auf.
Wer gehören zur deutschen Klassik?
Im engeren Sinne gehören nur Goethe und Schiller zur deutschen Klassik. Ihr Ziel war die Menschenbildung und -erziehung durch die Darstellung von Persönlichkeiten, die Humanität und Harmonie verkörpern.
Wer war Dr. Johannes Faust?
Dr. Johannes Faust war ein Arzt und Gelehrter, der als Zauberkünstler Aufsehen erregte. Er wurde zu einer Sagengestalt und Grundlage eines Volksbuches, welches Goethe als Menschheitsdrama in zwei Teilen (Faust I 1808, Faust II 1832) verarbeitete.
Wie wird das Menschenbild im Prolog von Faust dargestellt?
Im Prolog wird das Menschenbild des Sturm und Drang, welches in der Klassik zum Humanitätsideal weiterentwickelt wurde, thematisiert. Der Dialog zwischen Herr und Mephisto kennzeichnet die Stellung des Menschen innerhalb der Schöpfung durch seine Möglichkeiten und Grenzen. Der Mensch hat Teil am Unendlichen, unterliegt aber der Endlichkeit und den Gesetzen der Sinnlichkeit, woraus seine Doppelnatur resultiert.
Welche unterschiedlichen Auffassungen vom Menschenbild vertreten Herr und Mephisto?
Der Herr sieht den Menschen als jemanden, der durch ständiges Streben und Teilhabe am „Himmelslicht“ sein Wesen verwirklicht. Verwirrung und Irrtum sind Teil dieses Strebens. Mephisto hingegen sieht den Menschen als ein „wunderliches Wesen“, das sich durch die Vernunft vom Tier unterscheidet, ihm aber im Handeln gleicht. Der Herr beschreibt das Göttliche, Mephisto das Tierische im Menschen.
Was ist der Inhalt der Wette zwischen Herr und Mephisto?
Mephisto erhält die Erlaubnis, zu prüfen, ob der Mensch auf seine tierische Existenz reduziert werden kann. Faust wird zum „Opfer“ dieser Wette, da er nach Erkenntnis über alles Irdische strebt und mit dem Teufel paktiert.
Welches Ziel verfolgt Faust in seinem Pakt mit dem Teufel?
Faust will Erkenntnis über alles Irdische erlangen, obwohl er bereits Philosoph, Jurist, Mediziner und Theologe ist. Er möchte erkennen, „was die Welt im Innersten zusammenhält“. Mephisto will ihm alle irdischen Wünsche erfüllen, ahnt aber nicht, dass Faust nie befriedigt wird.
Wie wird die Harmonie von Geist und Natur in Faust dargestellt?
Die Harmonie von Geist und Natur, ein Merkmal des klassischen Menschenbildes, wird in den Szenen „Vor dem Tor“, „Wald und Höhle“ und „Anmutige Gegend“ deutlich. Faust heilt seine seelische Erschütterung, indem er die Schönheit der Natur bewundert.
Welche Rolle spielt Gretchen in Fausts Entwicklung?
Die Liebe zu Gretchen verdeutlicht den Widerstreit zwischen Vernunftgebot und Gefühl, ein weiteres Merkmal des Menschenbildes. Faust wird zwischen seinem Unendlichkeitsdrang und der Liebe zu Gretchen hin- und hergerissen.
Wie wird der Bezug zur Antike in Faust hergestellt?
Der Bezug zur Antike, ein Kennzeichen der Klassik, wird in der Selbstdarstellung der Helena im dritten Akt durch die Verwendung antiker Versmaße (Trimeter) hergestellt.
Wie entwickelt sich Faust im Laufe des Dramas?
Faust steigert sich vom geld- und besitzlosen Doktor zum angesehenen Menschen in würdigeren Verhältnissen. Seine Entwicklung ist geprägt von Streben, Erkenntnisgewinn und der Auseinandersetzung mit seiner eigenen Zwienatur.
Welche Bedeutung hat die Todesszene für die Darstellung des Menschenbildes?
In der Todesszene wird der gute Wille und die sittliche Gesinnung Fausts deutlich. Er löst sich von titanischer Selbstverwirklichung und bekennt sich zum Glück der Gemeinschaftsverantwortung. Er genießt „den höchsten Augenblick“ im Vorgefühl eines solchen hohen Glücks.
Welche Botschaft vermittelt das Menschheitsdrama Faust?
Das Menschheitsdrama verkörpert das Verhältnis von Kunst, Politik und Gesellschaft und regt zur Herstellung menschenwürdigerer Zustände an. Es thematisiert die konfliktreiche Menschheitsentwicklung und die Bedeutung von Streben und Erkenntnis.
- Quote paper
- Angelika Gutsch (Author), 2001, Goethe, Johann Wolfgang von - Faust - Menschbild in Faust, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/102500