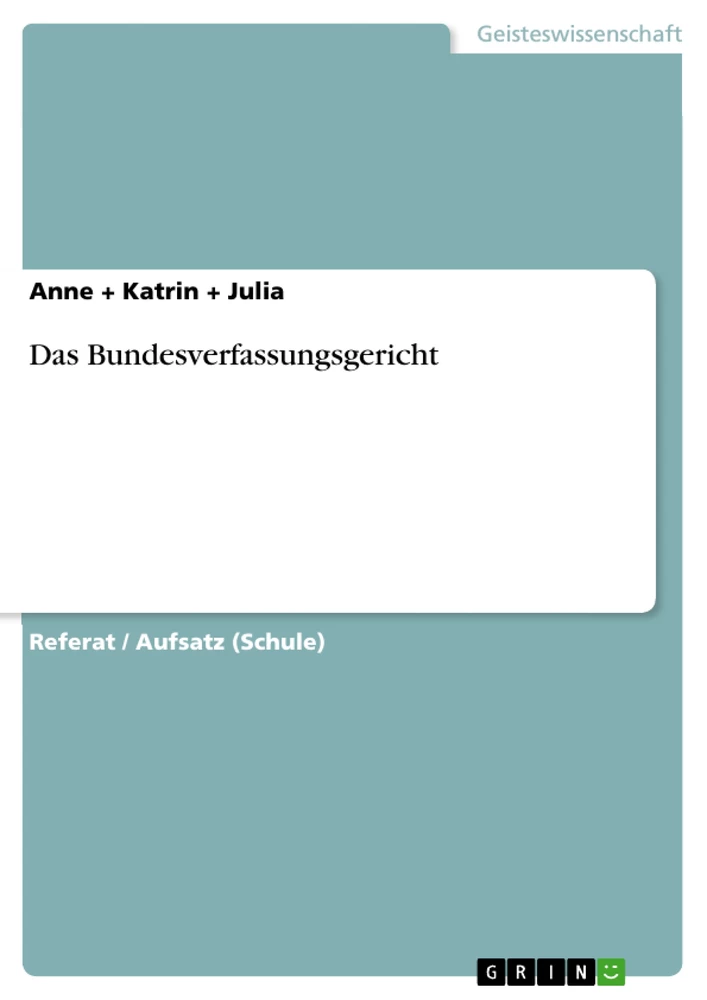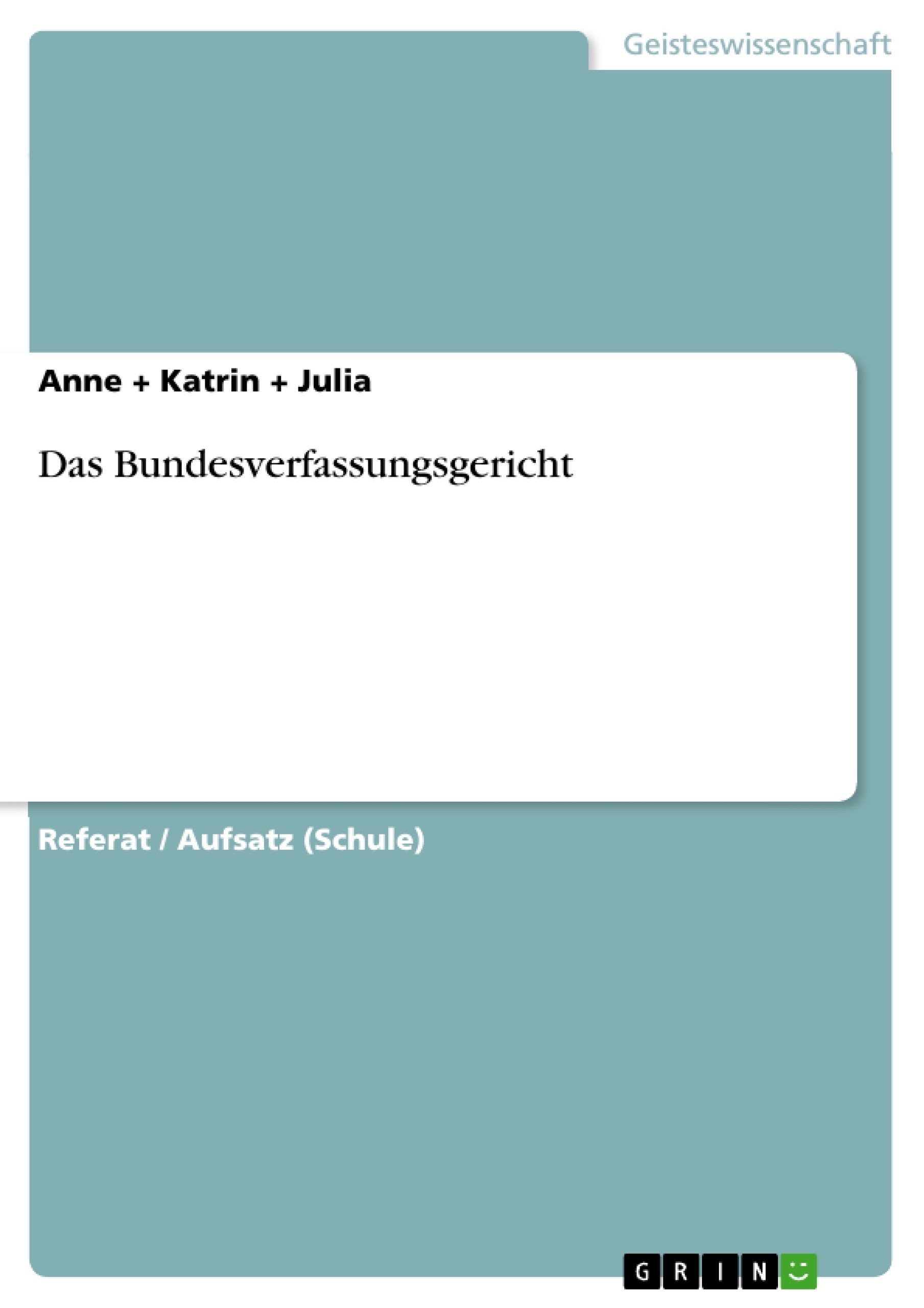Hinter den Mauern von Karlsruhe, wo Recht und Politik sich unweigerlich begegnen, wirkt das Bundesverfassungsgericht (BVerfG), das höchste Gericht der Bundesrepublik Deutschland. Doch was genau verbirgt sich hinter dieser Institution, die oft als "Zwillingsgericht" bezeichnet wird und deren Entscheidungen das politische und gesellschaftliche Leben maßgeblich beeinflussen? Diese kompakte Darstellung beleuchtet die essenziellen Aspekte des BVerfG, von seiner verfassungsrechtlichen Verankerung in Artikel 92 GG bis hin zu seiner komplexen Struktur mit zwei Senaten, die jeweils mit acht Richtern besetzt sind. Erfahren Sie mehr über die Voraussetzungen und das Wahlverfahren der Richter, die für eine Amtszeit von 12 Jahren berufen werden und die Unabhängigkeit der Rechtssprechung garantieren. Ein besonderer Fokus liegt auf den vielfältigen Aufgaben des Gerichts, darunter die Entscheidung von Organstreitigkeiten und föderativen Streitigkeiten, die Normenkontrolle zur Überprüfung der Vereinbarkeit von Gesetzen mit dem Grundgesetz sowie die Bearbeitung von Verfassungsbeschwerden, die von jedem Bürger eingelegt werden können. Entdecken Sie die Tätigkeitsschwerpunkte des "Grundrechtssenats" und des "Staatsrechtssenats" und gewinnen Sie Einblicke in die Verfahren zur Parteienverbotsprüfung und Wahlrechtsbeschwerde. Anhand von Beispielen wird die politische Relevanz des BVerfG verdeutlicht, das seit 1951 über 2250 Senatsentscheidungen getroffen und bis 1998 bereits 216 Gesetze und Verordnungen für nichtig erklärt hat. Dieses Buch bietet eine fundierte Einführung in die Arbeitsweise und Bedeutung des Bundesverfassungsgerichts im deutschen Rechtssystem, ein unverzichtbarer Wegweiser für alle, die sich für Verfassungsrecht, Politik und die Funktionsweise unserer Demokratie interessieren. Es ist eine Reise durch das Herz der deutschen Rechtsprechung, die Einblicke in die Mechanismen der Macht und die Garantien der Grundrechte gewährt. Das Buch schlägt eine Brücke zwischen komplexen juristischen Sachverhalten und einem breiten Publikum und macht das Verfassungsgericht zu einem lebendigen und verständlichen Akteur im politischen Gefüge Deutschlands.
Gliederung
1. Vermerk im GG
2. Charakterisierung
3. Aufbau
4. Sitz/Vorsitzender
5. Aufgaben
6. Wahl
7. Beispiele
1. Vermerk im GG
- art 92 GG: Die rechtssprechende Gewalt ist den Richtern anvertraut; sie wird durch das Bundesverfassungsgericht, durch die in diesem Grundgesetz vorgesehenen Bundesgerichte und durch die Gerichte der Länder ausgeübt.
- art 97(1) GG: Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen.
- weitere Artikel: Aufgaben, Befugnisse des Bundesverfassungsgerichtes sind in den Artikeln 92, 93, 94, 99 und 100 des Grundgesetzes festgelegt.
2. Charakterisierung
- Abkürzungen: BVG oder BVerfG
- höchstes Gericht der BRD
- auch Zwillingsgericht genannt
- steht im Spannungsfeld von Politik und Recht
- oberstes Verfassungsorgan
- unabhängig und selbstständig gegenüber anderen Verfassungsorganen
- Entscheidung auch für andere Verfassungsorgane bindend
- Eigenen verfassungsrechtlichen Status
3. Aufbau
- 2 einander gleichgesetzte Senate, die heute mit je 8 Richtern besetzt sind (vor 1963: 10 und mehr)
- davon müssen 3 Richter ehemals Richter am Obersten Gerichtshof des Bundes tätig gewesen sein (mind. 3 Jahre)
- restlichen 5 können befähigte Juristen aller Berufe sein
- seit 1986 können sich die Richter in dem anderen Senat vertreten
4. Sitz/Vorsitzender
- seit 1951 in Karlsruhe
- Senate sind unter Vorsitz von Präsident und Vizepräsident
- Präs./Vizepräs.:
- höchste Repräsentanten der Rechtssprechung der BRD
- in gleicher Ebene wie Bundespräsident, Bundesratpräsident
- Vertreter ist jeweils dienstälteste Senatsmitglied
- heute: Präsident: Jutta Limbach (Vorsitzende des 2. Senats)
Vizepräsident: Prof. Dr. Papier (Vorsitzender des 1. Senats)
5. Aufgaben
Allgemeine Aufgaben:
- Entscheidung von Organstreitigkeiten (Streitigkeiten zwischen Organen des Bundes oder der Länder)
- Entscheidung von föderativen Streitigkeiten (Streitigkeiten zwischen Bund und Länder oder zwischen Ländern)
- Normenkontrolle, d.h. die Überprüfung eines Gesetzes auf seine Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz
- Entscheidung über Verfassungsbeschwerden (Diese kann von jedem Deutschen eingereicht werden, der sich in einem Grundrecht, von der öffentlichen Gewalt verletzt sieht. Abgesehen von wenigen Ausnahmen nimmt das BFG eine Verfassungsbeschwerde erst dann an, wenn zuvor der normale Rechtsweg ausgeschöpft wurde.)
- Entscheidung über die Verfassungswidrigkeit von Parteien
- Hauptaufgabe besteht darin, zu prüfen, ob das Handeln politisch - administrativer Akteure verfassungsgemäß ist
- bestimmt nur den verfassungsrechtlichen Rahmen des politischen Entscheidungsspielraumes
Tätigkeitsbereiche des BVG nach art 93 GG:
- Bundesstaatliche Streitigkeiten
- Organklagen
- abstrakte und konkrete Normenkontrollen
- Verfassungsbeschwerden
- sonstige Kompetenzen (z.B. strafrechtliche Verfahren und Wahlprüfungsverfahren)
Aufgaben des ersten Senats („Grundrechtssenat“):
- befasst sich mit Normenkontrollverfahren, d.h. ob Gesetze mit Grundrecht vereinbar sind
- Verfassungsbeschwerden art 1-17
Aufgaben des zweiten Senats („Staatsrechtssenat“):
- Normenkontrolle und Verfassungsbeschwerden des öffentlichen Dienstes, des Wehr- und Ersatzdienstes, sowie des Straf- und Bußgeldverfahrens, Organstreitigkeiten zwischen Bund und Ländern
- Parteienverbote
- Wahlrechtsbeschwerden
6. Wahl
- 2 Senate mit je 8 Richtern, zur Hälfte von Bundestag und zur Hälfte von Bundesrat gewählt
- Amtszeit: 12 Jahre
- Richter (mind. 40 Jahre; max. 68 Jahre, volle juristische Ausbildung) von Bundespräsident ernannt
- Wiederwahl nicht möglich (→ Schutz vor parteipolitischer Abhängigkeit)
- Kandidatenvorschläge können dabei von Fraktionen, Bundes- und Landesregierung geäußert werden
- Zwölferausschuss (Wahlausschuss aus 12 Mitgliedern des Bundestages) im Bundestag → Richter benötigt 8 Stimmen für Wahl → indirekte Wahl
- andere Hälfte ist direkte Wahl durch Bundesrat
- nach Wahl Richter nur noch in Ausnahmefällen austauschbar
- jeweils 2/3 Mehrheit
- sie dürfen weder Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung, noch einem entsprechendem Organ auf Länderebene angehören
- jeweils 3 Richter aus obersten Gerichtshöfen des Bundes
- beim Ausscheiden eines Richters → Nachfolger vom selben Organ gewählt
- Bundestag und Bundesrat wählen im Wechsel Präsidenten und Vizepräsidenten des BVG
7. Beispiele
- Seit 1951 2250 Senatsentscheidungen
- 80000 Beschwerden (95% davon Verfassungsbeschwerden)
- 78 Bände der Amtlichen Sammlung+
- bis 1998 216 Gesetze und Verordnungen für nichtig erklärt
- bis 1990 jedes 8. Bundesgesetz überprüft
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Bundesverfassungsgericht (BVG/BVerfG)?
Das Bundesverfassungsgericht (BVG oder BVerfG) ist das höchste Gericht der Bundesrepublik Deutschland. Es wird auch als Zwillingsgericht bezeichnet und steht im Spannungsfeld von Politik und Recht. Es ist das oberste Verfassungsorgan und unabhängig und selbstständig gegenüber anderen Verfassungsorganen. Seine Entscheidungen sind auch für andere Verfassungsorgane bindend und es hat einen eigenen verfassungsrechtlichen Status.
Wo ist das Bundesverfassungsgericht im Grundgesetz (GG) erwähnt?
Artikel 92 GG legt fest, dass die rechtssprechende Gewalt den Richtern anvertraut ist und durch das Bundesverfassungsgericht, die im Grundgesetz vorgesehenen Bundesgerichte und die Gerichte der Länder ausgeübt wird. Artikel 97(1) GG bestimmt, dass die Richter unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen sind. Weitere Artikel (92, 93, 94, 99 und 100 GG) legen die Aufgaben und Befugnisse des Bundesverfassungsgerichts fest.
Wie ist das Bundesverfassungsgericht aufgebaut?
Das Bundesverfassungsgericht besteht aus zwei einander gleichgesetzten Senaten, die jeweils mit 8 Richtern besetzt sind (vor 1963 waren es 10 oder mehr). Von diesen Richtern müssen 3 ehemals Richter am Obersten Gerichtshof des Bundes gewesen sein (mindestens 3 Jahre). Die restlichen 5 können befähigte Juristen aller Berufe sein. Seit 1986 können sich die Richter im anderen Senat vertreten.
Wo ist der Sitz des Bundesverfassungsgerichts und wer sind die Vorsitzenden?
Der Sitz des Bundesverfassungsgerichts ist seit 1951 in Karlsruhe. Die Senate werden von einem Präsidenten und einem Vizepräsidenten geleitet. Diese sind die höchsten Repräsentanten der Rechtssprechung der BRD und stehen auf der gleichen Ebene wie der Bundespräsident und der Bundesratspräsident. Der Vertreter ist jeweils das dienstälteste Senatsmitglied.
Welche Aufgaben hat das Bundesverfassungsgericht?
Zu den allgemeinen Aufgaben gehören die Entscheidung von Organstreitigkeiten (zwischen Organen des Bundes oder der Länder), die Entscheidung von föderativen Streitigkeiten (zwischen Bund und Länder oder zwischen Ländern), die Normenkontrolle (Überprüfung eines Gesetzes auf seine Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz), die Entscheidung über Verfassungsbeschwerden (die von jedem Deutschen eingereicht werden kann, der sich in einem Grundrecht von der öffentlichen Gewalt verletzt sieht), und die Entscheidung über die Verfassungswidrigkeit von Parteien. Die Hauptaufgabe besteht darin, zu prüfen, ob das Handeln politisch-administrativer Akteure verfassungsgemäß ist und bestimmt nur den verfassungsrechtlichen Rahmen des politischen Entscheidungsspielraums.
Welche Tätigkeitsbereiche hat das BVG nach Artikel 93 GG?
Das BVG befasst sich mit bundesstaatlichen Streitigkeiten, Organklagen, abstrakten und konkreten Normenkontrollen, Verfassungsbeschwerden und sonstigen Kompetenzen (z.B. strafrechtliche Verfahren und Wahlprüfungsverfahren).
Welche Aufgaben hat der erste Senat (Grundrechtssenat)?
Der erste Senat befasst sich mit Normenkontrollverfahren (ob Gesetze mit Grundrechten vereinbar sind) und Verfassungsbeschwerden (Artikel 1-17).
Welche Aufgaben hat der zweite Senat (Staatsrechtssenat)?
Der zweite Senat befasst sich mit Normenkontrolle und Verfassungsbeschwerden des öffentlichen Dienstes, des Wehr- und Ersatzdienstes, sowie des Straf- und Bußgeldverfahrens, Organstreitigkeiten zwischen Bund und Ländern, Parteienverboten und Wahlrechtsbeschwerden.
Wie werden die Richter des Bundesverfassungsgerichts gewählt?
Die 2 Senate mit je 8 Richtern werden zur Hälfte vom Bundestag und zur Hälfte vom Bundesrat gewählt. Die Amtszeit beträgt 12 Jahre. Die Richter (mind. 40 Jahre, max. 68 Jahre, volle juristische Ausbildung) werden vom Bundespräsidenten ernannt. Eine Wiederwahl ist nicht möglich, um parteipolitische Abhängigkeit zu vermeiden. Kandidatenvorschläge können von Fraktionen, Bundes- und Landesregierungen geäußert werden. Im Bundestag wählt der Zwölferausschuss (Wahlausschuss aus 12 Mitgliedern des Bundestages) die Richter (8 Stimmen benötigt). Die andere Hälfte wird direkt vom Bundesrat gewählt. Nach der Wahl sind die Richter nur noch in Ausnahmefällen austauschbar. Es ist jeweils eine 2/3 Mehrheit erforderlich. Sie dürfen weder dem Bundestag, Bundesrat, der Bundesregierung noch einem entsprechenden Organ auf Länderebene angehören. Jeweils 3 Richter müssen aus den obersten Gerichtshöfen des Bundes stammen. Beim Ausscheiden eines Richters wird der Nachfolger vom selben Organ gewählt. Bundestag und Bundesrat wählen im Wechsel Präsidenten und Vizepräsidenten des BVG.
Welche Beispiele für die Arbeit des Bundesverfassungsgerichts gibt es?
Seit 1951 gab es 2250 Senatsentscheidungen und 80000 Beschwerden (95% davon Verfassungsbeschwerden). Es gibt 78 Bände der Amtlichen Sammlung. Bis 1998 wurden 216 Gesetze und Verordnungen für nichtig erklärt. Bis 1990 wurde jedes 8. Bundesgesetz überprüft. Die politische Relevanz zeigt sich in der Möglichkeit des Parteienverbotes (1952 - SRP; 1956 - KPD).
- Quote paper
- Anne + Katrin + Julia (Author), 2001, Das Bundesverfassungsgericht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/102435