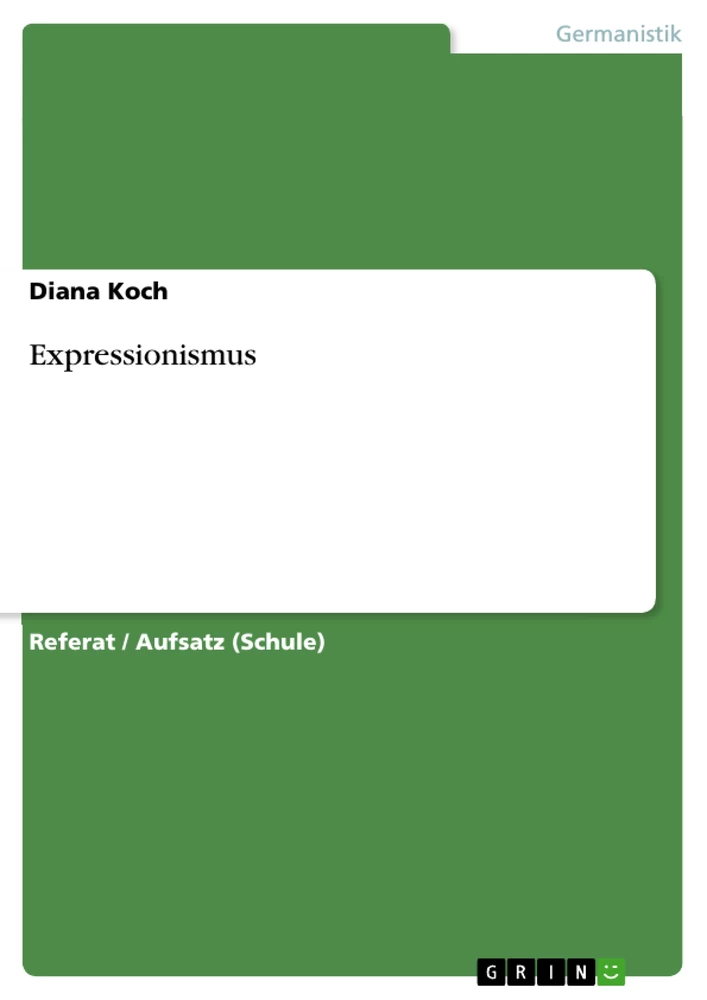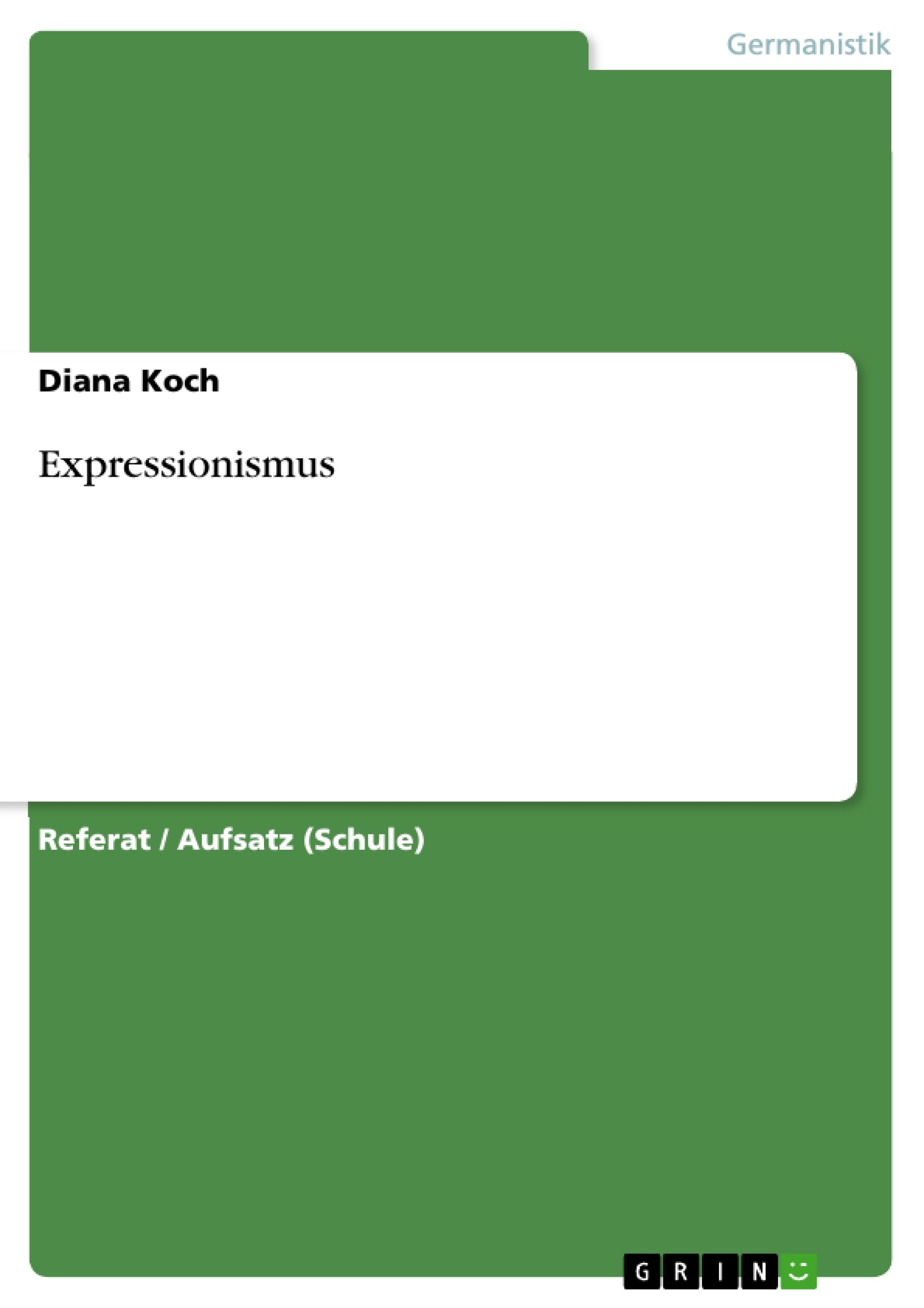Geschichtlicher Hintergrund:
- Erster Weltkrieg, Ende des Kaiserreichs, Krisenjahre der Weimarer Republik
- Industrialisierung, Landflucht, Verstädterung, Massengesellschaft, Großstadtleben
- Verhaltensunsicherheiten, Erschütterung des alten Weltbildes, Hoffungslosigkeit
- Gefühl der Ausweglosigkeit, Melancholie, Weltuntergangsstimmung
Definition des Wortes „Expressionismus“:
- Wörtlich: Ausdruckskunst
- Inneres Erleben des Künstlers provozierend nach außen tragen
- Gegenteil zum Impressionismus (= oberflächlich)
Kritik an:
- Fragwürdiger gewordener Moral
- Wohlstand, der z.T. nur aus Auzsbeutung entstanden ist
- Technischem Fortschritt, Positivismus, Kulturverfall
- Militarismus, Patriotismus, Krieg und Gewalt
- Spießbürgertum
- Fremdbestimmung, Autorität und Sinnlosigkeit
- Großstadt, Zivilisation, soziales Elend, Individualitätsverlust
- Verachtung und Hass der bürgerlichen Welt (Kapitalinteressen, Nützlichkeitsdenken)
- Materealismus, Egoismus
- Engstirnigkeit, bürgerliche Sicherheit, Selbstzufriedenheit
- Verlogene Fassade der Väter, die Werte waren ihnen abhanden gekommen, ihre Ideale nur noch Floskeln => Vater Sohn Konflikt (endet oft im Vatermord)
- Vater ist Symbol für wilhelminische Zeit, Doppelmoral, Vergangenheit)
Ziele und Forderungen:
- Durch Veränderung des Individuums => Wandel der Gesellschaft (denn die Masse könne nichts bewirken, der einzelne müsse sicher ändern)
- Streben nach Erneuerung und Verwesentlichung des Menschen
- Menschlichkeit, Humanität, Menschen würde
- Ausbruch aus den Konventionen von Kunst und Leben
- Schrei nach Eigentlichkeit
- Beschränkung auf das Wesentliche
- Veränderung durch radikalen Umbruch(z.T. galt der 1. Weltkrieg als Chance der Erneuerung)
- Mit Pazifismus die Welt verbessern
- Idee vom „neuen“ Menschen
- Wirklichkeitszertrümmerung (zur Erneuerung) durch Sprachzertrümmerung)
- Gefühle direkt verkünden
- Gesellschaft wachrütteln und zu Veränderungen aufrufen
- Forderung der „weltweiten“ Bruderschaft
- Überwindung beengender Schranken (z.B. der Formschranken), Befreiung von Zwängen
- Suche nach dem Sinn des Lebens
- Geistige Wiedergeburt (event. auch politisch-soziale Neuordnung)
- Ersehnten das „reinigende Gewitter“ (z.B. 1.Weltkrieg)
- Menschenliebe und Gemeinschaftssinn
- Innere Erneuerung, Aufbruch, Revolution
Sprache und Stil:
- Schrei und Ausrufe, Telegrammstil
- Verkürzung von Sätzen zur Beschränkung der Sprache auf das Wesentliche
- Verbalstil ("Entsubstantivierung der Welt", Schaffung neuer Verben: tieren, blumen, ...)
- Allegorie
- Personifikation (Ideen, Phantasien und leblose Dinge werden als Wesen dargestellt)
- Synästhesie (Erregung eines Sinnesorgans durch einen nichtspezifischen Reiz)
- Symbole und Farbchiffren
- Wortballungen, Worthäufungen
- Gesteigertes Tempo
- Starke Rhytmesierung und Dynamisierung
- Ausdrucksstarke Neologismen (traditioneller Wortschatz zu klein für Expressionisten)
- Hymenhafte Sprache, pathetisch
- Häufige Verwendung von Parataxen (= abgehackt, zerstörerisch)
- Kühne Metaphern
- Allein die Ausdruckskraft ist Kriterium zur Bewertung
Form:
- Ordnung und Geschlossenheit nur im Gegensatz zum Inhalt => Provokation
- Keine Grammatik und Normen
- Satzfetzen
- Reihungen ohne logischen Zusammenhang
- Form war zu eng für Expressionisten, sie wollten sich von allen alten Regeln lösen
Themen:
- Vielfalt an Themen, von Autor zu Autor unterschiedlich
- Visionen von Krieg und Weltuntergang, Apokalypse, Sintflut, Gerichtstag
- Großstadt, das Ich
- Dunkele Bilder von der Zivilisationswüste Stadt, dämonische Untergangsphantasien (besonders bei Georg Heym = „Seher des Krieges“)
- Sensible Außenseiter sehen den Untergang (der bürgerlichen Welt), Bürger nehmen es nicht wahr (fühlen sich sicher)
- Seelenlosigkeit der Masse
- Ästhetik der Hässlichkeit, Weltentwertung (Benn)
- Keine Natur und Landschaftsbeschreibungen
- Düsternis, Dunkelheit, Bedrücktheit
- Krankheit, Darstellung des Schrecklichen und Grausamen, Zerfall und Tod bes. Benn)
- Leid, Schmerz, Liebe, Gott bei Else Lasker Schüler
- Umkehrung der Werte, Wertezertrümmerung
Wirkung:
- Radikal, extaktisch, leidenschaftlich
- Grotesk, unwirklich, übersteigert, verzerrt, abstrakt
Künstler:
- Prophet, der neue, bessere Welt verkündet
- Wegbereiter, Menschenführer
- Bringen ihren Gefühlsüberschwank zum Ausdruck
- Überschätzung der Wirkung der Kunst (konnte die Welt nicht erneuern)
Gattungen:
- Kaum Romane (zu lang, man wollte sich auf das Wesen beschränken)
- Bevorzugt wurde die Lyrik (kurz, prägnant)
Häufig gestellte Fragen
Was ist der geschichtliche Hintergrund des Expressionismus?
Der Expressionismus entstand vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs, des Endes des Kaiserreichs, der Krisenjahre der Weimarer Republik, der Industrialisierung, der Landflucht, der Verstädterung, der Massengesellschaft und des Großstadtlebens. Hinzu kamen Verhaltensunsicherheiten, die Erschütterung des alten Weltbildes, Hoffungslosigkeit, ein Gefühl der Ausweglosigkeit, Melancholie und Weltuntergangsstimmung.
Wie wird der Begriff „Expressionismus“ definiert?
„Expressionismus“ bedeutet wörtlich „Ausdruckskunst“. Er zielt darauf ab, das innere Erleben des Künstlers provozierend nach außen zu tragen und stellt das Gegenteil zum Impressionismus dar, der als oberflächlich angesehen wurde.
Welche Kritik übten die Expressionisten?
Die Expressionisten kritisierten eine fragwürdig gewordene Moral, Wohlstand, der teilweise nur aus Ausbeutung entstanden war, technischen Fortschritt, Positivismus, Kulturverfall, Militarismus, Patriotismus, Krieg und Gewalt, Spießbürgertum, Fremdbestimmung, Autorität und Sinnlosigkeit, die Großstadt, Zivilisation, soziales Elend, Individualitätsverlust, die Verachtung und den Hass der bürgerlichen Welt (Kapitalinteressen, Nützlichkeitsdenken), Materealismus, Egoismus, Engstirnigkeit, bürgerliche Sicherheit und Selbstzufriedenheit sowie die verlogene Fassade der Väter.
Welche Ziele und Forderungen verfolgten die Expressionisten?
Die Expressionisten strebten nach einem Wandel der Gesellschaft durch Veränderung des Individuums, nach Erneuerung und Verwesentlichung des Menschen, Menschlichkeit, Humanität und Menschenwürde. Sie forderten den Ausbruch aus den Konventionen von Kunst und Leben, den Schrei nach Eigentlichkeit, die Beschränkung auf das Wesentliche, Veränderung durch radikalen Umbruch, Pazifismus, die Idee vom „neuen“ Menschen, Wirklichkeitszertrümmerung (zur Erneuerung) durch Sprachzertrümmerung, direkte Verkündung von Gefühlen, Aufrütteln der Gesellschaft und Aufruf zu Veränderungen, die „weltweite“ Bruderschaft, Überwindung beengender Schranken, die Suche nach dem Sinn des Lebens, geistige Wiedergeburt, Menschenliebe und Gemeinschaftssinn sowie innere Erneuerung, Aufbruch und Revolution.
Welche sprachlichen und stilistischen Merkmale kennzeichnen den Expressionismus?
Der Expressionismus zeichnet sich durch Schrei und Ausrufe, Telegrammstil, Verkürzung von Sätzen zur Beschränkung der Sprache auf das Wesentliche, Verbalstil ("Entsubstantivierung der Welt", Schaffung neuer Verben), Allegorie, Personifikation, Synästhesie, Symbole und Farbchiffren, Wortballungen, Worthäufungen, gesteigertes Tempo, starke Rhytmesierung und Dynamisierung, ausdrucksstarke Neologismen, hymnenhafte Sprache, Pathos, häufige Verwendung von Parataxen und kühne Metaphern aus. Allein die Ausdruckskraft ist Kriterium zur Bewertung.
Welche formalen Aspekte sind typisch für den Expressionismus?
Ordnung und Geschlossenheit stehen im Gegensatz zum Inhalt und dienen der Provokation. Es gibt eine Abwesenheit von Grammatik und Normen, Satzfetzen und Reihungen ohne logischen Zusammenhang. Die Form war den Expressionisten zu eng, sie wollten sich von allen alten Regeln lösen.
Welche Themen behandelten die Expressionisten?
Die Themen sind vielfältig und von Autor zu Autor unterschiedlich. Dazu gehören Visionen von Krieg und Weltuntergang, Apokalypse, Sintflut, Gerichtstag, die Großstadt, das Ich, dunkle Bilder von der Zivilisationswüste Stadt, dämonische Untergangsphantasien, sensible Außenseiter, Seelenlosigkeit der Masse, Ästhetik der Hässlichkeit, Weltentwertung, Düsternis, Dunkelheit, Bedrücktheit, Krankheit, die Darstellung des Schrecklichen und Grausamen, Zerfall und Tod, Leid, Schmerz, Liebe, Gott sowie die Umkehrung der Werte und Wertezertrümmerung.
Welche Wirkung strebten die Expressionisten an?
Die Expressionisten strebten eine radikale, extaktische und leidenschaftliche Wirkung an. Ihre Werke sind oft grotesk, unwirklich, übersteigert, verzerrt und abstrakt.
Welche Rolle spielte der Künstler im Expressionismus?
Der Künstler wurde als Prophet, der eine neue, bessere Welt verkündet, als Wegbereiter und Menschenführer gesehen. Er brachte seinen Gefühlsüberschwank zum Ausdruck, überschätzte aber oft die Wirkung der Kunst.
Welche literarischen Gattungen wurden im Expressionismus bevorzugt?
Kaum Romane (zu lang, man wollte sich auf das Wesen beschränken). Bevorzugt wurde die Lyrik (kurz, prägnant). Das Drama wurde zum Bühnenkunstwerk.
- Quote paper
- Diana Koch (Author), 2001, Expressionismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/102293