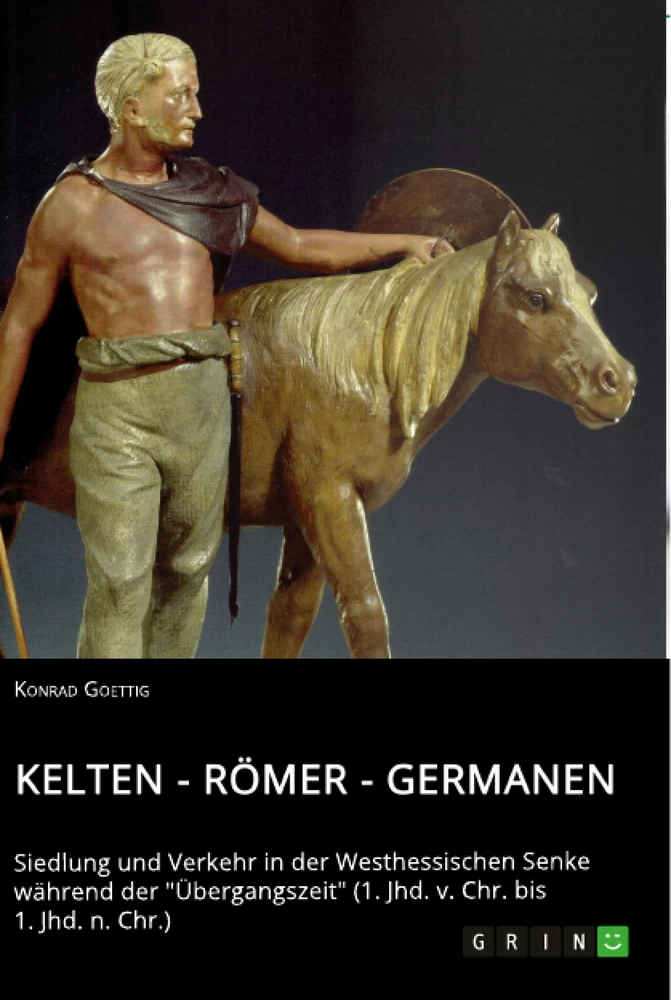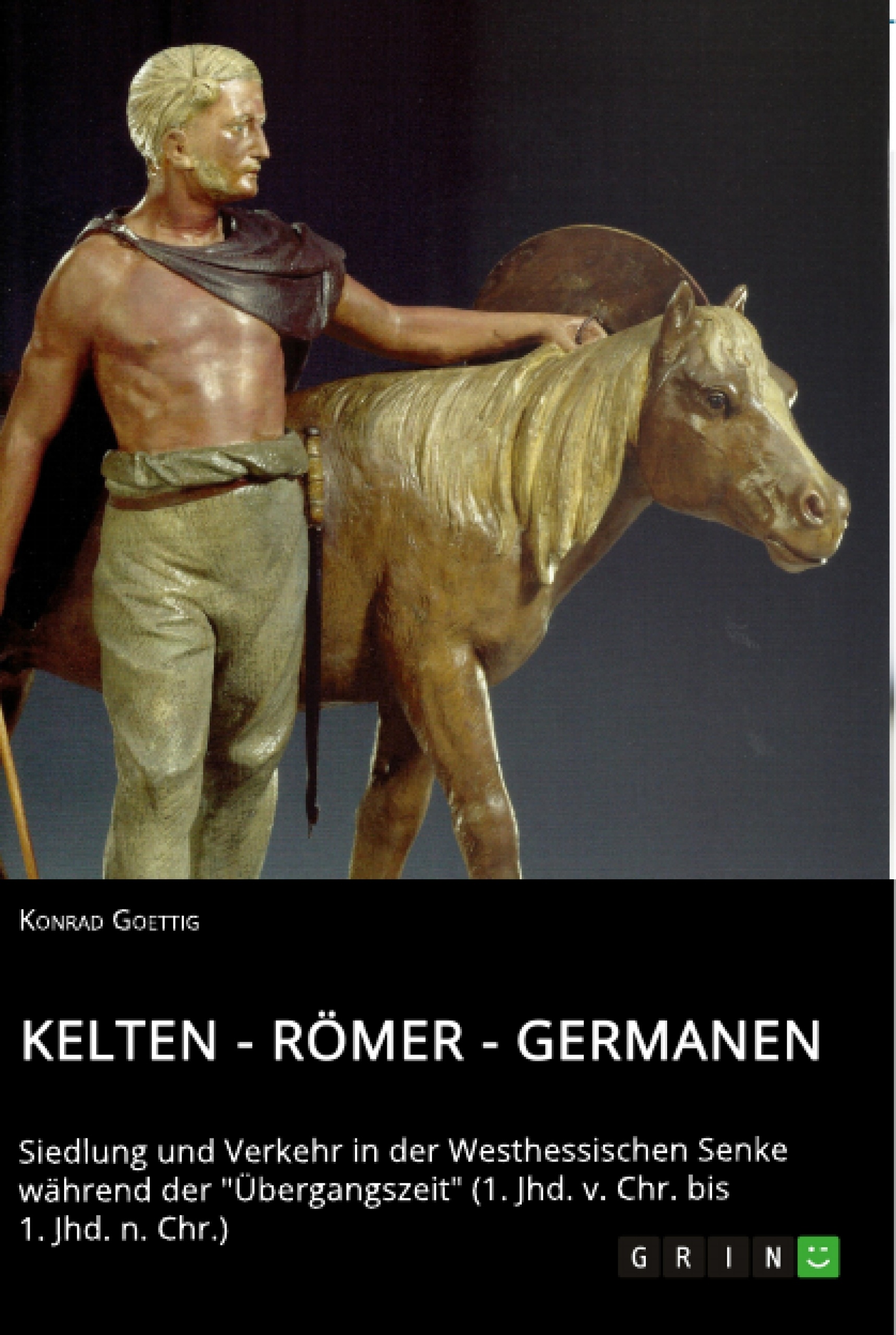Die Jahrzehnte um Christi Geburt sind im heutigen Hessen eine unruhige Zeit. Unterschiedlichste ethnische Gruppen sind in Bewegung. Die Bevölkerung sieht sich einem vermehrten Druck durch aus dem Osten und Nordosten vordringende Sueben ausgesetzt. Diese drängen die indigenen Stämme gegen den Rhein, die ihrerseits versuchen, dem Druck durch das Überschreiten des Rheines auszuweichen. Doch hier stößt man erneut auf Widerstand: Die Römer.
Zahlreiche Migrationsbewegungen im mitteleuropäischen Raum, beginnend mit den Zügen der Kimbern, Teutonen und Ambronen im 2. Jahrhundert v. Chr., den Vorstößen der Przeworsk-Gruppen und den Migrationen der von Caesar „Sueben“ genannten Völkerschaften (etwa seit 75 v. Chr.), drängten die westlich lebenden Gruppen „zwischen Kelten und Germanen“ gegen den Rhein und damit in die römisch beanspruchte Region Gallien.
All diese Bewegungen, Wanderungen und Migrationsaktivitäten sind undenkbar ohne ein entsprechendes Netz von Wegen und Verkehrslinien zu Wasser und zu Lande. In einem dichten und versumpften germanischen Wald sind die beispielhaft aufgeführten Vorstöße und Wanderbewegungen, die besonders auch während der „Übergangszeit“ stattfinden und letztendlich die „Germanisierung“ der indigenen Bevölkerung begründen, nicht zu unternehmen.
Im Bereich der Westhessischen Senke, die nach Norden in die Niederhessische Senke übergeht, können wir von einem bereits lange vor den Römern bestehenden Wegenetz ausgehen. In dieser Arbeit soll diesen Altwegen gefolgt und versucht werden, ein regionales und zum Teil auch überregionales Netz dieser frühen Trassen nachzuzeichnen. Eine Rekonstruktion dieser Wege ist nicht denkbar, ohne den Blick auf die Topographie und das Siedlungsgefüge jener Zeiten, denn Wege verbanden auch immer Zentren menschlichen Wirtschaftens und Lebens miteinander. Die Lage der Siedlungen im Gelände, der Bezug zu benachbarten Siedlungen, die Lage zum Wasser, die Qualität der Böden und der Zugang zu Rohstoffen wie zum Beispiel Salz und Erzen: all das war und ist für den siedelnden und wirtschaftenden Menschen von außerordentlicher Bedeutung.
Inhaltsverzeichnis
- Vorrede
- Der Naturraum: Geologie, Topographie, Klima, Hydrologie und Böden
- Geologie und Topographie
- Klima
- Hydrologie
- Böden
- Siedlungen und Verkehr
- Caesar im Lahntal : 55 v. Chr. und 53 v. Chr.
- Ubier, Sueben, Chatten – Germanen?
- Das Amöneburger Becken
- Altwege
- Die Ohmfurt bei Anzefahr
- Die Keltenbrücke von Kirchhain‐Niederwald
- Niederhessen
- Das Oppidum Manching und die Amöneburg
- Keltische Sklavenjäger ?
- Die Siedlungskammer Fritzlar‐Geismar
- Siedlung und Verkehr in vorgeschichtlichen Talauen
- Die Siedlung am Roten Wasser bei Bürgeln
- Das vor‐ und frühgeschichtliche Landschaftsbild in Mittelhessen
- Römer unterwegs auf den Altwegen?
- Weitere Altwege
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, das regionale und überregionale Wegenetz der Westhessischen Senke während der „Übergangszeit“ (1. Jh. v. Chr. bis 1. Jh. n. Chr.) zu rekonstruieren. Dabei wird der Fokus auf die Interaktion zwischen keltischen, römischen und germanischen Kulturen gelegt. Die Analyse berücksichtigt die Topographie, das Siedlungsgefüge und den materiellen Austausch der damaligen Zeit.
- Entwicklung des Wegenetzes in der Westhessischen Senke
- Interaktion zwischen Kelten, Römern und Germanen
- Einfluss der Topographie und Geologie auf Siedlung und Verkehr
- Materieller Austausch (Salzhandel, Eisenverhüttung)
- Römische Militärstrategien und Logistik
Zusammenfassung der Kapitel
Der Naturraum: Geologie, Topographie, Klima, Hydrologie und Böden: Dieses Kapitel beschreibt die geographischen Gegebenheiten der Westhessischen Senke, einschließlich der Geologie, Topographie, des Klimas, der Hydrologie und der Böden. Es betont, wie diese Faktoren die Siedlungsmuster und die Entwicklung von Verkehrswegen beeinflusst haben, insbesondere die Konzentration von Siedlungen in den Beckenlagen aufgrund der fruchtbaren Böden und des günstigen Klimas. Die geologische Vielfalt wird detailliert dargestellt, mit Betonung der Bedeutung von vulkanischen Aktivitäten und Lössablagerungen für die Bodenqualität.
Siedlungen und Verkehr: Dieses Kapitel legt die Grundlage für die weitere Analyse, indem es die Bedeutung von Wegenetzen für den Austausch von Waren, Personen und Informationen hervorhebt. Es erwähnt die "Bernsteinstraße" als Beispiel für einen frühen Fernweg und beschreibt die Herausforderungen, die ein dicht bewaldeter und sumpfiger Naturraum für die Mobilität darstellte. Die Nutzung von Altwegen durch die Römer und deren spätere Weiterentwicklung im frühen Mittelalter wird ebenfalls behandelt.
Caesar im Lahntal : 55 v. Chr. und 53 v. Chr.: Dieses Kapitel analysiert Caesars Feldzüge im Lahntal, insbesondere die Rheinübergänge von 55 und 53 v. Chr. Es beschreibt die Entdeckung spätlatènezeitlicher Siedlungsreste und römischer Marschlager bei Limburg-Eschhofen, die auf eine bedeutende spätkeltische Siedlung und die caesarischen Feldzüge hindeuten. Die Analyse der gefundenen Schuhnägel erlaubt eine präzise Datierung der römischen Präsenz. Die Interaktion zwischen Caesars Truppen und den Ubiern, sowie Caesars strategische Überlegungen zum Rheinübergang werden detailliert untersucht. Die Rolle des "Schunkauer Weges" als Verbindung zum Dünsberg wird erörtert.
Ubier, Sueben, Chatten – Germanen?: Dieses Kapitel beleuchtet die komplexe ethnische Situation im Raum der Westhessischen Senke, insbesondere die Frage nach der Definition von "Germanen". Es analysiert die Rolle der Ubier, Sueben und Chatten und ihre Beziehungen zu den Römern. Die Geschichte der Ubier wird detailliert nachgezeichnet, von ihrer ursprünglichen Siedlung am Mittelrhein bis zu ihrer Umsiedlung an den Niederrhein. Der Prozess der Ethnogenese der Chatten und ihr Verhältnis zu den Römern wird ebenfalls diskutiert.
Das Amöneburger Becken: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die archäologischen Befunde der Amöneburg und des Amöneburger Beckens, insbesondere das spätkeltische Oppidum. Es beschreibt die Funde, darunter einen möglichen Hufschuhrest und einen Spitzgraben, deren römische Bedeutung jedoch umstritten ist. Die Bedeutung der Amöneburg als zentraler Ort in einer Beckenlandschaft und an wichtigen Verkehrswegen wird hervorgehoben. Die anhaltende Besiedlung der Amöneburg auch in der römischen Kaiserzeit wird im Kontext des Handels mit Bad Nauheim diskutiert.
Altwege: Dieses Kapitel behandelt verschiedene Altwege im Untersuchungsgebiet, insbesondere die „Weinstraße“ und den „Balderscheider Weg“. Es beleuchtet deren Verlauf und mögliche Nutzung durch die römischen Truppen. Die Rolle von Furten und Brücken für den Verkehr wird erläutert, und der "Lahnhöhenweg" als wichtige Verkehrsader wird im Detail beschrieben.
Die Ohmfurt bei Anzefahr: Dieses Kapitel untersucht die Ohmfurt bei Anzefahr und deren Bedeutung für den Verkehr. Die Etymologie des Ortsnamens wird diskutiert, und eine mögliche Verbindung zu römischen Aktivitäten wird erörtert. Die „Hunburg“ als Schutzbauwerk der Furt und weitere archäologische Befunde in der Umgebung werden beschrieben. Die Funktion der Anlage auf dem Nebelsberg als mögliche römische Signalstation wird diskutiert.
Die Keltenbrücke von Kirchhain‐Niederwald: Dieses Kapitel beschreibt den bedeutenden Fund einer latènezeitlichen Brücke in Kirchhain-Niederwald. Die Konstruktion der Brücke wird detailliert erläutert, und ihre Bedeutung für den regionalen und überregionalen Verkehr wird analysiert. Die Zusammenhänge mit den Siedlungsmustern im Amöneburger Becken werden dargestellt.
Niederhessen: Dieses Kapitel behandelt Niederhessen als Kontaktzone zwischen germanischen und keltischen Kulturen in der Eisenzeit. Es analysiert die kulturellen Einflüsse aus dem Süden und die Veränderungen in der Siedlungsstruktur während der Latènezeit und der frühen römischen Kaiserzeit. Die Rolle der Altenburg bei Niedenstein im regionalen und überregionalen Verkehrsnetz wird diskutiert.
Das Oppidum Manching und die Amöneburg: Dieses Kapitel untersucht die Verbindungen zwischen der Amöneburg und dem Oppidum Manching anhand von Münzfunden. Es diskutiert die Bedeutung dieser Verbindungen für den Handelsverkehr und den kulturellen Austausch zwischen Süddeutschland und Nordhessen. Die Funde von Keramik mit süddeutschen Vorbildern werden analysiert.
Keltische Sklavenjäger?: Dieses Kapitel diskutiert die These von Cosack über keltische Raubzüge in den Norden und ihre mögliche Verbindung mit den befestigten Anlagen in Südniedersachsen und Ostfalen. Caesars Bericht über die Organisation solcher Raubzüge wird zitiert.
Die Siedlungskammer Fritzlar‐Geismar: Dieses Kapitel beschreibt die Siedlung Fritzlar-Geismar und ihre Besiedlungsgeschichte von der Hallstattzeit bis ins 12. Jahrhundert n. Chr. Es analysiert die Veränderungen in der Siedlungsstruktur, der Keramik und den Hausformen während der Latènezeit und der frühen römischen Kaiserzeit. Der Einfluss elbgermanischer und rhein-weser-germanischer Kulturen wird diskutiert.
Siedlung und Verkehr in vorgeschichtlichen Talauen: Dieses Kapitel hinterfragt die traditionellen Vorstellungen über die Besiedlung von Talauen in der Frühgeschichte. Es präsentiert neue Erkenntnisse, die zeigen, dass Talniederungen in der Vor- und Frühgeschichte nicht ausschließlich sumpfig und unbesiedelbar waren. Die Siedlung Weimar-Niederweimar wird als Beispiel genannt.
Die Siedlung am Roten Wasser bei Bürgeln: Dieses Kapitel behandelt die Siedlung am Roten Wasser bei Bürgeln und ihre Lage in einem wichtigen Verkehrs- und Siedlungsknotenpunkt. Die Bedeutung der spätlatènezeitlichen Befestigung auf der Eubenhardt wird diskutiert.
Das vor‐ und frühgeschichtliche Landschaftsbild in Mittelhessen: Dieses Kapitel beschreibt das Landschaftsbild in Mittelhessen in der Frühgeschichte, wobei die traditionelle Vorstellung von undurchdringlichen Wäldern und Sümpfen korrigiert wird. Es wird betont, dass eine offene Agrarlandschaft mit landwirtschaftlicher Nutzung und gut ausgebauten Wegen vorherrschte.
Römer unterwegs auf den Altwegen?: Dieses Kapitel analysiert die Nutzung bestehender Wege durch die römischen Truppen und ihre logistischen Herausforderungen. Es diskutiert mögliche Nachschubwege und die Bedeutung schiffbarer Flüsse. Die Rolle von kleinen römischen Posten entlang der Wege wird hervorgehoben.
Weitere Altwege: Dieses Kapitel beschreibt weitere wichtige Altwege im Untersuchungsgebiet, wie den Lindenweg, die Hühnerstraße, die Rennstraße, die Hessenstraße, die Antsavia und den Sälzerweg. Es erläutert deren Verlauf und Bedeutung für den Verkehr und den Handel.
Schlüsselwörter
Westhessische Senke, „Übergangszeit“, Kelten, Römer, Germanen, Ubier, Sueben, Chatten, Siedlung, Verkehr, Altwege, Oppida, Amöneburg, Dünsberg, Eisenverhüttung, Salzhandel, Römische Militärstrategie, Logistik, Ethnogenese, Kulturlandschaft.
Häufig gestellte Fragen zum Thema "Wege und Verkehr in der Westhessischen Senke während der Übergangszeit (1. Jh. v. Chr. – 1. Jh. n. Chr.)"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit rekonstruiert das regionale und überregionale Wegenetz der Westhessischen Senke während der „Übergangszeit“ (1. Jh. v. Chr. bis 1. Jh. n. Chr.). Der Fokus liegt auf der Interaktion zwischen keltischen, römischen und germanischen Kulturen und berücksichtigt Topographie, Siedlungsgefüge und materiellen Austausch.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Wegenetzes, die Interaktion zwischen Kelten, Römern und Germanen, den Einfluss der Topographie und Geologie auf Siedlung und Verkehr, den materiellen Austausch (Salzhandel, Eisenverhüttung) und römische Militärstrategien und Logistik.
Welche geographischen Gegebenheiten werden beschrieben?
Das Kapitel "Der Naturraum" beschreibt die Geologie, Topographie, das Klima, die Hydrologie und die Böden der Westhessischen Senke und deren Einfluss auf Siedlungsmuster und Verkehrswegen. Die Bedeutung von vulkanischen Aktivitäten und Lössablagerungen wird hervorgehoben.
Welche Rolle spielten die Römer in der Westhessischen Senke?
Die Arbeit analysiert Caesars Feldzüge im Lahntal (55 und 53 v. Chr.), die Interaktion zwischen römischen Truppen und den einheimischen Bevölkerungsgruppen (Ubier, Sueben, Chatten), die Nutzung bestehender Altwege durch die römischen Truppen und deren logistische Herausforderungen sowie die Rolle kleiner römischer Posten entlang der Wege.
Welche keltischen und germanischen Gruppen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die komplexe ethnische Situation mit Fokus auf Ubier, Sueben und Chatten und deren Beziehungen zu den Römern. Die Ethnogenese der Chatten und die Geschichte der Ubier werden detailliert behandelt. Die Frage nach der Definition von "Germanen" wird diskutiert.
Welche wichtigen archäologischen Fundstellen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht unter anderem die Amöneburg (spätkeltisches Oppidum), die Siedlung am Roten Wasser bei Bürgeln, die Keltenbrücke von Kirchhain-Niederwald, die Siedlungskammer Fritzlar-Geismar und die Ohmfurt bei Anzefahr. Die Verbindungen zwischen der Amöneburg und dem Oppidum Manching werden anhand von Münzfunden analysiert.
Welche Altwege werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Altwege wie die „Weinstraße“, den „Balderscheider Weg“, den „Lahnhöhenweg“, den Lindenweg, die Hühnerstraße, die Rennstraße, die Hessenstraße, die Antsavia und den Sälzerweg und deren Bedeutung für den Verkehr und den Handel.
Wie wird das Landschaftsbild der Frühgeschichte dargestellt?
Die Arbeit korrigiert die traditionelle Vorstellung von undurchdringlichen Wäldern und Sümpfen in Mittelhessen und betont eine offene Agrarlandschaft mit landwirtschaftlicher Nutzung und gut ausgebauten Wegen.
Welche Kapitelzusammenfassungen bietet die Arbeit?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen für alle Kapitel, die die zentralen Ergebnisse und Argumentationslinien jedes Kapitels prägnant zusammenfassen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Westhessische Senke, „Übergangszeit“, Kelten, Römer, Germanen, Ubier, Sueben, Chatten, Siedlung, Verkehr, Altwege, Oppida, Amöneburg, Dünsberg, Eisenverhüttung, Salzhandel, Römische Militärstrategie, Logistik, Ethnogenese, Kulturlandschaft.
- Quote paper
- Konrad Goettig (Author), 2021, Kelten - Römer - Germanen. Siedlung und Verkehr in der Westhessischen Senke während der "Übergangszeit" (1. Jhd. v. Chr. bis 1. Jhd. n. Chr.), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1021785