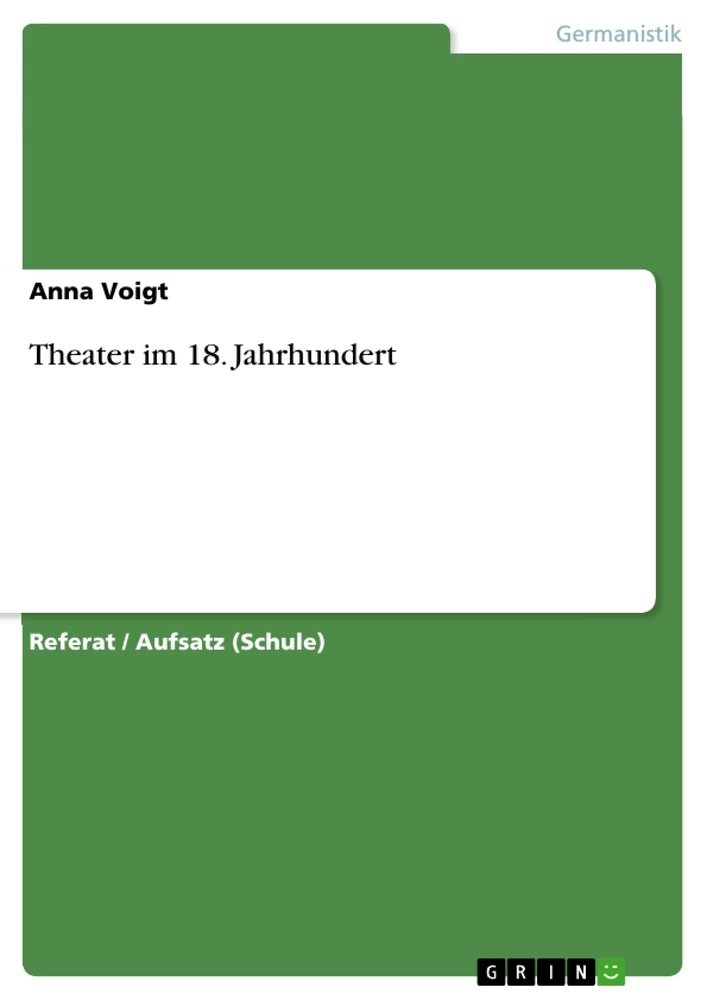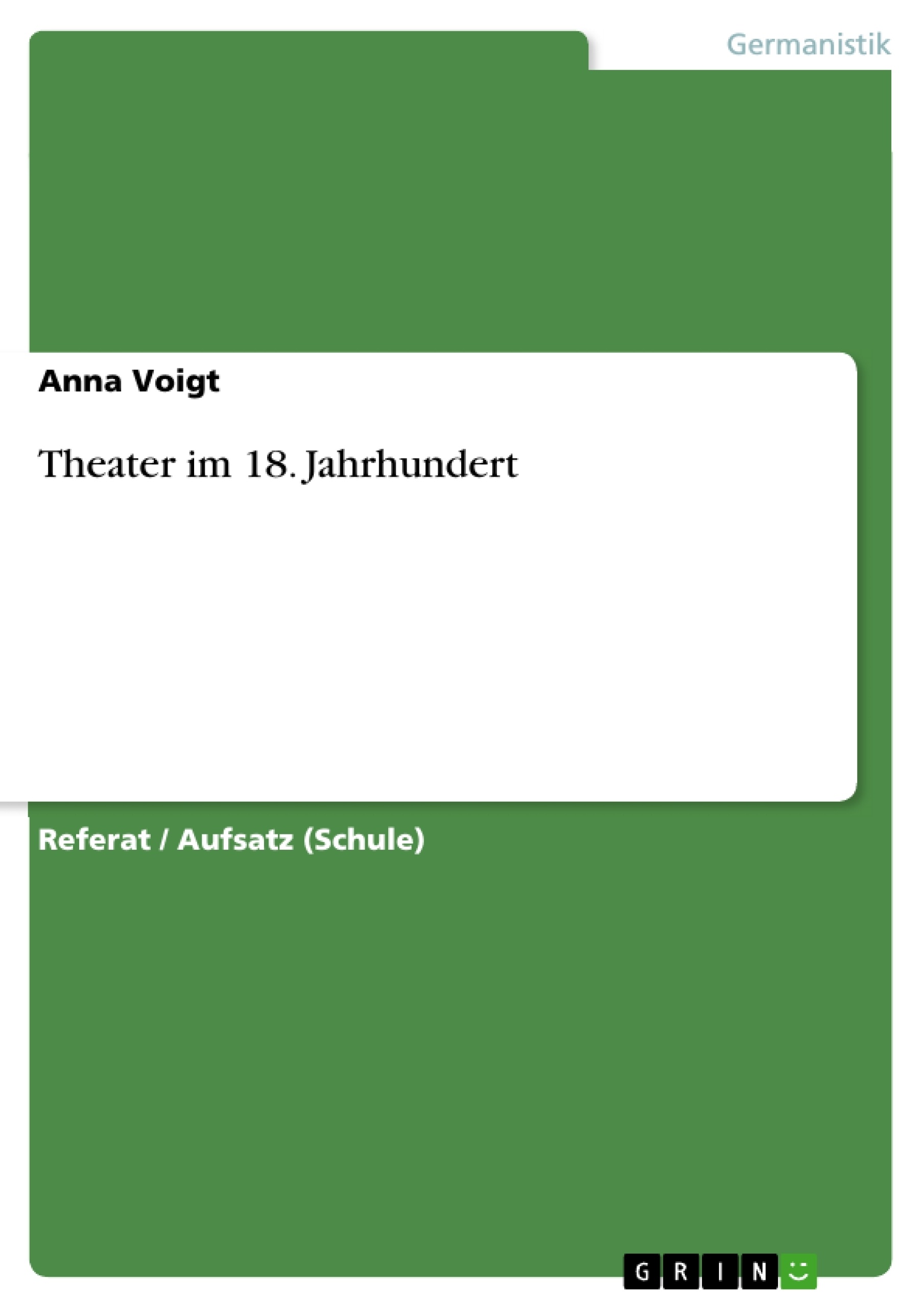Eine Epoche des Umbruchs, in der das Theater zum Spiegel der Gesellschaft wurde: Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des deutschen Theaters im 18. Jahrhundert, einer Zeit des Wandels und der Kontraste, in der höfische Pracht auf wandernde Bühnen traf und bürgerliche Ideale nach Ausdruck suchten. Diese Epoche, geprägt von den Reformbestrebungen Gottscheds und Lessings, erlebte eine tiefgreifende Transformation, die das Theater von einer bloßen Volksbelustigung zu einem Instrument der Aufklärung und moralischen Erziehung formte. Entdecken Sie die unterschiedlichen Theaterformen – vom exklusiven Hoftheater, in dem französische Dramen und italienische Opern dominierten und soziale Hierarchien zementiert wurden, über das improvisationsreiche Wandertheater für das einfache Volk, bis hin zum aufkeimenden Nationaltheater, das eine Bühne für alle Stände schaffen und nationale Identität stiften wollte. Erfahren Sie, wie Gottsched versuchte, dem deutschen Theater durch die Orientierung an französischen Klassikern Ordnung und Regelmäßigkeit zu verleihen, während Lessing mit seiner Hinwendung zu Shakespeare und einem freieren Versmaß für mehr Natürlichkeit und emotionalen Tiefgang kämpfte. Verfolgen Sie, wie die Ideale der Aufklärung, die Kritik an Standesunterschieden und die Forderung nach moralischer Erneuerung ihren Weg auf die Bühne fanden und das Theater zu einem Ort der gesellschaftlichen Auseinandersetzung machten. Lassen Sie sich entführen in eine Zeit, in der das Theater nicht nur Unterhaltung bot, sondern auch zur Schule der praktischen Weisheit und zum Schlüssel zur menschlichen Seele wurde, ein Spiegelbild der aufkommenden bürgerlichen Welt und ihrer Werte.
Das Theater im 18.Jahrhundert
Verschiedene Arten des Theaters im 18. Jahrhunderts:
- Hoftheater: Beim Hoftheater wurde das französische Drama und die italienische Oper bevorzugt, das deutsche Drama war jedoch nicht gefragt . Die Ränge und Sitze wurden nach Stellung am Hofe vergeben. Wer nicht zum Hofstaat oder Adel gehörte war nicht zu einer Theateraufführung zugelassen. Getragen wurde das Theater in der Regel nur von französischen oder italienischen Schauspielern. Wer zur höfischen Schaupielergesellschaft gehörte hatte eine finanzielle Sicherung, deswegen versuchten viele niedrigere Schauspieler hoffähig zu werden, doch schafften es die wenigsten, da sie meistens die französische Manier und Sprache nicht beherrschten.
- Wandertheater: Das Wandertheater war für die untere Schicht, den "Pöbel" bestimmt. Die Wanderbühnen arbeiteten mit weniger Aufwand und spielten in Bretterbuden, Wirtshäusern oder unter freiem Himmel. Der Staat kontrollierte das Wandertheater nur hinsichtlich auf den Gewerbeschein, hatte man diesen nicht, konnte man nicht auftreten. Der Aufenthalt richtete sich nach den Einnahmen, gingen diese zurück, zog es weiter. Das Theater bestand aus ca. 15- 20 Mitgliedern, da nicht jeder Schauspieler jede Rolle beherrschte.
- Nationaltheater: In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts beginnt mit der Gründung der ersten Nationaltheater (in Hamburg, Wien und Mannheim) ein neuer Abschnitt in der Geschichte des Theaters. Das Ziel eines solchen deutschen Nationaltheaters war nicht nur die Schaffung einer Alternative zu den Hoftheatern, sondern gerade die Aufhebung der sozialen Aufspaltung in Hof- und Wandertheater in einem nationalen Spielplan und in einer Bühne für alles Stände.
DEUTSCHE THEATERGESCHICHTE IM 18. JAHRHUNDERT:
Die Theaterreformer Johann Christian Gottsched (1700 - 66) und Gotthold Ephraim Lessing (1729- 81)
Ausgangslage:
- Das Theater in Deutschland existierte fast nur in Form von Wandertruppen, wurde von der ´guten Gesellschaft´ nicht besucht und war hauptsächlich Volksbelustigung auf den Märkten.
- Die Schauspieler führten eine gesellschaftlich verachtete Existenz und waren materiell verarmt.
- Stegreifspiel: lediglich der Szenenablauf wird festgelegt, der Text aber "extemporiert",
- standardisierte Typen: Der Liebhaber, der Lüstling, die schlaue Tochter, der alte Vater und
- vor allem der Harlekin, Hanswurst, Kasperl ... bildete die Hauptattraktion für das Publikum, besonders durch seine drastische Komik und Pöbelhaftigkeit; er fügte sich der Handlung nicht ein, sondern unterbrach durch seine spontanen Auftritte
Der Leipziger Literaturprofessor J.C.Gottsched versuchte deswegen, der "Deutschen Dichtkunst" wieder Ordnung und Regel zu geben und das Theater zum Sprachrohr aufgeklärten Gedankenguts zu machen. Dazu aber mußte Theater wieder literarisch hochstehend gemacht werden, um das bessere Publikum (gemeint waren Fürsten und der höhere Adel) anziehen zu können. Der
Grundgedanke: Um das Publikum zu belehren, müssen Wahrheiten in Fabeln (Handlungen) gekleidet werden, die sowohl logisch als auch wahrscheinlich waren zum Zwecke von
Fürstenerziehung: In der TRAGÖDIE soll dem Herrscher aufgeklärte Staatskunst nahegebracht werden durch die Darstellung wichtiger Staatsbegebenheiten. Das Beispiel des tragischen Falles der Großen bewirkt bei den Herrschenden Betroffenheit und Einsicht in sittlich richtiges Handeln, bei der Masse des Publikums Zufriedenheit mit der eigenen Lage trotz aller Mühsal und Bedrängnis. Die Tragödie stelle folglich nur die Welt der Großen dar ("Ständeklausel"), nur in dieser Welt kann die "tragische Fallhöhe" erreicht werden.
Allgemeine Sittenkritik (KOMÖDIE): Ihr dienen die Satire und das Lustspiel, in denen die Fehler und Schwächen von einfachen Leuten (wie Du und Ich) dargestellt und dem Lachen preisgegeben werden.
Aus dieser Zielsetzung folgende praktische Maßnahmen:
- Schaffung von Stücken nach französischem Vorbild, Übersetzung von Corneille, Racine, Voltaire und anderen französischen `Klassikern´.
- Regelgerechte Stü>Festgelegte Texte, kein Extemporieren, verbindlicher Vers (z.B.Alexandriner)
- Orientierung an den - dem Aristoteles zugeschriebenen - drei Einheiten von Ort, Zeit und Handlung (um nicht die Vorstellungskraft der Menschen hinauszuwirken)
- Beachtung der Ständeklausel und Verbannung des Harlekin von der Bühne
- Förderung von engagierten und anspruchsvollen Wandergruppen
G.E.L essing (1729-81): Erziehung des Menschengeschlechts. Lessings Vorschläge:
- Weg von den Franzosen, hin zu Shakespeare (Lessing bewunderte Shakespeare)
- weg vom steifen Alexandriner, hin zum freieren Blankvers;
- Säuberung der Darstellungskunst von übertreibenen, standardisierten Gesten, hin zum echten Gefühlsausdruck
- Schiller sieht in der Bühne mehr als in jeder anderen öffentlichen Anstalt des Staates, eine Schule der praktischen Weisheit, ein Wegweiser durch das bürgerliche Leben, einen unfehlbaren Schlüssel zu den geheimsten Zugängen der menschlichen Seele.
Häufig gestellte Fragen zu "Das Theater im 18. Jahrhundert"
Was waren die verschiedenen Arten von Theatern im 18. Jahrhundert?
Im 18. Jahrhundert gab es hauptsächlich drei Arten von Theatern: Hoftheater, Wandertheater und Nationaltheater. Hoftheater waren für den Adel und den Hofstaat reserviert und bevorzugten französische Dramen und italienische Opern. Wandertheater waren für das gemeine Volk bestimmt und traten in einfachen Bretterbuden oder im Freien auf. Nationaltheater entstanden in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts und versuchten, eine Bühne für alle Stände zu schaffen.
Was war die Rolle des Hoftheaters?
Das Hoftheater diente der Unterhaltung des Adels und des Hofstaates. Es bevorzugte französische Dramen und italienische Opern und ignorierte oft deutsche Dramen. Die Sitzplätze wurden nach der Stellung am Hofe vergeben, und das Theater wurde hauptsächlich von französischen oder italienischen Schauspielern getragen.
Was war das Wandertheater?
Das Wandertheater war für die untere Schicht der Bevölkerung bestimmt. Es trat in einfachen Umgebungen auf und war stark von den Einnahmen abhängig. Der Staat kontrollierte es hauptsächlich durch die Gewerbescheine.
Was war das Ziel der Nationaltheater?
Die Nationaltheater zielten darauf ab, eine Alternative zu den Hoftheatern zu schaffen und die soziale Aufspaltung zwischen Hof- und Wandertheatern aufzuheben. Sie wollten eine Bühne für alle Stände mit einem nationalen Spielplan bieten.
Wer waren die wichtigsten Theaterreformer im 18. Jahrhundert?
Die wichtigsten Theaterreformer im 18. Jahrhundert waren Johann Christian Gottsched (1700-1766) und Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781).
Wie war die Ausgangslage des Theaters in Deutschland vor den Reformen?
Vor den Reformen existierte das Theater in Deutschland fast nur in Form von Wandertruppen. Es wurde von der "guten Gesellschaft" gemieden und war hauptsächlich eine Volksbelustigung auf Märkten. Die Schauspieler führten eine gesellschaftlich verachtete Existenz und waren materiell verarmt. Es wurde hauptsächlich Stegreiftheater mit standardisierten Typen und dem Harlekin als Hauptattraktion gespielt.
Was waren Gottscheds Ziele für das deutsche Theater?
Gottsched wollte der "Deutschen Dichtkunst" wieder Ordnung und Regel geben und das Theater zum Sprachrohr aufgeklärten Gedankenguts machen. Er wollte das Theater literarisch hochstehend machen, um das bessere Publikum (Fürsten und den höheren Adel) anzuziehen.
Welche praktischen Maßnahmen ergriff Gottsched zur Theaterreform?
Gottsched schuf Stücke nach französischem Vorbild, übersetzte französische Klassiker, führte regelgerechte Stücke mit festgelegten Texten und Versen ein, orientierte sich an den drei Einheiten von Ort, Zeit und Handlung, beachtete die Ständeklausel und verbannte den Harlekin von der Bühne. Er förderte engagierte und anspruchsvolle Wandergruppen.
Was waren Lessings Vorschläge zur Theaterreform?
Lessing plädierte für eine Abwendung von den Franzosen und eine Hinwendung zu Shakespeare. Er forderte den Übergang vom steifen Alexandriner zum freieren Blankvers, die Säuberung der Darstellungskunst von übertreibenden Gesten und den echten Gefühlsausdruck.
- Arbeit zitieren
- Anna Voigt (Autor:in), 2001, Theater im 18. Jahrhundert, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/101842