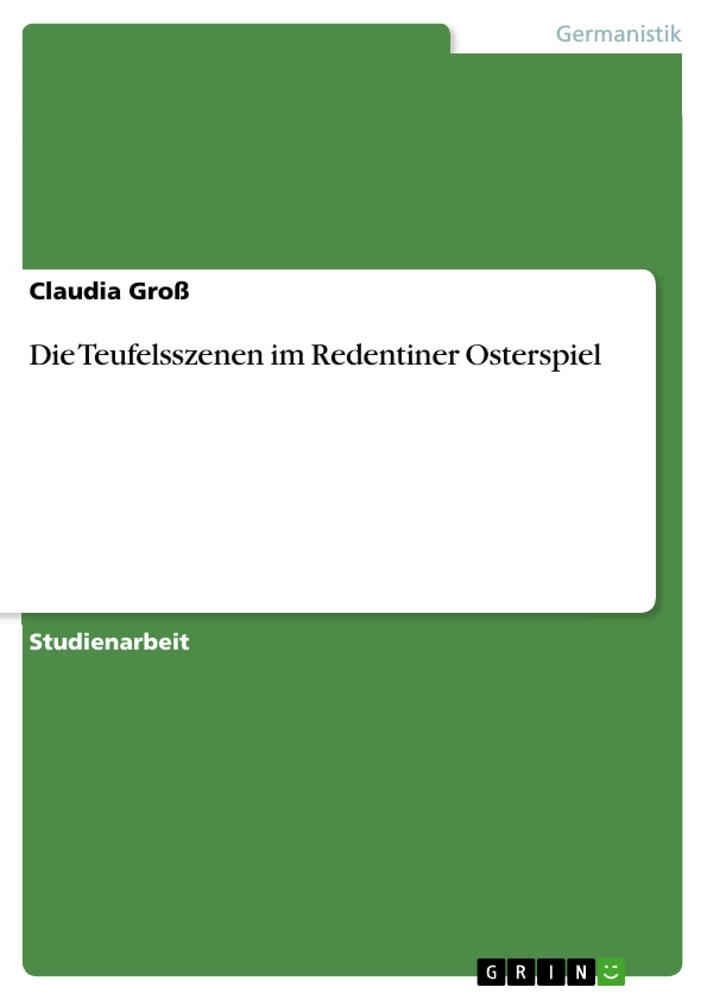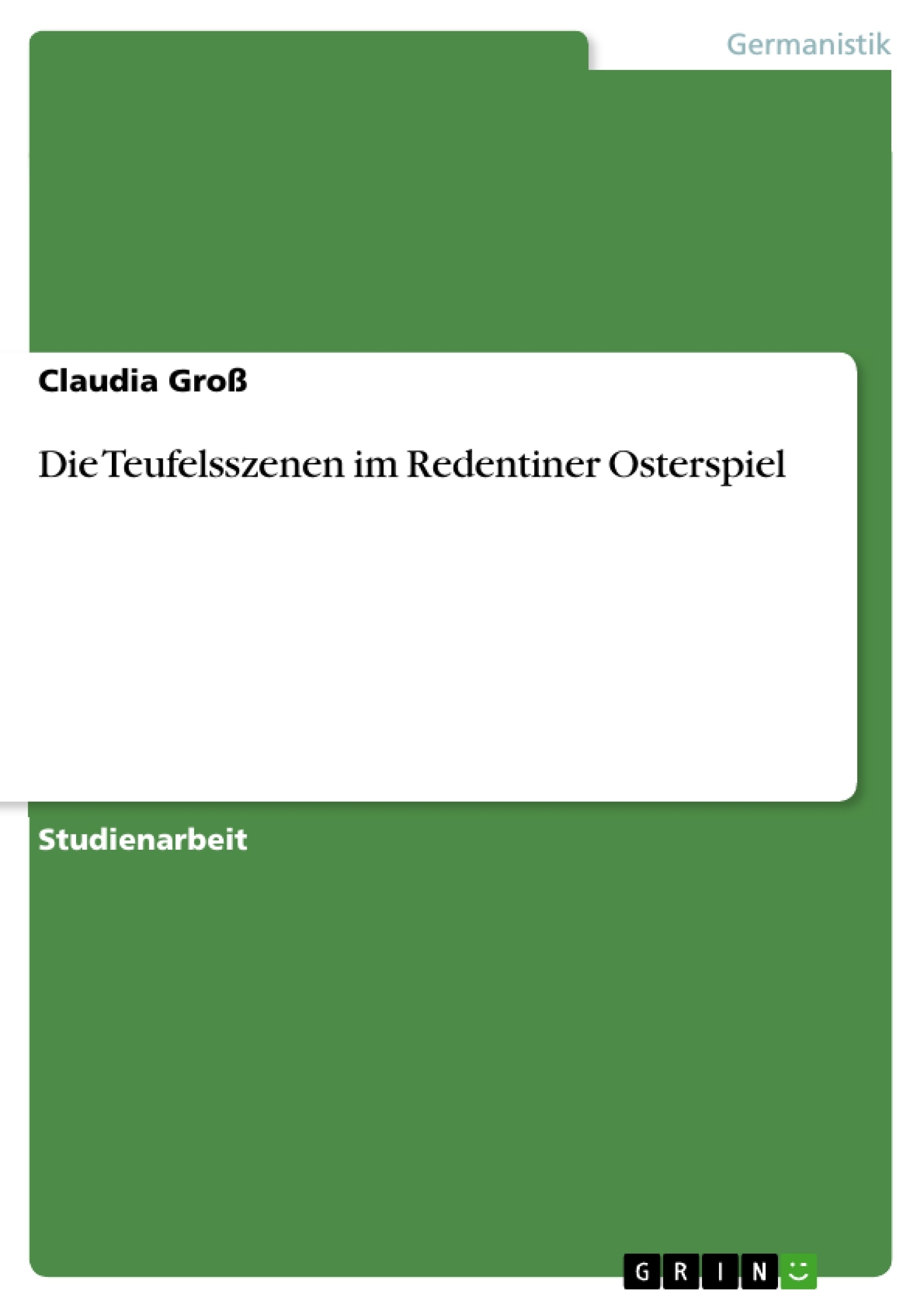Stellen Sie sich eine Welt vor, in der das Göttliche auf das Groteske trifft, in der die Hölle nicht nur ein Ort der Verdammnis, sondern auch eine Bühne für unerwartete Komödien ist. Das Redentiner Osterspiel, ein faszinierendes mittelalterliches Drama, entführt Sie in genau diese Welt. Tauchen Sie ein in ein einzigartiges Werk der mittelniederdeutschen Literatur, das mit seinen ausgiebigen Teufelsszenen die christliche Ostergeschichte auf ebenso subversive wie erhellende Weise neu interpretiert. Diese tiefgründige Analyse beleuchtet die Rolle und Darstellung der Teufel im Spiel, enthüllt ihre Gebrechen und ihren grotesken Humor, und untersucht, wie sie als Spiegelbild menschlicher Schwächen und als Kontrast zur göttlichen Vollkommenheit dienen. Entdecken Sie, wie Luzifer und seine Untertanen, zwischen Ungehorsam und Selbstmitleid gefangen, um Seelen ringen und dabei die Grenzen ihrer eigenen Machtlosigkeit erkennen müssen. Erforschen Sie die vielfältigen Facetten der mittelalterlichen Frömmigkeit, die sich in den liturgischen Anklängen und volkssprachlichen Dialogen des Spiels offenbaren. Analysiert werden die Sprache, die theologischen Hintergründe und die Inszenierung der Teufelsszenen, um ein umfassendes Bild der Intentionen des Autors und der Botschaft des Stückes zu vermitteln. Welche Rolle spielen die lateinischen Gesänge? Wie wird das Gottes- und Teufelsbild im Text gezeichnet? Was wollte der Autor dem mittelalterlichen Publikum vermitteln? Dieses Buch bietet nicht nur eine detaillierte Interpretation des Redentiner Osterspiels, sondern wirft auch ein Schlaglicht auf die mittelalterliche Theologie, die Vorstellungswelt und die dramatischen Konventionen der Zeit. Es ist eine Einladung, die dunklen und doch überraschend komischen Abgründe der mittelalterlichen Seele zu erkunden und die zeitlose Frage nach Gut und Böse, Macht und Ohnmacht, Glauben und Zweifel neu zu stellen. Eine Reise in eine Epoche, in der das Theater zum Spiegel der Gesellschaft und zum Schauplatz des Kampfes zwischen Himmel und Hölle wurde, in dem selbst der Teufel eine überraschend menschliche Seite zeigt. Eine unentbehrliche Lektüre für alle, die sich für mittelalterliche Literatur, Theatergeschichte und die vielschichtige Darstellung des Bösen interessieren.
Inhalt
1. Einleitung
2. Die besondere Stellung der Teufelsszenen im Redentiner Osterspiel
3. Die Höllenfahrtsszene
a. Geschichte
b. Aufbau
c. Funktion der Patriarchen
d. Der Auftritt der Teufel
e. Liturgische Quellen im Text
f. Das Machtverhältnis zwischen Jesus und den Teufeln
4. Das Teufelsspiel
a. Geschichte
b. Sprache
c. Die Unvollkommenheit der Teufel
5. Schluss
6. Literatur
1. Einleitung
Das Redentiner Osterspiel ist eines der wenigen uns überlieferten mittelniederdeutschen Osterspiele. Sein Text befindet sich in Form einer Handschrift aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts - wahrscheinlich eine Abschrift des Originals1 - in der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe, wo man ihn unter der Signatur - Nr. K.369 einsehen kann.
Verfasser und Entstehungsort des Spieles können nicht eindeutig festgestellt werden. Man nimmt aber an, dass der Verfasser ein Geistlicher gewesen ist, da er des Lateinischen mächtig, schreibgewandt und in der geistlichen Literatur bewandert war. Ein Vermerk am Ende des Osterspieles - „ finitus est iste rycmus anno domini M ° ccc ° Lxiiij sequenti die elizabethae in redentyn “ - informiert darüber, dass die Handschrift in Redentin, einem nahe bei Wismar gelegenen Klostergutshof, der seit 1192 dem Zisterzienserkloster Doberan angehörte, entstanden ist. Es wird vermutet, dass sich diese Aussage nur auf den Entstehungsort der Abschrift und nicht des Originaltextes bezieht.2 Der Vermerk nennt außerdem ein Datum: den 20.11.14643. Auch hier ist unklar, ob das Datum den Abschluss des Originaltextes oder der Abschrift meint. Man nimmt aber an, dass der zeitliche Abstand zwischen Entstehung des Originals und der Abschrift nicht allzu weit auseinander lagen.4
Verschiedentlich wird diskutiert, ob ein anderes uns überliefertes Osterspiel als Vorlage für das Redentiner Osterspiel gelten kann. Einig ist man sich, dass es dem Innsbrucker Osterspiel sehr nahe steht. Dass dieses jedoch unmittelbare Vorlage war, kann nicht nachgewiesen werden.5
Handlung
Das Redentiner Osterspiel beginnt damit, dass die Juden und Pilatus Christus’ Auferstehung verhindern wollen. Zu diesem Zwecke schicken sie vier Ritter als Wachen zu seinem Grab, die ihren Auftrag jedoch nicht sehr ernst nehmen. Sie überlassen die Wache einem Nachtwächter und legen sich schlafen. Währenddessen nähern sich übers Meer Engel. Es kommt zu Christi Auferstehung. Dieser beschließt daraufhin, in die Hölle hinabzufahren, um die dort gefangenen Seelen zu befreien und mit sich in den Himmel zu nehmen. Während die Seelen in der Hölle freudig Christi Ankunft erwarten, werden die Teufel immer besorgter. Sie beschließen, die Hölle abzuschließen und zu bewachen. Aber die Teufel kommen gegen Gottes Plan nicht an. Christus zerbricht die Tore der Hölle, legt den Oberteufel Luzifer in Ketten und führt die Seelen in den Himmel. Am nächsten Morgen weckt der Nachtwächter die Ritter, die zu ihrer Schande ihren Auftraggebern berichten müssen, dass sie Jesus’ Auferstehung verschlafen haben.
In der zweiten Hälfte des Osterspieles beklagen die Teufel ihr Leid, alle Seelen aus der Hölle verloren zu haben. Sie begeben sich auf neuen Seelenfang. Erst nach einem zweiten Anlauf gelingt es ihnen, Beute zu machen. Die Unterteufel führen Vertreter verschiedener Berufsstände, einen Räuber und einen Geistlichen vor Luzifer. Die Herbeigebrachten gestehen wie vor einem Gericht ihre Sünden und erhalten von Luzifer dafür eine Strafe. Nur der Geistliche lässt sich in der Hölle trotz seiner Fehlverhalten nicht halten. Er erinnert die Teufel an Christi Höllenfahrt und warnt, dass er wiederkommen könnte. Das Stück endet schließlich mit einer selbstmitleidigen Rede Luzifers, dass der Priester recht haben könnte. Er lässt sich von seinen Teufeln in die Hölle schleppen, um seine neuen Seelen zu bewachen.
Die Handlung des Redentiner Osterspiels ist von einem Prolog und einem Epilog umrahmt. Im Prolog künden zwei Engel das Stück an, das für jeden, ob arm oder reich, gedacht sei und zeigen soll, wie man frei von Sünde werden könne. Den Epilog spricht ein Schlusssprecher, der die Zuschauer zum Preis Gottes und zu einer Lebensführung nach seinen Gesetzen ermahnt, damit einem das Böse nicht schaden könne.
Intention der Arbeit
Die Teufelsszenen machen einen großen und wichtigen Teil des Redentiner Osterspiels aus. Ziel der Arbeit soll sein, einen genaueren Blick auf diese Szenen zu werfen und von ihnen aus die Intention des Verfassers mit dem Osterspiel herauszukristallisieren. Was für ein Gottes- und Teufelsbild wird im Text gezeichnet? Was für eine Sprache verwendet der Autor? Was möchte er dem mittelalterlichen Zuschauer mit seiner eigenwilligen Gestaltung des Osterspieles vermitteln? Im Weiteren soll auf diese Fragen eingegangen werden.
2. Die besondere Stellung der Teufelsszenen im Redentiner Osterspiel
Das Redentiner Osterspiel weist in Hinsicht auf seine Szenengestaltung einige Besonderheiten auf, vergleicht man es mit anderen mittelalterlichen Osterspielen. Während es die „visitatio sepulchri“6, die „ Keim- und Kernszene der gesamten christlichen Osterdramatik, (...) die sonst in keinem anderen deutschen Osterspiel fehlt “ 7 , auslässt, nehmen die Teufelsszenen im Vergleich zu anderen Osterspielen außergewöhnlich viel Platz ein. Mit 1249 Versen machen sie fast zwei Drittel des gesamten Textes aus.8
Betrachtet man den Aufbau des Osterspieles, so gliedert sich dieses in zwei Hauptteile.
Die Szenen des ersten Teils sind inhaltlich um das Geschehen der Auferstehung herum angesiedelt. Er beginnt und endet mit der weltlichen Personengruppe der Juden, Pilatus und seiner Ritter. Zwei Turmwächterszenen9 bilden den Übergang von weltlichem zu überweltlichem und von überweltlichem zu weltlichem Geschehen. Die Auferstehung selber und Christus’ anschließende Höllenfahrt bilden das Zentrum des ersten Teiles des Osterspieles. An dieser zentralen Stelle treten die Teufel zum ersten Mal im Stück auf.
Der zweite Teil des Redentiner Osterspiel ist fast so lang wie der erste und wird ausschließlich von den Teufeln bestritten. Zeitlich ist sein Geschehen nach der Auferstehung und Höllenfahrt angesiedelt und führt bis in die Gegenwart des Verfassers des Osterspieles hinein.
Im Weiteren sollen die beiden Szenen, in denen die Teufel im Redentiner Osterspiel vorkommen, ausführlicher untersucht werden.
3. Die Höllenfahrtsszene
3.a. Geschichte
Höllenfahrtsdarstellungen können im mittelalterlichen geistlichen Drama seit dem 13. Jahrhundert nachgewiesen werden: Die Szene ist bereits im Murier Schauspiel, dem ältesten der uns erhaltenen deutschsprachigen Osterspiele, vom Anfang des 13. Jahrhunderts enthalten.10
Als Quellengrundlage für die Szene gelten verschiedene Bibelpassagen sowie der zweite Teil des lateinischen Nikodemus - Evangeliums. Er ist mit „Descensus Christi ad Inferos“ übertitelt und stellt die Höllenfahrtsszene sehr dramatisch dar.11 Maximilian J. Rudwin beschreibt ausführlich, auf welche Bibelstellen die verschiedenen Handlungselemente der Szene zurückzuführen sind. Die Idee, dass Christus nach seiner Kreuzigung in die Hölle hinabgefahren sei, könne vor allem „ aus Apg. 2,31 (vgl. Ps. 16, 8-10), Eph. 4, 8-10 (vgl. Ps. 67, 19), R ö m. 10, 7 und besonders 1. Petri 3, 19-20 herausinterpretiert “ werden.12 Erich Krüger führt als weitere biblische Quellen Matth. XII, 40, sowie die Offenbarung Joh. 1, 18 an.13
Zur dramatischen Szene als Teil des Osterspieles entwickelte sich die Höllenfahrtsszene aus einem Prozessionsritus heraus, der bis ins 9. Jahrhundert nachgewiesen werden kann.14 Rudwin beschreibt als Kern der Höllenfahrtsszene im mittelalterlichen Osterdrama den Kirchenhymnus „Tollite portas“, der aus den Schlussworten des 24. Psalm besteht. Es handelt sich hier um einen Wechselgesang, bei dem der Teufel um Einlass in die Hölle durch Christus aufgefordert wird und der während des Gottesdienstes am Palmsonntag gesungen wurde. Dieser Hymnus entwickelte sich dramatisch weiter: In Augsburg hat es 1487 das Ritual gegeben, die Höllenfahrtsszene in der Osternacht an der Kirchentür nachzuspielen. Hierbei übernahm ein Diakon in der Kirche die Rolle des Teufels und ein anderer die des Christus vor dem Tor. Beide sangen dann den Wechselgesang, bei dem Christus den Teufel auffordert, die Tore der Hölle zu öffnen. Die ursprünglich liturgische Darstellung hat sich so immer mehr aus dem Gottesdienst herausgelöst und ist schließlich als rein dramatische Szene Teil des Osterspieles geworden.15
3.b. Aufbau
Die Höllenfahrtsszene des Redentiner Osterspiels kann in vier Teile eingeteilt werden, die jeweils von anderen Personengruppen bestritten werden. Im ersten Teil (V. 261- 37216 ) sprechen verschiedene bedeutende Figuren des Alten und Neuen Testaments, die sogenannten „Erzväter“, „Patriarchen“ oder auch Propheten in der Vorhölle über Christus’ Nahen. Im zweiten Abschnitt der Höllenfahrtsszene (V. 373-486) sind ausschließlich die Teufel die Handlungsträger. Die dritte Sequenz (V. 487-682) vereint die beiden ersten Personengruppen von Patriarchen und Teufeln mit Christus. Es ist die Kernszene der Höllenfahrt. Der vierte Teil schließlich (V. 683-754) zeigt wieder nur die Patriarchen, diesmal nicht in der Vorhölle, sondern vor dem Himmel.
3.c. Die Funktion der Patriarchen
Im ersten Teil ahnen die Propheten und Erzväter in der Vorhölle, dass Christus sich der Unterwelt nähert, um sie zu retten. Abel bemerkt als erster ein helles Licht, welches er als ein Zeichen Gottes ansieht. Er hofft, dass das Licht für das Ende seines Leides steht (V. 261-271).17 Auch die darauffolgenden Sprecher, Adam und Jesajas, bestätigen Abels Vermutungen über das Licht als Zeichen Gottes. Simeon, der vierte Sprecher, berichtet von seinen Begegnungen mit Jesus. Seine freudigen Erinnerungen bereiten darauf vor, das Christus erscheinen wird, dessen Größe gepriesen und gelobt wird. Johannes der Täufer, der fünfte Sprecher, tritt, da er gerade erst gestorben ist und somit direkt von der Erde kommt, als Bote Jesus’ auf und kündigt dessen Ankunft an. Seth, der letzte der Runde, bestätigt schließlich, dass das Licht die Antwort auf eine Prophezeiung sei, in der ihm die Erlösung der Toten vorhergesagt worden ist.
Die der Bibel entlehnten Figuren dieser Szene haben meiner Meinung nach die Funktion von Zeugen für das Geschehen Christi Höllenfahrt. Sie stellen Bezüge zur christlichen Bibelgeschichte her und verweisen darauf, dass die Erlösung der Seelen aus der Hölle von Anfang an in der Heilsgeschichte vorgesehen war. Ihr Auftreten und ihre Reden sollten bei den Zuschauern wahrscheinlich den Glauben an und die Gewissheit über die eigene Erlösung festigen. Außerdem ist die Personengruppe der Patriarchen der in der folgenden Szene auftretenden Teufelsgruppe gegenübergestellt. Während die Patriarchen ein positives Beispiel für fromme Gottesgläubigkeit darstellen, werden die Teufel als Gottes Widersacher, also als ihr Gegenteil gezeigt.
Die Szene ist von mehreren lateinischen Passagen und Gesängen durchzogen. Hier wird die bereits erwähnte Nähe zum liturgischen Ursprung des Osterspieles deutlich.18
3.d. Der Auftritt der Teufel
Der zweite Teil der Höllenfahrtsszene beginnt mit einem Dialog zwischen Luzifer, dem Oberteufel der Hölle, und Satan, seinem Lieblingsunterteufel. In dem Gespräch geht es darum, ob Jesus wie ein Mensch sterblich ist. Satan, der ihm einen Speer ins Herz getrieben hat, behauptet, dass er dabei Todesschmerz erlitten habe und außerdem den Tod sehr fürchte. Er glaubt deshalb, dass Jesus wie alle Menschen als Toter in die Hölle kommen wird. Luzifer hingegen erkennt, dass Jesus nicht sterben kann, weil er Gott ist. Er begründet Jesus’ Göttlichkeit mit den Wundern, die er vollbracht hat. Vor allem, weil Jesus Lazarus vom Tode erweckt hat, ist sich Luzifer sicher, dass er stärker als der Tod ist. Er fragt Satan außerdem, wo denn Jesus’ Seele geblieben sei: „ Leve Satan, heft he den gehst uppegheven, wor is denne de zele bleven? “ (V. 427f) Die Seele ist Satan aber entwischt.
Das Streitgespräch zwischen Luzifer und Satan soll mögliche Zweifel an Jesus’ Wahrhaftigkeit bei den Zuschauern aus dem Weg räumen. Um dies zu erreichen, werden Pro- und Contra - Argumente für Jesus Unsterblichkeit einander antithetisch gegenübergestellt und abgewogen. Schließlich sprechen mehr Argumente dafür, dass Jesus wirklich Gott ist und von den Teufeln gefürchtet werden muss. Der „vernünftige“ Schluss soll die Wahrhaftigkeit des Gottessohnes hervorheben und deutet die Unterlegenheit der Teufel Gott gegenüber an.
Die Szene hat ihr Vorbild im „Descensus Christi ad Inferos“. Brigitta Schottmann weist darauf hin, dass dort statt Luzifer und Satan Inferus, der Herrscher des Totenreiches, und Satan als Protagonisten auftraten. Inferus stand hier aber nicht für das Böse, sondern nur für den Tod. Satan trat allein als Widersacher Gottes auf. In den mittelalterlichen Spielen wurde zwischen Tod und Teufel nicht mehr getrennt und Inferus durch Luzifer ersetzt.19
Das Gespräch zwischen Luzifer und Satan sagt viel über die Beziehung der beiden zueinander aus. Bereits in seiner ersten Rede (V. 373-376) hebt Luzifer Satan aus der gesamten Teufelsschar, die er herbeiruft, hervor, indem er ihn einzeln nennt und mit „ Satana, leve gheselle “ (V. 376) anspricht. Diese liebevolle Anrede erscheint ungewöhnlich sanft für einen Teufel. Sie verleiht ihm einen menschlichen Zug. Außerdem zeigt sie, dass Satan wahrscheinlich Luzifers Vertrauter ist, der dann im Weiteren auch als Sprecher der Unterteufel auftritt: „ (...) hir bun ik unde myene gheselle (...) “ (V. 377). Trotz der hervorragenden Stellung Satans scheint er kein sonderlich fähiger Teufel zu sein. Bereits in dieser ersten Szene täuscht er sich ja mit seiner Ansicht, Jesus würde bald als Opfer zu ihnen in die Hölle kommen. Dass ihm dessen Seele entwischt ist, versucht er mit der Ausrede zu vertuschen, dass Luzifer ihn gerade in dem Moment gerufen habe, als er die Seele fangen wollte (V. 429-431). Satan erscheint hier etwas dumm. Später, in der zweiten Teufelszene wird er noch mal durch eine Dummheit auffallen, als er den Geistlichen in die Hölle schleppt.
3.e. Liturgische Quellen im Text
Der dritte Teil, die eigentliche Höllenfahrt Christi, zeigt besondere Auffälligkeiten. Er ist von so vielen lateinischen Gesängen durchzogen, wie sonst keine Szene des Osterspiels. Diese lateinischen Antiphone zeigen den liturgischen Ursprung der Höllenfahrtsszene und lassen sich meist auf biblische Quellen oder andere religiöse Schriften zurückführen. Beispielhaft soll an der ersten Hälfte der Szene die Dichte der lateinischen Gesänge und ihre Quellen dargestellt werden:
Als Jesus sich der Hölle nähert, kündigt David ihn dort an. In seiner Begrüßungsrede zitiert er in V. 494 lateinisch einen Auszug der Psalmen 107, 3 und 56, 9.20 Daraufhin singt er die Antiphon „ O clavis David ... “, in der er Christus als den Schlüssel des Hauses Israel und der Unterwelt bezeichnet, und die laut Brigitta Schottmann auf Offb. Joh. 1, 18 und 3, 7 zurückgeht.21 Wahrscheinlich stellvertretend für die gesamte Menschheit begrüßen als nächstes auch Adam und Eva Christus, ihren Schöpfer und Erlöser (V. 499-506, 507-512). Die Rede der beiden umrahmt das von allen Seelen gesungene sogenannte „Canticum triumphale“ („ Advenisti ... “, V. 506a), das auf den Augustinus zugeschriebenen 160. Sermo De Pascha II22 beruht und in Beziehung zum Nikodemus - Evangelium stehen soll.23 Der nächste Abschnitt ist stark schematisch gegliedert. Dreimal singen die Engel den lateinischen Kirchenhymnus „ Tollite portas ... “ (V. 512b, 526a, 532a)24 und kündigen Jesus, den „ K ö nig der Herrlichkeit “ , an. Diese Antiphon geht auf Psalm 23, 7-10 zurück:
„ attollite portas principes vestras, et elevamini portae aeternales, et introibit rex gloria. Quis est iste rex gloriae? Dominus forstis et potens, Dominus potens in poelio.
Attolite portas ... (wie oben) Quis ... (wie oben) Dominus virtutum ipse est rex gloriae. “ 25
Der Psalm wird im Redentiner Osterspiel auf mehrere Sprecher aufgeteilt: Dreimal singen die Engel den ersten Satz, auf den hin die Teufel fragen, wer dieser „ K ö nig der Herrlichkeit “ sei: „ Quis est iste ... “ (V. 514, 530, 539). Hierauf antwortet jeweils einer der Engel, wenn auch in Mittelniederdeutsch. Wie bereits erwähnt wurde, gilt die hier ausgestaltete Antiphon als Ursprung der Höllenfahrtszene. Man kann den Übergang vom Psalm zur dramatischen Szene gut erkennen.
Als nächstes spricht Jesus selbst und singt die bis heute noch sehr bekannte Antiphon „ Ego sum alpha et o …“ ( „ Ich bin das Alpha und das Omega …“ ), die auf verschiedene Stellen der Offenbarung Johannes (vor allem Offb. Joh. 1, 8) zurück- zuführen ist.26
Es zeigt sich also, dass der Text des Osterspiels zum Teil durch die liturgische Vorlage bereits festgelegt war. Der Verfasser des Redentiner Osterspiels greift diese Textstellen in seiner eigenen Dichtung oft auf und gibt sie in einer mittelniederdeutschen Übersetzung frei wieder.27 Hierin lässt sich die didaktische Absicht vermuten, die dem Publikum zwar wahrscheinlich bekannten, aber nicht unbedingt verstandenen lateinischen Gesänge verstehbar zu machen.
Der darüber hinaus im weitesten Sinne selbst erdachte Text des Verfassers betont besondere Aspekte des Geschehens.
3.f. Das Machtverhältnis zwischen Jesus und den Teufeln
Jesus Christus wird in der Höllenfahrtsszene als absoluter Herrscher dargestellt. Dies zeigt sich in den Lob- und Preisreden der Patriarchen in der Vorhölle und seiner Engel, sowie in seinem eigenen Verhalten. In der bereits angesprochenen Textstelle um das „ Tollite portas ... “ herum wird Christus als „ konink der ere “ (V. 514) bezeichnet. Die Teufel hingegen werden nur als Fürsten angesprochen: „ vorste der dusternisse “ (V. 513). Es wird deutlich, dass die Teufel in der Hierarchie unter Christus stehen, obwohl auch ihr Reich hierarchisch gegliedert ist: Während Luzifer der Oberteufel mit der Befehlsgewalt ist, sind die anderen Teufel seine Untergebenen. Hansjürgen Linke schreibt über die Hölle im Redentiner Osterspiel, dass sie eine Negation der göttlichen Welt sei. Sie übernehme deren Struktur, um dieselbe zu verhöhnen, könne ihr aber keine eigene Schöpfung entgegenstellen.28
Jesus’ Macht wird besonders deutlich, als er die Tore der Hölle zerbricht. Er befiehlt den Toren, sich zu öffnen, und verleiht diesem Befehl Nachdruck, indem er seine Größe durch seine Selbstbeschreibung als Anfang und Ende unterstreicht (V. 559-564). Sein Befehl richtet sich an die Tore selbst und nicht an Luzifer: „ Ik bede dy, grindel an dessser helle / dat du openst di vul snelle! “ (V. 555f) und „ Springet up, gy helleschen dore! “ (V. 571). Auf Satans Einwand, dass Jesus’ Vorgehen der Hölle gegenüber unhöfisch sei - „ Dat is unhoveliken dan, / Dat uns schal alzo na gan. “ (V. 567f) -, antwortet Jesus nur mit einer Beschimpfung Satans: „ Swich, Satana, drake! / Swich, du vordumede snake! “ (V. 569f). Jesus ignoriert die Teufel. Anstatt sie als Fürsten der Hölle anzuerkennen, bezeichnet er sie als deren Knechte: „ Wech rat van hynnen, / Alle der helle ghesynnen! “ (V. 581f). Schließlich legt er Luzifer sogar in Ketten.
Offensichtlich sind sich die Teufel ihrer Unterlegenheit Jesus gegenüber zunächst nicht bewusst. Durch die dreifache Frage, wer der „ konink der ere “ überhaupt sei, wird deutlich, dass sie ihn nicht als „König“ anerkannt haben. Luzifer wirft Jesus vor, er würde sich aufführen, als würde ihm die Welt gehören: „ We is desse weldenere, de dus komet varende here, oft dat al de werlde syn egene sy? “ (V. 515-517). Da es sich aber tatsächlich um Gott, den Weltherrscher handelt, wirkt diese Bemerkung Luzifers dumm und komisch. Schließlich müssen sich die Teufel aber dem Gottessohn beugen. Bis auf ein paar Sprüche haben sie ihm nichts entgegenzustellen. Sie können die Seelen in der Hölle nicht halten. Luzifer muss die Schmach ertragen, vor den Augen seiner Untergebenen gefesselt zu werden. Dem Angriff auf die Autorität des Höllenfürsten wird noch eins drauf gesetzt, als der Unterteufel Puk Luzifer beschimpft und ihn direkt fragt, wieso er sich diese Schmach hat gefallen lassen:
„ Here meyster Lucifer, / Gy sint en rechter droghener! / Gy stan alzo en vordorven gok! Me mach ju by den voten henghen in den rok. / Gy mogen wol gan myt den beschoren schapen / Unde leren van nyes melk lapen. / Manschen ju is de sucht mede, / Dat gy ju nycht scheppen vrede? / Ik hebbe io dicke hort unde is ok recht, / Dat de elrene here bedwynget den ekenen knecht. “ (V. 647-656)
Puk greift hier wieder das herrschaftliche Motiv auf, indem er Luzifer vorhält, dass sich dieser Christus gegenüber nicht wie ein Herr, sondern eher wie ein Knecht verhalten habe.
Hansjürgen Linke geht auf die gegensätzliche Darstellung der beiden Figuren „Christus“ und „Luzifer“ im Redentiner Osterspiel ausführlich ein. Während Christus mit viel Würde, Majestät und Souveränität auftrete und Vollkommenheit ausstrahle, sei Luzifer eine eher wechselhafte und in sich zerrissene Person: „ ... so wechselt Luzifer unversehens von Kameraderie zu Despotie, von Brutalit ä t zu Sentimentalit ä t, schl ä gt in ihm Hohn in Wehleidigkeit, Ironie in Selbstmitleid und Schadenfreude in Verzweiflung um. “ 29 Diese Zerrissenheit der Figur „Luzifer“ zeigt sich meiner Meinung nach auch in seinem Herrscher-Sein. Zwar ist er Fürst und Oberster der Hölle, Christus gegenüber aber völlig unterlegen und dadurch für seine Untergebenen auch zweifelhaft. Im Weiteren wird dieser Aspekt seiner Person noch näher untersucht werden.30
4. Das Teufelsspiel
4.a. Geschichte
Der zweite Teil des Osterspiels spielt ausschließlich in der Hölle und ist die längste Teufelsszene des ganzen Stückes. Sie hat keine unmittelbare Vorlage in biblischen Texten, sondern ist zum Auferstehungsspiel dazugedichtet worden. Siegfried Grosse meint, dass die „Höllenfahrtsszene“ als Vorgeschichte dieser Szene gelten könne, aus der sie sich herausentwickelt habe.31 Lothar Humburg vermutet außerdem, dass für die Gestaltung dieser Szene verschiedene Aussagen über Teufel im Neuen Testament Grundlage gewesen seien.32 Laut Humburg findet sich das Teufelsspiel außer im Redentiner Osterspiel in verschiedenen Variationen im IV. Erlauer Spiel, im Innsbrucker -, Wiener - und Rheinischen Osterspiel. Es ist also nicht davon auszugehen, dass das Teufelsspiel eine Neuerfindung des Verfassers des Redentiner Osterspiels ist. Vielmehr kann vermutet werden, dass die Teufelsszenen vielleicht besonders gut beim Publikum angekommen sind und deshalb immer weiter ausgebaut wurden. Humburg unterstreicht, dass das Teufelsspiel im Redentiner Osterspiel in die Gesamtkomposition einbezogen ist und dass es zahlreiche inhaltliche Verknüpfungen zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil des Osterspieles gibt.33
4.b. Sprache
Während die Höllenfahrtsszene noch stark von lateinischen Gesängen durchzogen war, zeichnet sich das Teufelsspiel dadurch aus, dass es - abgesehen von den lateinischen Regieanweisungen - rein mittelniederdeutsch, also volkssprachlich geschrieben ist. Immer wieder wird das sprachliche Können des Verfassers des Redentiner Osterspiels betont, das sich in der Verwendung zahlreicher bildhafter Ausdrücke und Vergleiche sowie verschiedener Sprichwörter im Text zeigt. Erich Krüger hat eine ausführliche Aufzählung der Sprichwörter und Redensarten im Redentiner Osterspiel aufgestellt, auf die hier aber nicht detailliert eingegangen werden kann.34
Die Sprache der Teufelsszene ist sehr realistisch und direkt. Den Teufeln werden oft drastische und derbe Ausdrücke in den Mund gelegt, deren belustigende und abstoßende Wirkung beim Publikum bewusst beabsichtigt ist. Zum Beispiel bedankt sich Luzifer bei Belyal für den herbeigebrachten, sündigen Fischverkäufer mit den Worten „ Me schal dyne munt mit swyne parlen belegghen! “ (V. 1573). Der rüde Umgangston zwischen den Teufeln - „ Wane, dat di lede sche! / Dat dy de bodel an ene galghen tee! / Ik segghe dy by mynen waren: / Du scholt eneme olden wyve in den er ’ s varen, / Dar scholtu liden groten stank, / So wert di de tid lank. “ (V. 1668-1673) -, der auf der anderen Seite mit einer übertriebenen Freundlichkeit kontrastiert wird - die Teufel sprechen sich z. B. untereinander häufig mit „ leve here “ oder „ leve knecht “ an -, deutet auf eine gewisse Unausgeglichenheit der Teufel hin und löst Befremden aus. Das sich in der Sprache andeutende ambivalente Verhalten der Teufel zeigt sie als launische, vor allem durch ihr Gefühl geleitete Wesen.
4.c. Die Unvollkommenheit der Teufel
Wie bereits in der Höllenfahrtsszene weist die Figur Luzifers im Teufelsspiel ein Spannungsverhältnis auf, indem er auf der einen Seite zwar als Herrscher dargestellt wird, auf der anderen Seite aber als solcher immer wieder versagt. Am Ende des letzten Teufelauftrittes war Luzifer, wie bereits besprochen, von seinem Untergebenen Puk als „Herr“ in Frage gestellt worden.35 Zu Beginn dieser Szene versucht er nun, seine Autorität als solcher wieder herzustellen, indem er seine Unterteufel auf ihre Position als Knechte hinweist, deren Aufgabe vor allem das Dienen sei.:
„ Ik danke ju, myne leven knechte, / Dat gy my denet al na rechte. / Wat ik jy hete, des en late gy nicht, / Des weset alle van my bericht. / Jk hebbe ok wol van ju vornamen, / Gy stat alle tid na myneme vramen. / Dat schal ju ruwen nummer mere, / Wente ik bun jo juwe rechte here. We my kan to danke denen, / Den will ik alzo wol belenen / Unde will em alle bede untwyden, / He schal my danken to allen tyden. “ (V. 1044-1055)
Luzifer belehrt seine Teufel, dass er ihr „rechtmäßige Herr“ sei. Außerdem betont er das vorbildliche Dienen seiner Knechte, die immer in seinem Sinne handeln würden. Da Puk ihn zuletzt beschimpft hat, erscheint dieses Lob fragwürdig. Es entsteht der Eindruck, dass Luzifer ebenso wenig ein guter Herr ist, wie seine Unterteufel gute Diener sind. Dieser Eindruck wird bestätigt, als Luzifer die Teufel das erste Mal vom Seelenfang zurückruft und ihm zunächst keiner gehorcht (V. 1154-1165). Beim zweiten Ruf erscheinen die Teufel zwar, jedoch unverrichteter Dinge ohne Seelen. Sie müssen von Luzifer erst zurechtgewiesen und belehrt werden (V. 1248-1313), damit sie auf den dritten Ruf hin endlich sündige Seelen herbeibringen können (V. 1314-1337).
Der Ungehorsam der Unterteufel zeigt sich auch an anderen kleinen Szenen. Der Teufel Licketappe z.B. verhält sich Luzifer gegenüber mit unverschämten Reden so widerspenstig, dass dieser ihn stark zurechtweisen muss: „ De wasche gheyt dik alzo en kaf. / Bi meynen waren, ik nemet dik af! / Du bust myner alto velich gheworden. / Ik bringhe di noch an enen anderen orden / Unde segghe di dat bi myner ere: / Der rede vorgheve ik di nicht mere! “ (V. 1606-1611). Funkeldune, ein anderer Teufel, zeichnet sich durch besonders große Faulheit aus. Anstatt Luzifers Auftrag, Seelen zu fangen, nachzukommen, legt er sich zum Schlafen nieder und hofft, dass ihm so ein Sünder zulaufen würde. Natürlich kommt er mit leeren Händen in die Hölle zurück (V. 1654- 1691). Die Namen beider ungehorsamen Teufel, deuten auf eine starke Neigung zum Alkohol hin.36 So wie diese beiden, sind alle Teufel im Redentiner Osterspiel sehr individualisiert mit besonderen Charakterzügen dargestellt. Der Verfasser des Osterspiels hat ihnen sehr menschliche Züge verliehen, indem sie bestimmte Bedürfnisse und Schwächen zeigen. Oft hinterlassen die Teufel einen lächerlichen, dummen und fast bemitleidenswerten Eindruck beim Publikum.
Das anfängliche Scheitern der Teufel beim Seelenfang ist nicht nur auf ihren Ungehorsam und ihr Unvermögen zurückzuführen. Satan begründet es vor Luzifer folgendermaßen: „ Dat kumpt dar alto male van, / Dat de lude al ghemeyne, / Beyde grot unde kleyne / Alle sik nu hebben berichtet / Unde myt gade sik vorplichtet / Unde vorsmat unse lere. “ (V. 1221-1226). Hier wird angedeutet, dass Jesus’ Auferstehung und Höllenfahrt von solcher Wirkung war, dass die Menschen offenbar noch eine ganze Zeit danach im Sinne Gottes gelebt haben. Die Teufel müssen also noch weiterhin unter der Macht Gottes leiden - sein Einfluss auf die Menschen ist größer als der ihre. Wieder wird die Unterlegenheit der Teufel Gott gegenüber deutlich. Erst als die Pest ausbricht, können sie ein paar Seelen auf ihre Seite bringen. Im Text wird dies Ereignis nicht direkt genannt, sondern nur umschrieben, als Luzifer seine Teufel nach Lübeck schickt:
„ Gi scholen alle na myneme rade / Ju to Lubeke maken drade, / Dar wilt de lude sere sterven, / So moghe gy vele zelen vorwerven, (...) “ (V. 1295-1299).37
Obwohl die Teufel nun ein paar Seelen herbeibringen können, endet das Spiel doch nicht gut für sie. Dies wird deutlich, als Satan das große Missgeschick unterläuft, einen Geistlichen in die Hölle zu schleppen. Obwohl es sich offensichtlich um einen Geistlichen mit Verfehlungen handelt - „ (...) De heft so menneghe mette vorslapen. / Wan id missetid mochte wesen, / So scholde he syne tyde noch lesen. / So makede he langhe maltid: / Dar mede wart he ik der vesper quid. / He drinkt ok wol na syneme ghevughe, / To nachtsanktyd is he in deme kroghe. (...) “ (V. 1765-1771) -, scheint er stärker als Luzifer und sein Geselle Satan zusammen zu sein. Als Luzifer ihn bittet, zurückzutreten, weil er ihn nicht riechen könne (V. 1790f), weist der Pfaffe die Teufel auf ihre Unterlegenheit hin: „ Hore, wat is dat ghesecht? / Steystu doch hir unde ok dyn Knecht. / Myt my en is hir nument mere. / Noch en gruwet myk nicht alto sere. / Wultu my an de helle han, / So mot ik dy noch negher gan. “ (V. 1792-1797). Luzifer gesteht seine eigene Unterlegenheit auch sofort ein: „ De pape heft my de har vorsenghet! / Dat deyt he men myt slichten worden: / Queme he denne an unsen orden, / So drofte wi nicht langhe sumen, / Wy mosten em de helle rumen. “ (V. 1799-1803). Schließlich verflucht der Priester Satan sogar und schickt ihn für immer ins Moor (V. 1860-1863). Bezeichnend sind die letzten Worte des Geistlichen, mit denen er Luzifer droht, dass Jesus noch einmal in die Hölle kommen und sie diesmal ganz zerstören könnte:
„ Lucifer, lat di sulven noghen, / Ik will dik anders ok wat to voghen: / Kumpt Jhesus noch ens vor dyne doren, / He schal de gantzen helle vorstoren. / Enes dinghes bun ik wis, / Dat got jo weldegher wen de duvel is. “ (V. 1908-1913). Hier sagt er es noch mal ganz deutlich, dass Gott den Teufeln überlegen ist. Die Teufel werden also durch den Vertreter Gottes in ihre Schranken gewiesen.38 Schließlich muss Luzifer dann auch nach einer selbstmitleidigen abschließenden Klagerede von seinen Unterteufeln weggetragen werden, da er aufgrund seiner Fesselung nicht mehr selbst laufen kann. Die physische Schwäche symbolisiert seine auch sonst durch Gott eingeschränkte Handlungsfähigkeit.
Die Unterlegenheit der Teufel Gott gegenüber wird durch Luzifer selbst begründet, indem er seine Herkunft und die seiner Genossen benennt. Das Bestreben der Teufel, so viele Menschen wie möglich in die Hölle schleppen zu wollen, rühre laut ihm nämlich daher, dass sie es diesen nicht gönnen würden, im Himmel zu leben, weil die Teufel von dort vertrieben wurden: „ Dat se nicht an deme rike leven, / Dar wy worden ut vordreven. “ (V. 1102f). In seiner abschließenden Rede beklagt Luzifer seinen Hochmut und sein Verfehlen, wodurch er in den Höllengrund gestürzt worden ist: „ Dor mynen homut bun ik verlaren. / ... / We schal sik aver my vorbarmen, / Dat ik hebbe ovele dan? / .../ Homud is en ambegyn aller sunde, / Homud heft us duvele senket in afgrunde. / De mynsche is to den vrouden karen, / De we duvele hebben vorlaren. “ (V. 1930-1951). Das „ Motiv des Neides der gefallenen und auf ewig verdammten Engel “ wird bereits von Lothar Humburg benannt.39 Die Annahme, dass es sich bei Teufeln um gefallene Engel handelt, geht auf Petrus (zweiter Brief) 2, 4 zurück, wo es heißt: „ Gott hat auch die Engel, die ges ü ndigt haben, nicht verschont, sondern sie in finsteren H ö hlen der Unterwelt versto ß en und h ä lt sie dort eingeschlossen bis zum Gericht. “ 40 Allein dass der Teufel ein von Gott aufgrund seines Verfehlens Herabgesetzter ist, zeigt, dass er Jesus kein gleichwertiger Gegner sein kann. Während man heute in der Vorstellung oft davon ausgeht, dass der Teufel das personifizierte Böse ist, dem Gott als das Gute gegenübersteht, war der Teufel im Mittelalter niemals Teil einer solchen dualistischen Vorstellung. Da die Vernichtung der Teufel beim Weltende vorgesehen war, galten sie als überwindbare Macht. Es wurde davon ausgegangen, dass der gläubige Mensch dem Teufel Widerstand leisten könne. Dies tut der Priester im Redentiner Osterspiel ja auch.
5. Schluß
In den vorherigen Kapiteln wurde von verschiedenen Perspektiven her die Darstellung der Teufel im Redentiner Osterspiel untersucht. Wiederholt hat sich gezeigt, dass diese Gott gegenüber als unterlegen gezeigt wurden. Die Teufel verfügen über keine vergleichbare, göttliche Macht, sondern weisen eher menschliche Züge - Emotionen - und somit auch Schwäche auf. Sie sind verletzbar, reizbar und launisch, sie haben Vorlieben und Abneigungen. Die Teufel verfolgen die Menschen nur aus der Motivation des Neides heraus, da sie selber aus dem Himmel verstoßen wurden und ihn den Menschen nicht gönnen.
Die Gestaltung des Redentiner Osterspiels über liturgische Vorlagen hinaus zeigt sich vor allem im Teufelsspiel als sehr gelungen. Die individualisierte Darstellung der Teufel unterstützt den Ausdruck der Hauptintention des Stückes, die im Epilog vom Conclusor zusammengefasst wird. Dieser fordert die Zuschauer nämlich auf, sich in Gott zu freuen und nach seinem Gebote zu leben. Jeder solle auf seine Sünden achten und schauen, dass er in Gottes Reich gelange. Gott habe die Menschen gerächt und die Hölle der Teufel zerbrochen, damit sie die Möglichkeit haben, mit ihm ewig im Paradies zu leben (V. 1987-2025). Der Sieg Christi über die Teufel soll also beim Publikum die Hoffnung auf das Paradies stärken. Indem der Teufel überwindbar dargestellt wird, soll der Zuschauer motiviert werden, sich ihm zu widersetzen. Die Gestaltung der Teufelsfiguren unterstützt diesen moralischen Appell des Stückes.
In diesem Sinne kann man Lothar Humburg zustimmen, der da schreibt: „ Das Redentiner Osterspiel z ä hlt zu den bemerkenswertesten, eigenwilligsten und gelungensten geistlichen Schauspielen, die das sp ä te Mittelalter hervorgebracht hat. “ 41
6. Literatur
Primärliteratur:
Das Redentiner Osterspiel. Mittelniederdeutsch und Neuhochdeutsch. Übersetzt und kommentiert von Brigitta Schottmann. Stuttgart 1975.
Die Handschrift des Redentiner Osterspiels im Lichtdruck mit einigen Beiträgen zu seiner Geschichte und Literatur. Herausgegeben von Albert Freybe. Schwerin 1892.
Sekundärliteratur:
Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, Bd. VII. Zweite, völlig neu bearbeitete Auflage. Unter Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter herausgegeben von Kurt Ruh. Berlin / New York 1989. Sp. 1065-1069.
Die Heilige Schrift. Einheitsübersetzung. Verlag Katholisches Bibelwerk. Stuttgart 1981.
Grosse, Siegfried
Zur Ständekritik in den geistlichen Spielen des späten Mittelalters. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 86 (1967). (Sonderheft). S. 63-79.
Humburg, Lothar
Die Stellung des Redentiner Osterspiels in der Tradition des mittelalterlichen geistlichen Schauspiels. Neumünster 1966.
Krüger, Erich
Die komischen Szenen in den deutschen geistlichen Spielen des Mittelalters. (Diss.). Hamburg 1931.
Linke, Hansjürgen
Die Teufelsszenen des Redentiner Osterspiels. In: Niederdeutsches Jahrbuch. Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 90 (1967). S. 89-105.
Rudwin, Maximilian Josef
Der Teufel in den deutschen geistlichen Spielen des Mittelalters und der Reformationszeit. Ein Beitrag zur Literatur-, Kultur- und Kirchengeschichte Deutschlands. Göttingen 1915.
[Schottmann, Brigitta]
Das Redentiner Osterspiel. Mittelniederdeutsch und Neuhochdeutsch. Übersetzt und kommentiert von Brigitta Schottmann. Stuttgart 1975. (siehe auch Primärliteratur)
Wolff, Ludwig
Zu den Teufelsszenen des Redentiner Osterspiels. In: Gedenkschrift für William Foerste. Herausgegeben von Dietrich Hofmann. Köln / Wien 1970. S. 424-431.
[...]
1 Die Theorie, dass es sich um eine Abschrift handelt, wird dadurch begründet, dass der Schreiber den Platz, der ihm für den Text zur Verfügung stand, offensichtlich falsch eingeschätzt hat und dementsprechend die Zeilenabstände zum Ende des Spieles hin immer enger werden. Außerdem weist die Handschrift viele Abschreibefehler auf. Vgl. hierzu: Schottmann, Brigitta: Das Redentiner Osterspiel. Mittelniederdeutsch und Neuhochdeutsch. Übersetzt und Kommentiert von Brigitta Schottmann. Stuttgart 1975. S. 3.
2 Brigitta Schottmann fasst die Diskussion um den Entstehungsort des Osterspieles ausführlich zusammen. Nur kurz seien hier die wichtigsten Argumente dazu genannt: Im Text gibt es geographische Anspielungen (V. 206, V. 212), welche die Handlung in der Gegend um Wismar verorten. Schottmann vermutet Redentin als Entstehungs- und Wismar als Aufführungsort. Aufgrund der Nennung Lübecks im Text (V. 1296ff), gibt es auch Vertreter der Meinung, Lübeck sei Entstehungsort. Schottmann verweist auf die entsprechende Literatur zur Diskussion um den Herkunftsort des Osterspieles. Vgl. Schottmann (1975), S. 4-7.
3 Der Tag der Heiligen Elisabeth fällt in der Regel auf den 19. November.
4 Zur Diskussion um das Entstehungsdatum: Schottmann (1975), S. 7f.
5 Ausführlicher hierzu: Humburg, Lothar: Die Stellung des Redentiner Osterspiels in der Tradition des mittelalterlichen geistlichen Schauspiels. Neumünster 1966. S. 27-29.
6 Bei der„visitatio sepulchri“ handelt es sich um einen der Liturgie entstammenden Ostertropus, aus dem sich das spätere Osterspiel herausentwickelt hat. Es war ein in den Gottesdienst integrierter Wechselgesang, der das Gespräch zwischen den drei Frauen und den Engeln am Grab Christi, also die Verkündigung von Christi Auferstehung, wiedergab. Der lateinische Text wurde ursprünglich von zwei Klerikern gesungen. Er setzt sich aus der Engelfrage, der Antwort der Marien, der Engelkündigung, dem Engelauftrag und der Kündigungsantiphon der Marien zusammen. Dieser Gesang wurde mit der Zeit text lich und um weitere Szenen erweitert. Die lateinischen Tropen und Hymnen wurden zur besseren Verständlichkeit ins Volkssprachliche übersetzt. Irgendwann nahmen die szenischen Darstellungen so viel Zeit und Raum ein, dass sie schließlich aus dem Gottesdienst ausgelagert wurden. Aus der Osterfeier, die sich aus der Visitatio, dem Jüngerlauf und der Erscheinungsszene zusammensetzt, entwickelte sich das Osterspiel, das noch um weitere Szenen ergänzt ist. Die früheren Osterfeiern haben einen noch streng kirchlichen Charakter, während die Osterspiele von ihren Verfassern teilweise noch dichterisch ausgeschmückt wurden. Vgl.: Humburg (1966), S. 16-22.
7 Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, Bd. VII. Berlin / New York 1989. Sp. 1066.
8 Verszählung nach der Ausgabe von Brigitta Schottmann (1975).
9 Sie gelten als einmalige Erfindung des Verfassers des Redentiner Osterspiels, da sie in den überlieferten mittelalterlichen Osterspielen sonst nicht vorkommen.
10 Rudwin, Maximilian Josef: Der Teufel in den deutschen geistlichen Spielen des Mittelalters und der Reformationszeit. Ein Beitrag zur Literatur-, Kultur- und Kirchengeschichte Deutschlands. Göttingen 1915. S. 22.
11 Rudwin (1915), S. 14. Auf die Beliebtheit des Nikodemus - Evangeliums im Mittelalter im Allgemeinen verweist Hansjürgen Linke: „ Es erfreute sich im Mittelalter solcher Beliebtheit, dass es Heinrich von Hesler um 1300 in deutsche Reimpaarverse ü bertrug. Von dieser Verdeutschung (...) sind heute immerhin noch ein rundes Dutzend Handschriften erhalten. “ (Linke, Hansjürgen: Die Teufelsszenen des Redentiner Osterspiels. In: Niederdeutsches Jahrbuch. Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 90 (1967). S. 90.)
12 Rudwin (1915), S. 14.
13 Krüger, Erich: Die komischen Szenen in den deutschen geistlichen Spielen des Mittelalters. (Diss.). Hamburg 1931. S. 32.
14 Humburg (1966), S. 66f.
15 Rudwin (1915), S. 21f.
16 Die Versangaben beziehen sich auf die Ausgabe: Das Redentiner Osterspiel. Mittelniederdeutsch und Neuhochdeutsch. Übersetzt und kommentiert von Brigitta Schottmann. Stuttgart 1975. Sie werden im folgenden Text wie hier nur in Klammern angegeben.
17 Brigitta Schottmann weist darauf hin, dass Abel in anderen Osterspielen an dieser Stelle nicht vorkommt. Sie sieht in seinem Vorkommen eine Parallele zu Jesus’ Opfertod, weil Abel als Prototyp des „ get ö teten Gerechten “ gelten würde. Vgl.: Schottmann (1975), S. 188. Das Licht in der Höllenfahrtsszene ist keine Erfindung des Verfassers, sondern rührt, wie Maximilian Rudwin darstellt, aus der Bibel, Sir. 24, 45 und Jes. 9, 2, her. (Rudwin (1915), S. 15.)
18 Vgl. Fußnote 5 zur Entwicklungsgeschichte des Osterspieles.
19 Schottmann (1975), S. 196, Fußnote 373.
20 Schottmann (1975), S. 205, Fußnote 495.
21 Schottmann (1975), S. 206, Fußnote 498a.
22 Angeblich auch „137. Sermo De Tempore“ bezeichnet. Vgl.: Schottmann (1975), S. 206, Fußnote 506a.
23 Schottmann (1975), S. 206, Fußnote 506a.
24 Das erste „Tollite portas“ fehlt in der Handschrift und wird von Schottmann hier eingefügt, weil sie aus den Regieanweisungen „Angeli cantent secundo“ (V. 526a) und „Angeli tertio cantent” (V. 532a) richtig schließt, dass es auch einen ersten Gesang gegeben haben muß. Vgl.: Schottmann (1975), S. 207, Fußnote 512b.
25 Schottmann (1975), S. 207, Fußnote 512b.
26 Schottmann (1975), S. 208f, Fußnote 558a. Weitere lateinische Textstellen mit liturgischem Ursprung: V. 586a („ Sanctorum populus …“ , siehe auch V. 506a), V. 586b („ Advenisti …“ , siehe V. 506a), V. 586c ( „ Venite benedicti …“ nach Matth. 25, 34), V. 604a („ Te nostra vocabant sus …“ , siehe auch V. 506a) und V. 682a (« Magna consolatio …” siehe auch V. 506a).
27 In diesem Sinn kann Evas Rede (V. 507-512) inhaltlich als freie Übersetzung des vorangegangenen „Advenisti“ (V. 505b) gesehen werden.
28 Linke (1967), S. 98.
29 Linke (1967), S. 96.
30 Der vierte Teil der Höllenfahrtsszene, bei der einige der Patriarchen vor dem Himmel nochmals verschiedene Reden führen, soll hier nicht näher erläutert werden, da er für die Untersuchung der Teufelsszenen nicht relevant ist.
31 Grosse, Siegfried: Zur Ständekritik in den geistlichen Spielen des späten Mittelalters. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 86. 1967. S. 68.
32 Lothar Humburg führt beispielhaft einige Bibelzitate an, die für die Gestaltung der Teufelsauftritte Vorbild gewesen sein könnten. Vgl.: Humburg (1966), S. 67.
33 Humburg (1966), S. 76.
34 Vgl.: Krüger (1931), S. 88ff.
35 Ihm wurde unterstellt, dass er sich wie ein Knecht verhalten habe.
36 Krüger (1931), S. 41.
37 Dass mit dem großen Sterben wahrscheinlich die Pest gemeint war, wird damit erklärt, dass in der Detmarschen Chronik von 1464 erwähnt wird, dass Lübeck in diesem Jahr zwischen Pfingsten und Allerheiligen von der Pest ergriffen wurde. Vgl. Wolff, Ludwig,: Zu den Teufelsszenen des Redentiner Osterspiels. In: Gedenkschrift für William Foerste. Herausgegeben von Willy Sanders. Köln / Wien 1970. S. 428.
38 Dass der Priester ein solche Macht den Teufeln gegenüber hat, obwohl er selber nicht frei von Sünden ist, hängt mit der kirchlichen Auffassung vom Priesteramt zusammen. Hier wurde zwischen Amt und Person des Priesters unterschieden. Erst vor dem Jüngsten Gericht muss sich der Priester für sein Verhalten verantworten. Den Teufeln gegenüber wirkt aber v.a. seine priesterliche Weihe, durch die er zum Träger des Heiligen geworden ist. Vgl.: Schottmann (1975): S. 256f, Fußnote 1913.
39 Humburg (1966), S. 78.
40 Die Heilige Schrift. Einheitsübersetzung. Verlag Katholisches Bibelwerk. Stuttgart 1981. S. 1681.
Häufig gestellte Fragen zum Redentiner Osterspiel
Was ist das Redentiner Osterspiel?
Das Redentiner Osterspiel ist eines der wenigen überlieferten mittelniederdeutschen Osterspiele. Der Text befindet sich in einer Handschrift aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe.
Wer hat das Redentiner Osterspiel geschrieben?
Verfasser und Entstehungsort des Spiels sind nicht eindeutig festgestellt. Man nimmt an, dass der Verfasser ein Geistlicher war.
Wann wurde das Redentiner Osterspiel geschrieben?
Ein Vermerk am Ende des Osterspiels datiert die Handschrift auf den 20.11.1464 in Redentin. Es ist unklar, ob sich dieses Datum auf den Originaltext oder die Abschrift bezieht. Man nimmt an, dass der zeitliche Abstand zwischen Original und Abschrift nicht allzu groß war.
Welches andere Osterspiel ähnelt dem Redentiner Osterspiel?
Man ist sich einig, dass es dem Innsbrucker Osterspiel sehr nahe steht, jedoch kann nicht nachgewiesen werden, dass dieses unmittelbare Vorlage war.
Was ist die Handlung des Redentiner Osterspiels?
Das Osterspiel handelt von der Verhinderung der Auferstehung Christi durch die Juden und Pilatus, der Auferstehung selbst, Christi Höllenfahrt, der Befreiung der Seelen und dem anschließenden Teufelsspiel, in dem die Teufel versuchen, neue Seelen zu fangen.
Was ist das Besondere an den Teufelsszenen im Redentiner Osterspiel?
Die Teufelsszenen nehmen im Vergleich zu anderen Osterspielen außergewöhnlich viel Raum ein und machen fast zwei Drittel des gesamten Textes aus. Das Osterspiel verzichtet auf die „visitatio sepulchri“, die sonst in keinem anderen deutschen Osterspiel fehlt.
Wie ist die Höllenfahrtsszene im Redentiner Osterspiel aufgebaut?
Die Höllenfahrtsszene ist in vier Teile gegliedert: die Propheten in der Vorhölle, die Teufel, die Vereiningung von Propheten, Teufeln und Christus, und die Propheten vor dem Himmel.
Welche Funktion haben die Patriarchen (Erzväter) in der Höllenfahrtsszene?
Die Patriarchen haben die Funktion von Zeugen für das Geschehen Christi Höllenfahrt. Sie stellen Bezüge zur christlichen Bibelgeschichte her und festigen den Glauben an die eigene Erlösung.
Was ist das Teufelsspiel im Redentiner Osterspiel?
Das Teufelsspiel ist der zweite Teil des Osterspiels, der ausschließlich in der Hölle spielt und in dem die Teufel versuchen, neue Seelen zu fangen.
Welche sprachlichen Besonderheiten weist das Redentiner Osterspiel auf?
Das Teufelsspiel ist rein mittelniederdeutsch geschrieben und zeichnet sich durch eine realistische, direkte Sprache mit drastischen Ausdrücken aus. Der Verfasser nutzt bildhafte Ausdrücke, Vergleiche und Sprichwörter.
Wie wird das Machtverhältnis zwischen Jesus und den Teufeln dargestellt?
Jesus Christus wird als absoluter Herrscher dargestellt, während die Teufel ihm unterlegen sind. Jesus zerbricht die Tore der Hölle und legt Luzifer in Ketten.
Welche Rolle spielt Luzifer im Redentiner Osterspiel?
Luzifer ist der Oberteufel, wird aber als eine wechselhafte, zerrissene Person dargestellt, die Christus gegenüber unterlegen ist.
Welche Intention verfolgte der Verfasser des Redentiner Osterspiels?
Der Verfasser wollte dem Zuschauer die Hoffnung auf das Paradies stärken, indem er den Teufel als überwindbar darstellt und zu Widerstand gegen das Böse motiviert.
Was sind die wichtigsten Quellen für das Redentiner Osterspiel?
Die wichtigsten Quellen sind biblische Passagen, das lateinische Nikodemus-Evangelium und liturgische Texte wie der Hymnus „Tollite portas“.
Wo kann ich das Redentiner Osterspiel finden?
Der Text des Redentiner Osterspiels befindet sich in einer Handschrift in der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe (Signatur: Nr. K.369).
- Quote paper
- Claudia Groß (Author), 2000, Die Teufelsszenen im Redentiner Osterspiel, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/101785