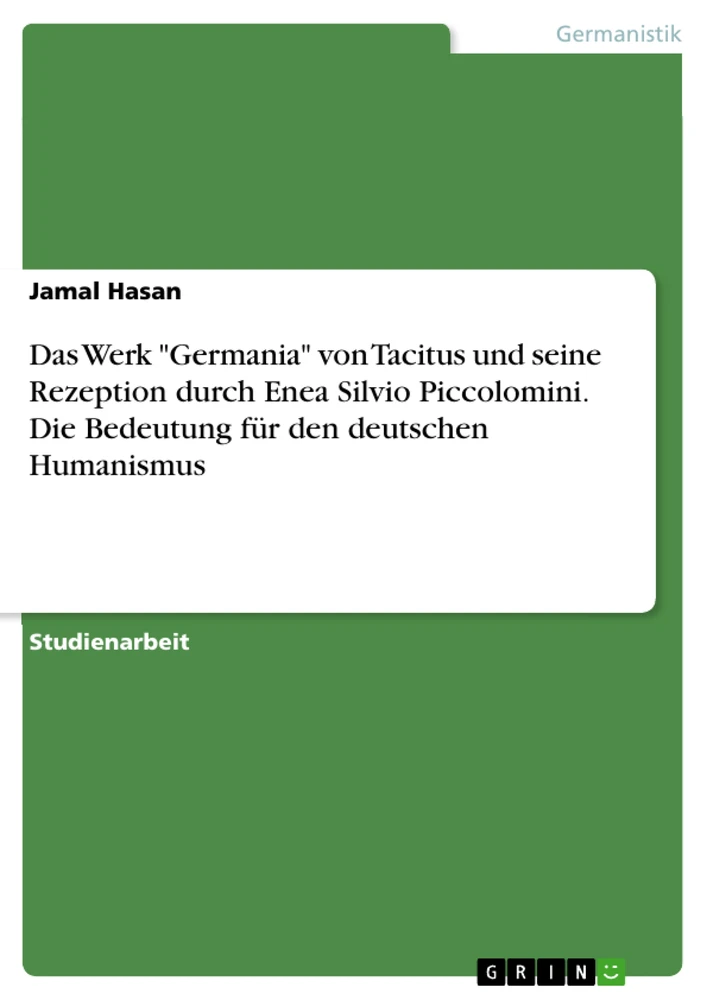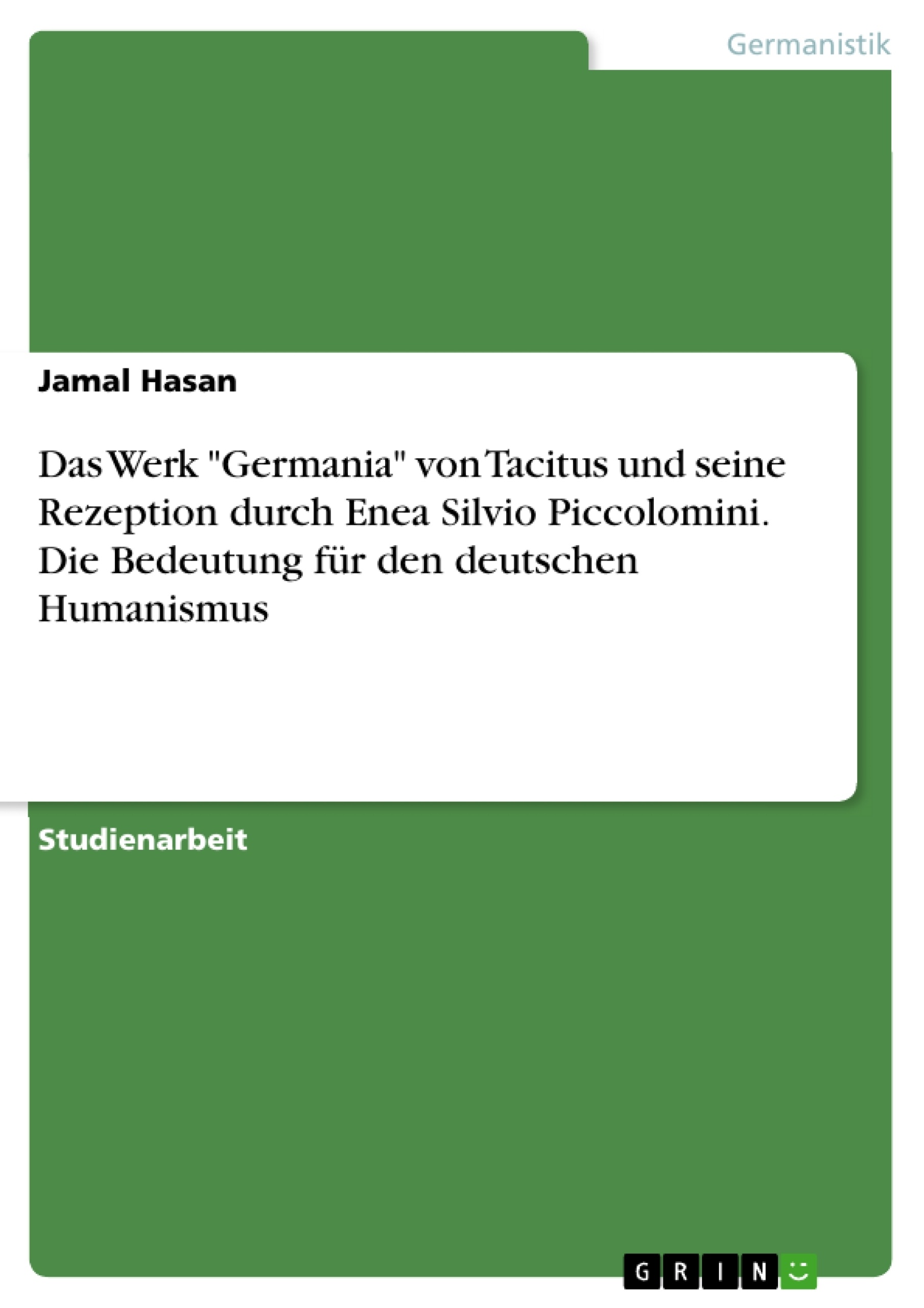Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Bedeutung der Germania-Rezeption durch Publius Cornelius Tacitus sowie der Germania-Rezeption durch Enea Silvio Piccolomini für die Anfänge des deutschen Humanismus.
Die Germanen waren wilde rohe Barbaren, die nichts anderes außer Krieg kannten. So oder so ähnlich sind die Germanen in das Universalgedächtnis der Menschheit eingegangen. Da die Germanen aber über keine eigene Schriftlichkeit verfügten, steht nun die Frage im Raum, woher wir dies wissen oder zu wissen glauben. Über die Germanen unter anderem schreibt Tacitus.
Die taciteische Germania, ein Werk, das wahrscheinlich zumindest jeder Lateinschüler bereits einmal im Original gelesen hat bzw. lesen musste. Doch was machte dieses Werk für die Humanisten des Mittelalters so interessant, dass es zu einem der meistrezipierten Werke der Antike wurde?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Publius Cornelius Tacitus und seine Bedeutung für die Humanisten
- 2.1 Leben und Werke
- 2.2 De origine et situ Germanorum Liber
- 2.2.1 Aufbau und Eigenarten
- 2.2.2 Die Quellen
- 2.2.3 Glaubwürdigkeit und Aussageabsicht
- 2.3 Das Germanenbild des Tacitus und seine Bedeutung für die Rezeption
- 2.3.1 Das Germanenbild im historischen Umfeld
- 2.3.2 Das Germanenbild in der Germania
- 2.4 Die Germania und das Germanenbild als Rezeptionsvorlage
- 3. Enea Silvio Piccolomini und seine Germania-Rezeption
- 3.1 Leben und Werke
- 3.2 Die Wiederentdeckung der Germania des Tacitus
- 3.3 De ritu, situ, moribus et conditione Germaniae
- 3.3.1 Aufbau und Eigenarten
- 3.3.2 Die Quellen
- 3.3.3 Aussageabsicht im Wandel: Frankfurter Rede und Germania
- 3.4 Das Germanenbild des Piccolomini und seine Bedeutung für die Rezeption
- 4. Vergleich der Germania-Schriften
- 4.1 Die räumliche Ausdehnung Germaniens
- 4.2 Die Germanen als rohe Barbaren?
- 5. Die Bedeutung Enea Silvio Piccolominis für den deutschen Humanismus
- 5.1 Die Italiener als Vermittler deutscher Vergangenheit
- 5.2 Der Einfluss der piccolominischen Germania
- 6. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung der Tacitus' Germania und deren Rezeption durch Enea Silvio Piccolomini für den deutschen Humanismus und die Anfänge deutscher Geschichtsschreibung. Sie analysiert die Intentionen beider Autoren, vergleicht ihre Germanenbilder und untersucht den Einfluss Piccolominis auf die Entwicklung eines deutschen Nationalbewusstseins.
- Tacitus' Germania als Quelle und ihr Germanenbild
- Piccolominis Rezeption der Germania und seine eigene Darstellung der Germanen
- Vergleich der Germanenbilder bei Tacitus und Piccolomini
- Der Einfluss der Germania-Rezeption auf den deutschen Humanismus
- Die Rolle italienischer Humanisten als Vermittler deutscher Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Bedeutung der Germania des Tacitus und ihrer Rezeption durch Piccolomini für den deutschen Humanismus und die Anfänge deutscher Geschichtsschreibung. Sie skizziert den gängigen, stereotypen Blick auf die Germanen und führt die Bedeutung der Germania als einflussreiche Quelle an, die bis in die Gegenwart nachwirkt. Die Einleitung umreißt den methodischen Ansatz der Arbeit, der einen Vergleich der Werke Tacitus' und Piccolominis beinhaltet, sowie die Verwendung von Sekundärliteratur zur Kontextualisierung.
2. Publius Cornelius Tacitus und seine Bedeutung für die Humanisten: Dieses Kapitel widmet sich dem Leben und Werk des römischen Historikers Tacitus. Es beleuchtet seine Biographie, seine literarische Tätigkeit im Kontext der römischen Kaiserzeit und insbesondere sein Werk „De origine et situ Germanorum liber“. Die Analyse fokussiert auf den Aufbau, die Quellen und die Glaubwürdigkeit der Germania, sowie auf die Darstellung des Germanenbildes und seine möglichen Intentionen. Das Kapitel legt den Grundstein für den späteren Vergleich mit Piccolominis Werk.
3. Enea Silvio Piccolomini und seine Germania-Rezeption: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den italienischen Humanisten Enea Silvio Piccolomini und seine Rezeption von Tacitus' Germania. Es untersucht Piccolominis Leben und Werk, die Umstände der Wiederentdeckung der Germania und die Entstehung seines eigenen Werkes über die Germanen. Der Fokus liegt auf der Analyse von Piccolominis Quellen, seiner Aussageabsicht und der Entwicklung seines Germanenbildes im Vergleich zu Tacitus.
4. Vergleich der Germania-Schriften: In diesem Kapitel werden die Werke Tacitus' und Piccolominis direkt miteinander verglichen. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung der Germanen, insbesondere hinsichtlich der räumlichen Ausdehnung Germaniens und der Frage, ob die Germanen als "rohe Barbaren" dargestellt werden, herausgearbeitet und analysiert. Dieser Vergleich trägt entscheidend zum Verständnis der unterschiedlichen Intentionen und Perspektiven beider Autoren bei.
5. Die Bedeutung Enea Silvio Piccolominis für den deutschen Humanismus: Das Kapitel analysiert den Einfluss Piccolominis und seiner Germania-Rezeption auf den deutschen Humanismus. Es untersucht die Rolle italienischer Humanisten als Vermittler deutscher Geschichte und den konkreten Einfluss der piccolominischen Germania auf die Entwicklung eines deutschen Nationalbewusstseins. Hier wird der langfristige Impact der Rezeption auf die deutsche Geschichtsschreibung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Tacitus, Germania, Enea Silvio Piccolomini, Germanenbild, Humanismus, deutsche Geschichtsschreibung, Nationalbewusstsein, Rezeption, Vergleich, Quellenkritik, Antike, Frühe Neuzeit, Italien, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Tacitus' Germania und ihre Rezeption durch Enea Silvio Piccolomini
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Tacitus' „Germania“ und deren Rezeption durch Enea Silvio Piccolomini für den deutschen Humanismus und die Anfänge der deutschen Geschichtsschreibung. Im Mittelpunkt steht ein Vergleich der Germanenbilder beider Autoren und deren Einfluss auf die Entwicklung eines deutschen Nationalbewusstseins.
Welche Autoren stehen im Fokus der Untersuchung?
Die Arbeit konzentriert sich auf den römischen Historiker Publius Cornelius Tacitus und den italienischen Humanisten Enea Silvio Piccolomini. Analysiert werden Tacitus' „De origine et situ Germanorum“ (Germania) und Piccolominis eigene Darstellung der Germanen, „De ritu, situ, moribus et conditione Germaniae“.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Tacitus' „Germania“ als Quelle und ihr Germanenbild; Piccolominis Rezeption der „Germania“ und seine eigene Darstellung der Germanen; ein Vergleich der Germanenbilder bei Tacitus und Piccolomini; der Einfluss der „Germania“-Rezeption auf den deutschen Humanismus; die Rolle italienischer Humanisten als Vermittler deutscher Geschichte; die Quellen und die Glaubwürdigkeit der jeweiligen Darstellungen; der Aufbau und die Eigenarten beider Werke; die Aussageabsichten der Autoren.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Eine Einleitung, die die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz beschreibt; ein Kapitel zu Tacitus' Leben, Werk und der „Germania“; ein Kapitel zu Piccolomini, seiner Rezeption der „Germania“ und seinem eigenen Werk; ein Vergleichskapitel, das die Germanenbilder beider Autoren gegenüberstellt; ein Kapitel zum Einfluss Piccolominis auf den deutschen Humanismus; und abschließend ein Resümee.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet einen vergleichenden Ansatz, der die Werke von Tacitus und Piccolomini analysiert und gegenüberstellt. Dabei wird auf Sekundärliteratur zurückgegriffen, um die Werke in ihren historischen Kontext einzuordnen und die Quellenlage zu bewerten. Es findet eine Quellenkritik statt, um die Glaubwürdigkeit der Darstellungen zu untersuchen.
Welche Ergebnisse werden in der Arbeit präsentiert?
Die Arbeit präsentiert einen detaillierten Vergleich der Germanenbilder von Tacitus und Piccolomini, analysiert die Intentionen beider Autoren und untersucht den Einfluss von Piccolominis Werk auf die Entwicklung eines deutschen Nationalbewusstseins und die Anfänge der deutschen Geschichtsschreibung im Kontext des Humanismus. Die Rolle italienischer Humanisten als Vermittler der deutschen Geschichte wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Tacitus, Germania, Enea Silvio Piccolomini, Germanenbild, Humanismus, deutsche Geschichtsschreibung, Nationalbewusstsein, Rezeption, Vergleich, Quellenkritik, Antike, Frühe Neuzeit, Italien, Deutschland.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an Wissenschaftler, Studierende und alle Interessierten, die sich mit der Geschichte des deutschen Humanismus, der antiken Rezeption und der frühen deutschen Geschichtsschreibung befassen.
- Quote paper
- Jamal Hasan (Author), 2018, Das Werk "Germania" von Tacitus und seine Rezeption durch Enea Silvio Piccolomini. Die Bedeutung für den deutschen Humanismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1014485