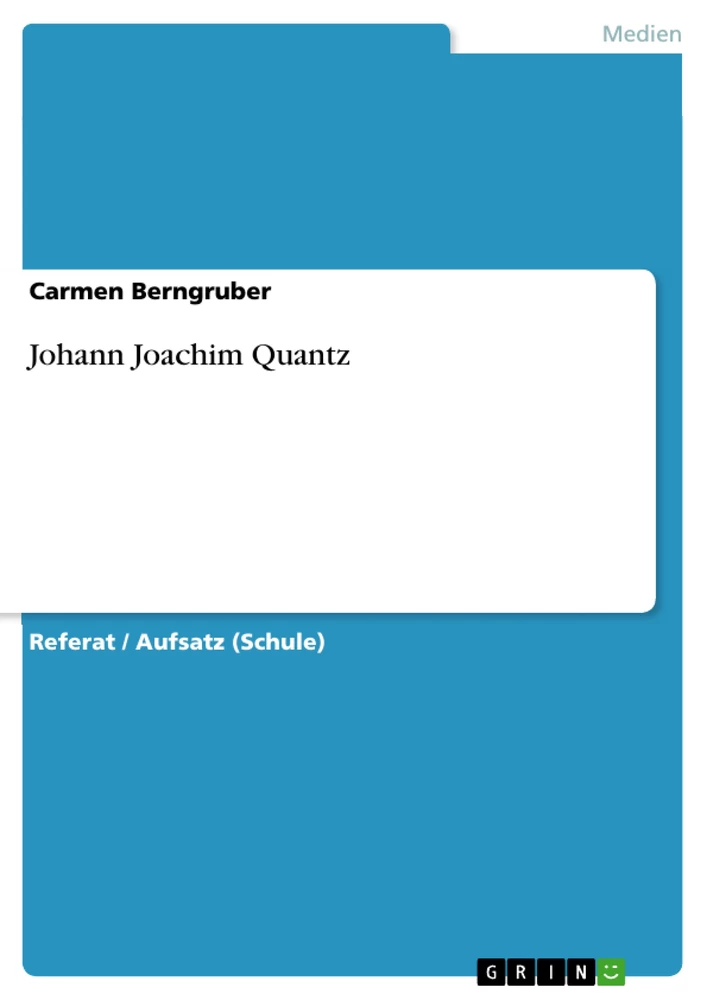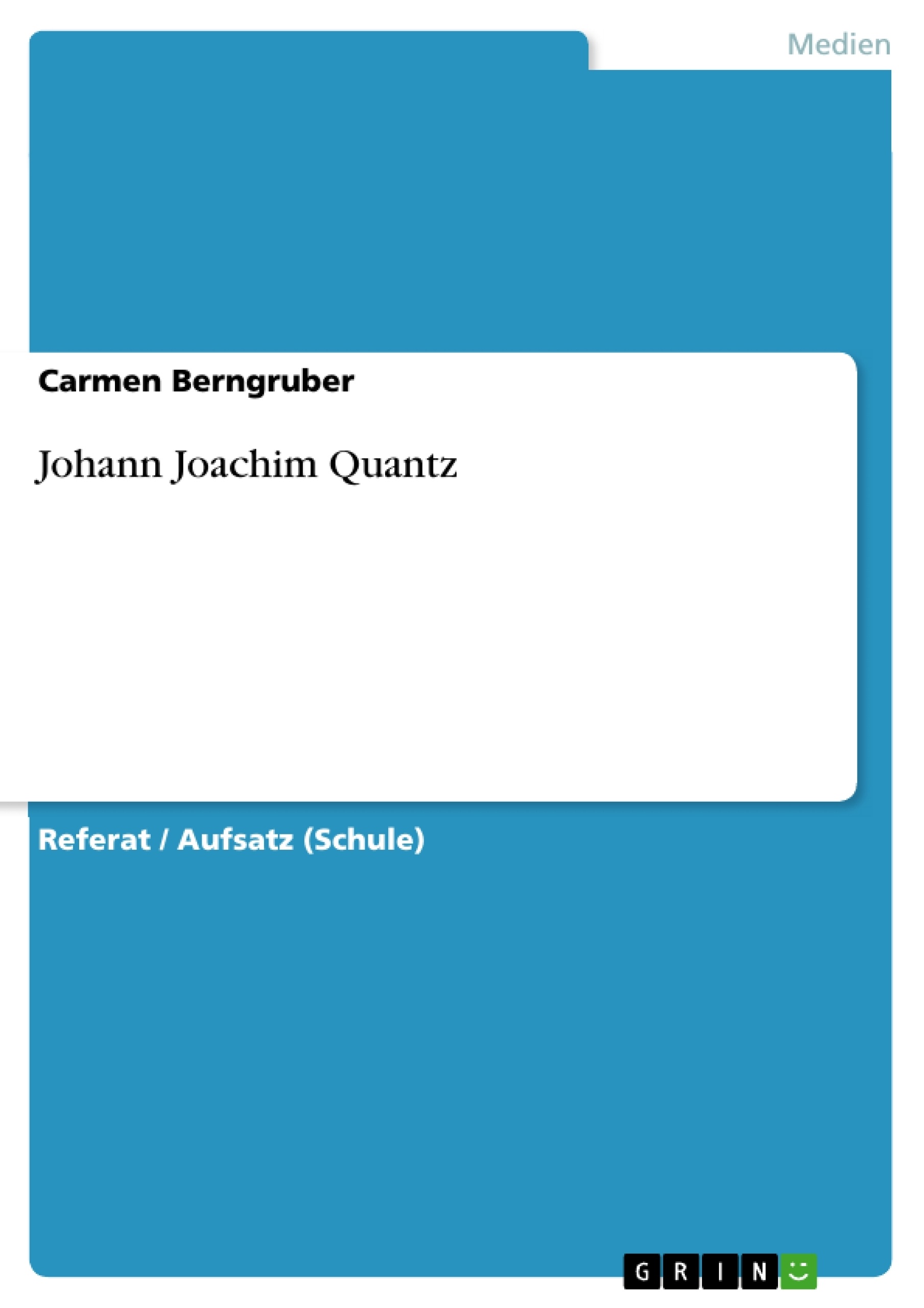Sein Leben
Johann Joachim Quantz wurde am 30. Januar 1697 in Oberscheden bei Göttingen geboren. Er sollte wie sein Vater Hufschmied werden, doch folgte er nach dessen Tod 1707 seiner Nei- gung zur Musik.
Seine ersten Lehrer waren sein Onkel Justus Quantz und dessen Schwiegersohn Johann Adolf Fleischhack. Johann Joachim erhielt Unterricht auf den Instrumenten Violine, Oboe, Trompe- te, Zink, Posaune, Waldhorn, Blockflöte, Fagott, Violoncello, Gambe und Kontrabass. Au- ßerdem nahm er bei einem Verwandten, dem Organisten Johann Friedrich Kiesewetter, Kla- vierunterricht.
1714 ging Quantz für ein Jahr als Stadtpfeifer nach Radeberg und Pirna und 1717 hielt er sich drei Monate in Wien auf. 1718 wurde er als Oboist in die Polnische Kapelle Augusts II aufgenommen. Dieses Kammerorchester von zwölf Musikern ging alljährlich für kurze Zeit nach Warschau, hielt sich sonst aber in Dresden auf.
Der Musiker erkannte aber bald, dass er als Oboist oder Geiger nicht zu einer führenden Stellung kommen konnte und wählte deshalb die Traversflöte, die er nebenbei erlernt hatte, zum Hauptinstrument. Er nahm Unterricht bei Pierre Gabriel Buffardin, dem 1. Flötisten der Königlichen Kapelle und bildete sich daneben weiter in der Komposition aus.
1724 begleitete Quantz den sächsischen Gesandten Graf Lagnasco nach Rom, wo er bei F. Gasparini Kompositionsunterricht nahm. 1725 lernte er in Neapel durch J. A. Hasse A. Scarlatti kennen, der ihm ein paar Flöten-Soli komponierte.
1726 reiste er von Italien aus nach Paris. Hier gewann er die Freundschaft des Flötisten M. Blavet. Obwohl Johann Joachim Anfang 1727 nach Dresden zurückberufen war, reiste er im März nach London. G. F. Händel versuchte ihn zu überreden, in London zu bleiben, doch wollte Quantz „die Früchte seiner Reise seinem König nicht vorenthalten“ und kehrte im Juni nach Dresden zurück.
Im März des folgenden Jahres übernahm er die Stelle des 1. Flötisten in der Königlichen Kapelle. Im Karneval lernte er Kronprinz Friedrich von Preußen kennen, der mit seinem Vater den Dresdener Hof besuchte. Zu dem Gegenbesuch Augusts des Starken im Mai reiste neben Pisendel, Weiß und Buffardin auch Quantz nach Berlin. Er spielte vor der Königin, die ihn bei hoher Besoldung in Dienst nehmen wollte, doch der Dresdener Hof gab ihn nicht frei. Es wurde ihm aber gestattet, zweimal im Jahr nach Berlin, Ruppin oder Rheinsberg zu reisen, um den Kronprinzen im Flöten-Spiel zu unterrichten.
1741 berief der nunmehrige König Friedrich II. Quantz unter so vorteilhaften Bedingungen an seinen Hof, wie sie selten einem Musiker jener Zeit geboten worden sind: 2.000 Taler Jahressold auf Lebenszeit, Honorierung jeder Komposition und jeder für den König gefertigten Flöte und völlige Unabhängigkeit von der Staatskapelle.
Er hatte den König täglich zu unterrichten, Kompositionen zu schaffen und die abendlichen Hauskonzerte zu leiten, in denen u. a. C. Ph. E. Bach und F. Benda mitwirkten. Der Musiker begleitete den König zusammen mit einigen weiteren Musikern auch auf den Feldzügen. Konzertreisen und Einladungen an andere Höfe schlug er aus und blieb für den Rest seines Lebens in Potsdam und Berlin.
Seine Flötenschule „Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen“ (1752), die sechs Duette (1759) und die „Kirchenmelodien“ zu Gellerts Texten (1760) sind die einzigen Werke, mit denen der Komponist in seiner Berliner Zeit an die Öffentlichkeit trat. Der König dankte ihm diese freiwillige Beschränkung durch seine lebenslange Freundschaft.
Quantz war der einzige, von dem der König auch Kritik annahm. Er respektierte die gelassene Würde des reiferen Mannes, dessen schlichtes und gerades Wesen ihn ebenso anzog wie sein sicheres Urteil, das hinsichtlich des künstlerischen Geschmacks mit seinem übereinstimmte.
Johann Joachim Quantz starb am 12. Juli 1773 im Alter von 76 Jahren nach kurzer Krankheit in Potsdam.
Sein Schaffen
Quantz ist als Flöten-Komponist außerordentlich fruchtbar gewesen; dennoch hat er sehr gründlich gearbeitet.
Die Flöten-Konzerte entsprechen in Satzanlage, Thematik und Architektur den Solokonzerten Vivaldis. Die frühen Konzerte der Dresdener Zeit tragen gelegentlich noch stärker französische Züge. Durch die Weiterbildung des italienischen Instrumental-Konzerts ist Quantz neben Graun, F. Benda und C. Ph. E. Bach zu einem der wichtigsten Vertreter der Berliner Schule auf dem Gebiet der Instrumental-Musik geworden.
Mit dem Antritt seiner Stellung am preußischen Hofe musste sich der Komponist auf die Erfordernisse des dortigen Musiklebens und die Fähigkeiten und den Geschmack seines Schülers einstellen. Da sich die Anschauungen Friedrichs nicht mehr änderten, stagnierte auch die kompositorische Entwicklung seines Lehrmeisters.
Dass Quantz’ Sonaten weniger persönlich und weniger anspruchsvoll als die von C. Ph. E. Bach sind, ist durch den Geschmack des Königs bedingt, der starke dramatische und traurige Affekte nicht liebte, sondern mehr schmeichelnde, zärtliche und heitere Melodik allgemeineren Ausdrucks bevorzugte.
Seine Kompositionen bewegen sich im „galanten“ Stil, doch sind sie, besonders die Triosona- ten, reicher an Kenntnissen des strengen Satzes und der „gearbeiteten“ Musik als die des Kö- nigs.
Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen Den nachhaltigsten Einfluss auf seine Zeit übte Quantz durch seinen „Versuch einer Anwei- sung...“ aus. Diese umfassende Instrumental-Schule des 18. Jahrhundert fand bei ihrem Er- scheinen lebhafte Zustimmung. Sie wurde mehrfach gedruckt und übersetzt sowie nachge- ahmt und wurde richtungweisend für ähnliche Werke der Folgezeit. Nur 40 von 334 Seiten behandeln Probleme der Querflöte und ihres Spieles, der Rest beschäftigt sich mit allgemei- nen Fragen des musikalischen Geschmacks, der musikalischen Bildung der Aufführungspra- xis.
Der Autor stellt „Verstand gegen Herz“, setzt ersteren der gearbeiteten polyphonen Musik, letzteren der galanten, homophonen gleich. Er lehnt die Kontrapunktik aber nicht ab, möchte sie aber mehr auf die große Besetzung für größere Räume (Kirchen) beschränkt wissen.
Er unterscheidet Affekt und Ausdruck und fordert, dass der Ausdruck (galanter Stil) dem Af- fekt („gearbeitete“ Musik) gemäß sei. Wie Mattheson vergleicht er Musik und Rhetorik und verlangt vom Künstler Deutlichkeit und „Ausdruck“ des Vortrages, um die der Musik inne- wohnenden Gedanken verständlich zu machen. Vom Instrumentalisten erwartet er, dass er dem Sänger nacheifere.
Er fordert den „gemischten Geschmack“, d.h. eine Verschmelzung des italienischen und des französischen Stiles, indem er italienische Verzierungskunst, französische Architektur und Rhythmik mit dem „gearbeiteten Stil“ der deutschen Kontrapunktik zu einem neuen Stile ver- binden will.
Die „gearbeitete Musik“ des Barocks erscheint ihm wegen der gleichbleibenden Affekte und instrumentalen Klangfarben langweilig. Er fordert Mannigfaltigkeit des Ausdrucks, Wechsel der Töne und Instrumente, deutliche Stimmungsabgrenzung der Sätze, harmonische Abwechslung durch Dissonanzen, melodische durch Verzierungskunst.
Als bedeutendste Instrumental-Schule des 18. Jahrhunderts neben denen von C. Ph. E. Bach und Leopold Mozart ist Quantz’ „Versuch einer Anweisung...“ eine der wichtigsten Quellen für die Musik und die Musikanschauung des deutschen Rokokos.
Von den Verbesserungen, die er für die Traversflöte erfand, hat sich der Aus- und Einschiebekopf, der ohne Wechsel der Mittelteile ein Änderung der Stimmung bis zu einem Halbton erlaubte, bis heute erhalten.
Diese Querflöten-Schule gliedert sich in folgende Kapitel:
Vorrede
Quantz schreibt hier: „...Ich habe mich deswegen auch in die Lehren vom guten Geschmacke in der praktischen Musik etwas weitläufig eingelassen. Und ob ich zwar dieselben hauptsäch- lich nur auf die Flöte traversiere angewendet habe: so können sie doch auch allen denen nütz- lich sein, welche so wohl vom Singen, als von Ausübung anderer Instrumente Wert machen, und sich eines guten musikalischen Vortrages befleißigen wollen. Es darf nur ein jeder, dem daran gelegen ist, das, was sich für seine Stimme, oder sein Instrument schicket heraus neh- men, und sich zu Nutzen machen...“
Einleitung
Von den Eigenschaften, die von einem, der sich der Musik widmen will, erfordert we r- den „... und insbesondere die Flöte, erfordert einen vollkommenen gesunden Körper; eine offne starke Brust; einen langen Athem; gleiche Zähne, die weder zu lang noch zu kurz sind; nicht aufgeworfene und dicke, sonder dünne, glatte und feine Lippen, die weder zu viel noch zu wenig Fleisch haben, und den Mund ohne Zwang zuschließen können; eine geläufige und geschickte Zunge; wohlgestaltete Finger, die weder zu lang, noch zu kurz, noch zu dickfleischig, noch zu spitzig, sonder die mit starken Nerven versehen sind: und eine offene Nase, um den Athem sowohl leicht zu schöpfen, als von sich zu geben...“
Das I. Hauptstück
Kurze Historie und Beschreibung der Flöte traversiere
Das II. Hauptstück
Von Haltung der Flöte und Setzung der Finger
„... Den Kopf muß man beständig gerade, doch ungezwungen, in die Höhe halten: damit der Wind im Steigen nicht behindert werde. Die Arme muß man ein wenig auswärts in die Höhe halten, doch den linken mehr als den rechten; und sie ja nicht an den Leib drücken: damit man nicht genöthiget werde, den Kopf nach der rechten Seite zu, schief zu halten; als welches nicht allein eine üble Stellung des Leibes verursachet, sonder auch im Blasen selbst hinderlich ist: indem die Kehle dadurch zusammen gedrücket wird, und das Athemholen, nicht, wie es soll, mit einer Leichtigkeit geschehen kann...“
Das III. Hauptstück
Von der Fingerordnung oder Application und der Tonleiter oder Scala der Flöte
Das IV Hauptstück
Von dem Ansatze
„...Auf der Flöte wird der Ton durch die Bewegung der Lippen, nach dem man dieselben, bei der Herausstoßung des Windes in das Mundloch der Flöte, mehr oder weniger zusammenzieht, gebildet...“
Das V. Hauptstück
Von den Noten, ihrer Geltung, dem Tacte, den Pausen, und den übrigen musikalischen Zeichen
Das VI. Hauptstück
Vom Gebrauch der Zunge, bei dem Blasen auf der Flöte
Des VI. Hauptstücks I. Abschnitt: Vom Gebrauche der Zunge mit der Silbe: ti oder di
Des VI. Hauptstücks II. Abschnitt: Vom Gebrauche der Zunge mit dem Wörtchen: tiri
Des VI. Hauptstücks III. Abschnitt: Vom Gebrauche der Zunge mit dem Wörtchen: didd’ll oder der sogenannten Doppelzunge
Des VI. Hauptstücks Anhang: Einige Anmerkungen zum Gebrauche des Hoboe, und des Bassons
Das VII. Hauptstück
Vom Atemholen, bei Ausübung der Flöte
„...Um lange Passagien zu spielen, ist nöthig, dass man einen guten Vorrath von Athem langsam in sich ziehe. Man muß zu dem Ende den Hals und die Brust weit ausdehnen; die Achseln in die Höhe ziehen; den Athem in der Brust, so viel als möglich ist, aufzuhalten suchen; und ihn alsdenn ganz sparsam in die Flöte blasen...“
(Bem: Heute verwenden Flötisten die Zwerchfellatmung, jegliche Atmung in die Brust und Bewegung der Schulter ist heutzutage falsch.)
Das VIII Hauptstück
Von den Vorschlägen, und den dazu gehörigen kleinen wesentlichen Manieren
„... Die Vorschläge (Ital. Appeggiature, Franz. Ports de voix) sind im Spielen sowohl ein Zier- rath, als eine nothwendige Sache. Ohne dieselben würde eine Melodie öfters sehr mager und einfältig klingen. Soll eine Melodie galant aussehen; so kommen immer mehr Consonanzen als Dissonanzen darinne vor. Wenn der erstern viele nach einander gesetzet werden, und nach einigen geschwinden Noten eine consonirende lange folget: so kann das Gehör dadurch leicht ermüdet werden. Die Dissonanzen müssen es also dann und wann gleichsam wieder aufmun- tern...“
Das IX. Hauptstück
Von den Trillern
„...Die Triller geben dem Spielen einen großen Glanz; und sind, so wie die Vorschläge, unentbehrlich. Wenn ein Instrumentist, oder Sänger, alle Geschicklichkeit besäße, welche der gute Geschmack in der Ausführung erfordert; er könnte aber keinen guten Triller schlagen: so würde seine ganze Kunst unvollkommen sein...“
Das X. Hauptstück
Was ein Anfänger, bei seiner besonderen Uebung, zu beobachten hat
„... Die Zeit, wie lange ein Anfänger täglich zu spielen nöthig hat, ist eigentlich nicht zu bestimmen. Einer begreift eine Sache leichter, als ein anderer. Es muß sich also hierinne ein jeder nach seiner Fähigkeit, und nach seinem Naturelle richten. Doch ist zu glauben, dass man auch hierinne entweder zu viel, oder zu wenig thun könne. Wollte einer, um bald zu seinem Zwecke zu gelangen, den ganzen Tag spielen: so könnte es nicht nur seiner Gesundheit nacht- heilig sein; sondern er würde auch, vor der Zeit, sowohl die Nerven als die Sinne abnutzen. Wollte er es aber bey einer Stunde des Tages bewenden lassen: so möchte der Nutzen sehr spät erfolgen...“
Das XI. Hauptstück
Vom guten Vortrage im Singen und Spielen überhaupt
„... Die gute Wirkung einer Musik hängt fast ebenso viel von den Ausführern, als von dem Componisten selbst ab. Die beste Composition kann durch einen schlechten Vortrag ver- stümmelt, eine mittelmäßige Composition aber durch einen guten Vortrag verbessert, und erhoben werden...“
Das XII. Hauptstück
Von der Art das Allegro zu spielen
Das XII. Hauptstück
Von den willkürlichen Veränderungen über die simplen Intervalle
Das XIV. Hauptstück
Von der Art das Adagio zu spielen
„... Das Adagio machet gemeiniglich den bloßen Liebhabern der Musik das wenigst Vergnügen, und sind so wohl die meisten Liebhaber, als auch oft gar die Ausführer der Musik selbst, wofern es ihnen an der gehörigen Empfindung und Einsicht fehlet, froh, wenn das Adagio in einem Stücke zu Ende ist...“
Das XV. Hauptstück
Von den Cadenzen
„...Es ist zwar nicht zu läugnen, dass die Cadenzen, wenn sie so gerathen, wie es die Sache erfordert, und am rechten Orte angebracht werden, zu einer Zierde dienen. Man wird aber auch einräumen, dass sie, da sie selten von rechter Art sind, gleichsam, und zumal beym Sin- gen, nur zu einem nothwendigen Übel gediehen sind. Wenn keine gemachet werden, so hält man es für einen großen Mangel. Mancher aber würde sein Stück mit mehr Ehre beschließen, wenn er gar keine Cadenz machete. Indessen will oder muß ein jeder, der sich mit Singen oder Solospielen abgibt, Cadenzen machen. Weil aber nicht allen die Vortheile und die rechte Art derselben bekannt sind: so fällt diese Mode dem größten Theile zur Last...“
Das XVI. Hauptstück
Was ein Flötenist zu beobachten hat, wenn er in öffentlichen Musiken spielet
„...Obwohl der Beyfall der Zuhörer zu einer Aufmunterung dienen kann: so muß man, dessen ungeachtet, durch das überflüßige Loben, welches bey der Musik zum Misbrauche worden, vielleicht weil es einige phantastische Ignoranten unter den welschen Sänger, bey all ihrer Unwissenheit, fast als eine Pflicht, die man ihrem bloßen Namen schuldig seyn soll, verlan- gen, sich nicht verführen zu lassen. Man muß solches vielmehr, zumal wenn man es von gu- ten Freunden erhält, eher für eine Schmeicheley, als für eine Wahrheit annehmen. Die rechte Wahrheit kann man eher durch vernünftige Feinde, als durch schmeichlerische Freunde, er- fahren...“
Das XVII. Hauptstück
Von den Pflichten derer, welche accompagniren, oder die einer concertirenden Stimme zugeselleten Begleitungs- oder Ripienstimmen ausführen
Des XVII. Hauptstücks I. Abschnitt: Von den Eigenschaften eines Anführers der Musik
Des XVII. Hauptstücks II. Abschnitt: Von den Ripien-Violinisten insbesondere
Des XVII. Hauptstücks III. Abschnitt: Von dem Bratschisten insbesondere
Des XVII. Hauptstücks IV. Abschnitt: Von dem Violoncellisten insbesondere
Des XVII. Hauptstücks V. Abschnitt: Von dem Contraviolonisten insbesondere
Des XVII. Hauptstücks VI. Abschnitt: Von dem Clavieristen insbesondere
Des XVII. Hauptstücks VII. Abschnitt: Von den Pflichten, welche alle begleitenden Instru- mentisten überhaupt in Acht zu nehmen haben.
Das XVIII. Hauptstück
Wie ein Musikus und eine Musik zu beurteilen sey
„...Man begnüget sich nicht allemal, wenn ein jeder von denen, welche sich hören lassen, das, was in seinen Kräften steht, hervor zu bringen bemühet ist: sonder man verlanget oftmals mehr zu hören, als man selbst niemals zu hören gewohnt gewesen ist. Singen oder spielen in einer Versammlung nicht alle in gleicher Vollkommenheit: so leget man oftmals nur einem allen Vorzug bey, und hält alle andern für gering; ohne zu bedenken, dass der eine in dieser, der andere in jener Art seine Verdienste haben könne...“
Register der vornehmsten Sachen
Grempel zu Johann Joachim Quantzens Versuch einer Anweisung die flöte traversiere zu spielen. Auf XXXIV. Kupfertafeln
Quellen:
Häufig gestellte Fragen
Wer war Johann Joachim Quantz?
Johann Joachim Quantz war ein deutscher Flötenvirtuose, Komponist und Flötenlehrer, geboren am 30. Januar 1697 in Oberscheden bei Göttingen und gestorben am 12. Juli 1773 in Potsdam. Er war bekannt für seine einflussreiche Flötenschule "Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen" und seine Tätigkeit am Hofe Friedrichs II. von Preußen.
Was sind die wichtigsten Stationen im Leben von Johann Joachim Quantz?
Quantz begann seine musikalische Ausbildung nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1707. Er war Stadtpfeifer in Radeberg und Pirna, Oboist in der Polnischen Kapelle Augusts II., studierte Komposition in Rom und Neapel, reiste nach Paris und London und wurde schließlich 1741 von Friedrich II. an seinen Hof in Potsdam berufen.
Was war Quantz' "Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen"?
"Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen" ist eine umfassende Instrumental-Schule des 18. Jahrhunderts, die sich nicht nur mit der Querflöte selbst, sondern auch mit allgemeinen Fragen des musikalischen Geschmacks, der musikalischen Bildung und der Aufführungspraxis befasst. Sie gilt als eine der wichtigsten Quellen für die Musik und die Musikanschauung des deutschen Rokokos.
Welche Themen behandelt Quantz in seiner Flötenschule?
Die Flötenschule behandelt eine breite Palette von Themen, darunter die Geschichte der Flöte, die Haltung und Fingertechnik, die Tonleiter, den Ansatz, die Notation, den Gebrauch der Zunge, die Atmung, Vorschläge, Triller, die Übungspraxis, den guten Vortrag im Singen und Spielen, das Allegro, das Adagio, Kadenzen und die Pflichten der Begleitmusiker.
Welche Bedeutung hatte Quantz für die Traversflöte?
Quantz trug maßgeblich zur Entwicklung der Traversflöte bei. Er erfand unter anderem den Aus- und Einschiebekopf, der eine einfache Stimmungsänderung ermöglichte. Seine Flötenschule war richtungsweisend für nachfolgende Werke und beeinflusste Generationen von Flötisten.
Welchen Einfluss hatte Friedrich II. auf Quantz' kompositorisches Schaffen?
Friedrich II. hatte einen bedeutenden Einfluss auf Quantz' kompositorisches Schaffen. Da sich die musikalischen Vorlieben des Königs nicht änderten, stagnierte auch die kompositorische Entwicklung von Quantz. Seine Sonaten waren weniger persönlich und weniger anspruchsvoll als die von C. Ph. E. Bach, da Friedrich eher schmeichelnde und heitere Melodik bevorzugte.
Was war Quantz' Verhältnis zu Friedrich II.?
Quantz hatte ein enges und vertrauensvolles Verhältnis zu Friedrich II. Er war nicht nur sein Flötenlehrer, sondern auch ein geschätzter Freund und Berater. Friedrich respektierte Quantz' Urteil und nahm seine Kritik an.
Welche musikalischen Stile beeinflussten Quantz?
Quantz wurde von verschiedenen musikalischen Stilen beeinflusst, darunter der italienische Stil (insbesondere Vivaldi), der französische Stil und der deutsche Kontrapunkt. Er strebte nach einer Verschmelzung dieser Stile zu einem "gemischten Geschmack".
Was sind die Hauptteile von Quantz' Flötenschule ("Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen")?
Die Flötenschule gliedert sich in folgende Hauptteile: Vorrede, Einleitung, 18 Hauptstücke mit verschiedenen Themen von der Geschichte und Konstruktion der Flöte bis hin zu musikalischen Ausführungen und dem richtigen Auftreten eines Musikers, Register der vornehmsten Sachen, und Grempel zu Johann Joachim Quantzens Versuch einer Anweisung die flöte traversiere zu spielen. Auf XXXIV. Kupfertafeln.
Worauf legte Quantz in Bezug auf den musikalischen Vortrag Wert?
Quantz legte großen Wert auf einen deutlichen und ausdrucksstarken Vortrag. Er verglich Musik und Rhetorik und forderte, dass der Musiker die in der Musik innewohnenden Gedanken verständlich machen solle. Er erwartete vom Instrumentalisten, dass er dem Sänger nacheifere.
Was versteht Quantz unter "gemischtem Geschmack"?
Quantz versteht unter "gemischtem Geschmack" eine Verschmelzung des italienischen und des französischen Stils mit dem "gearbeiteten Stil" der deutschen Kontrapunktik. Er wollte italienische Verzierungskunst, französische Architektur und Rhythmik mit der deutschen Kontrapunktik zu einem neuen Stil verbinden.
- Quote paper
- Carmen Berngruber (Author), 2001, Johann Joachim Quantz, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/101446