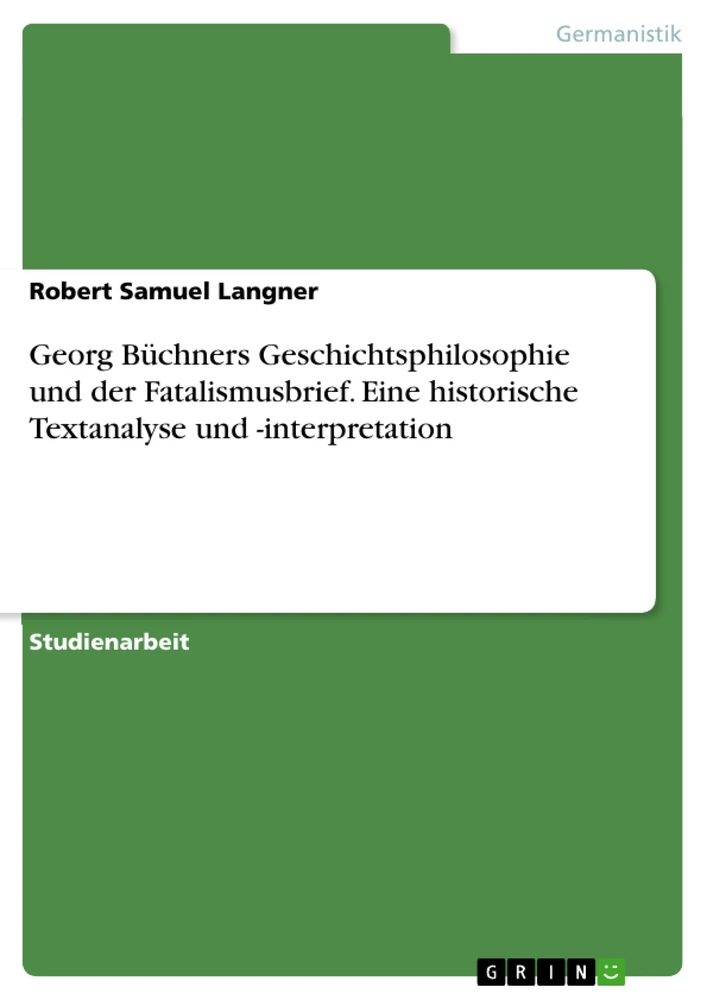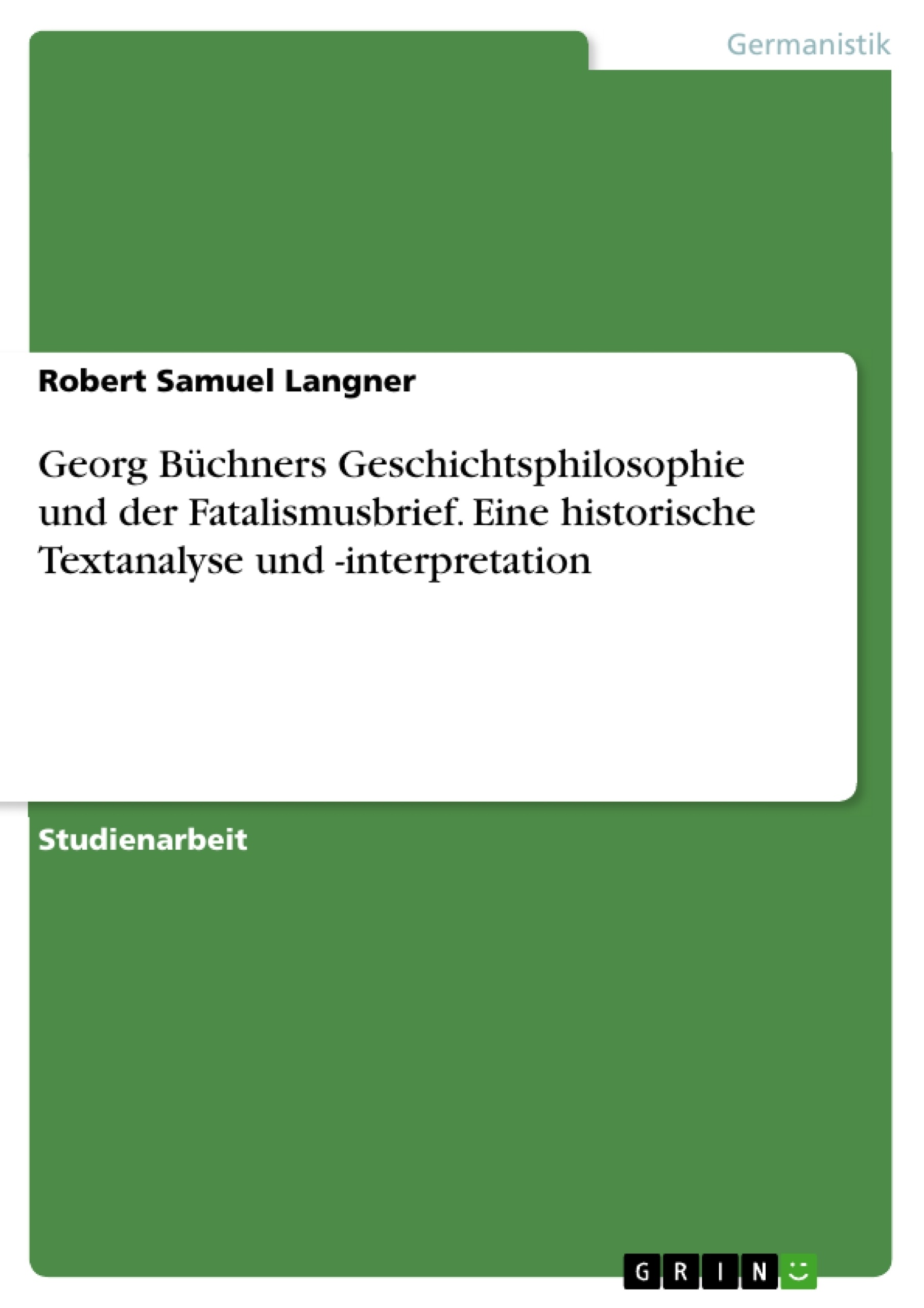In der vorliegenden Seminararbeit soll der Frage nach der geschichtsphilosophischen Ausrichtung beziehungsweise Weltanschauung Georg Büchners nachgegangen werden. Im Zentrum der Überlegungen steht der vielzitierte und in der deutschen Literaturwissenschaft überaus kontrovers diskutierte Fatalismusbrief.
War Büchner ein sogenannter harter Determinist, der sich in einem historisch vorbestimmten Ablauf eines schicksalhaften Zeitstrahls der Geschichte wähnte, dem es sich nicht entziehen lässt? Oder sind die Äußerungen Georg Büchners bloß als ein Ausdruck einer Momentaufnahme seiner Psyche zu verstehen? Sind sie Ausdruck einer vorübergehenden persönlichen oder womöglich politischen Resignation, wenn nicht sogar einer psychopathologischen Depression?
Um sich diesen Fragestellungen differenziert, kritisch und wissenschaftlich fundiert nähern zu können, ist es notwendig den Brief nicht nur literaturwissenschaftlich zu betrachten. Man muss ihn quellenkritisch in seinen historischen Kontext einbetten sowie die Biografie und Persönlichkeit Georg Büchners einordnen.
Das nachdenkliche Schreiben, das später als sogenannter Fatalismusbrief zu Bekanntheit kommen sollte und Stoff weitreichender Debatten unter Germanisten auf der ganzen Welt geworden ist, lässt augenscheinlich auf ein insgesamt fatalistisches Weltverständnis Büchners schließen. Jedenfalls handelt es sich um ein starkes Indiz, welches eine deterministische Auffassung Büchners zu Geschichtsphilosophie und Gesellschaftstheorie untermauern würde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Büchners Fatalismusbrief als historisch Quelle und seine kontextuelle Einordnung
- 2. Büchner war Fatalist
- 3. Büchner war kein Fatalist
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die geschichtsphilosophische Ausrichtung Georg Büchners und analysiert dabei den vielzitierten Fatalismusbrief. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Büchner ein harter Determinist war, der an einen vorbestimmten Verlauf der Geschichte glaubte, oder ob seine Äußerungen eher Ausdruck einer vorübergehenden persönlichen oder politischen Resignation waren.
- Der Fatalismusbrief als Quelle für Büchners Weltanschauung
- Die historische Einordnung des Fatalismusbriefes
- Kontroversen und Interpretationsansätze zum Fatalismusbrief
- Büchners Lebensumstände und seine psychische Verfassung im Kontext des Briefes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor, die sich um Büchners Weltanschauung und die Interpretation des Fatalismusbriefes drehen. Der Brief wird als zentrales Element der Analyse vorgestellt und die Problematik der verschiedenen Deutungen aufgezeigt.
1. Büchners Fatalismusbrief als historisch Quelle und seine kontextuelle Einordnung
Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung und historischen Einordnung des Fatalismusbriefes. Es wird auf die Überlieferungsgeschichte und die zeitlichen Umstände eingegangen, um die Bedeutung des Briefes für das Verständnis von Büchners Denken besser zu beleuchten.
2. Büchner war Fatalist
[Zusammenfassende Darstellung der Argumente und Schlussfolgerungen des Kapitels, ohne spoilerige Details oder konkrete Schlussfolgerungen.]
3. Büchner war kein Fatalist
[Zusammenfassende Darstellung der Argumente und Schlussfolgerungen des Kapitels, ohne spoilerige Details oder konkrete Schlussfolgerungen.]
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Georg Büchner, Fatalismusbrief, Geschichtsphilosophie, Determinismus, Weltanschauung, Interpretationsansätze, Quellenkritik, Biografie, politische und soziale Kontext, psychische Verfassung, Radikalismus, Literaturwissenschaft, Historische Einordnung.
- Quote paper
- Robert Samuel Langner (Author), 2017, Georg Büchners Geschichtsphilosophie und der Fatalismusbrief. Eine historische Textanalyse und -interpretation, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1013095