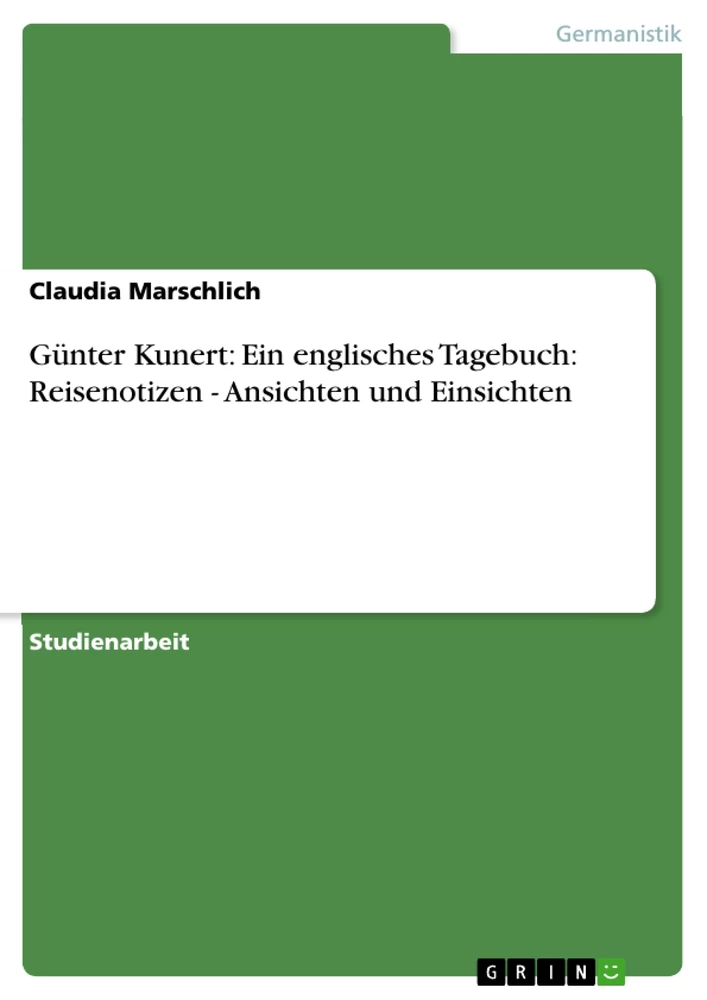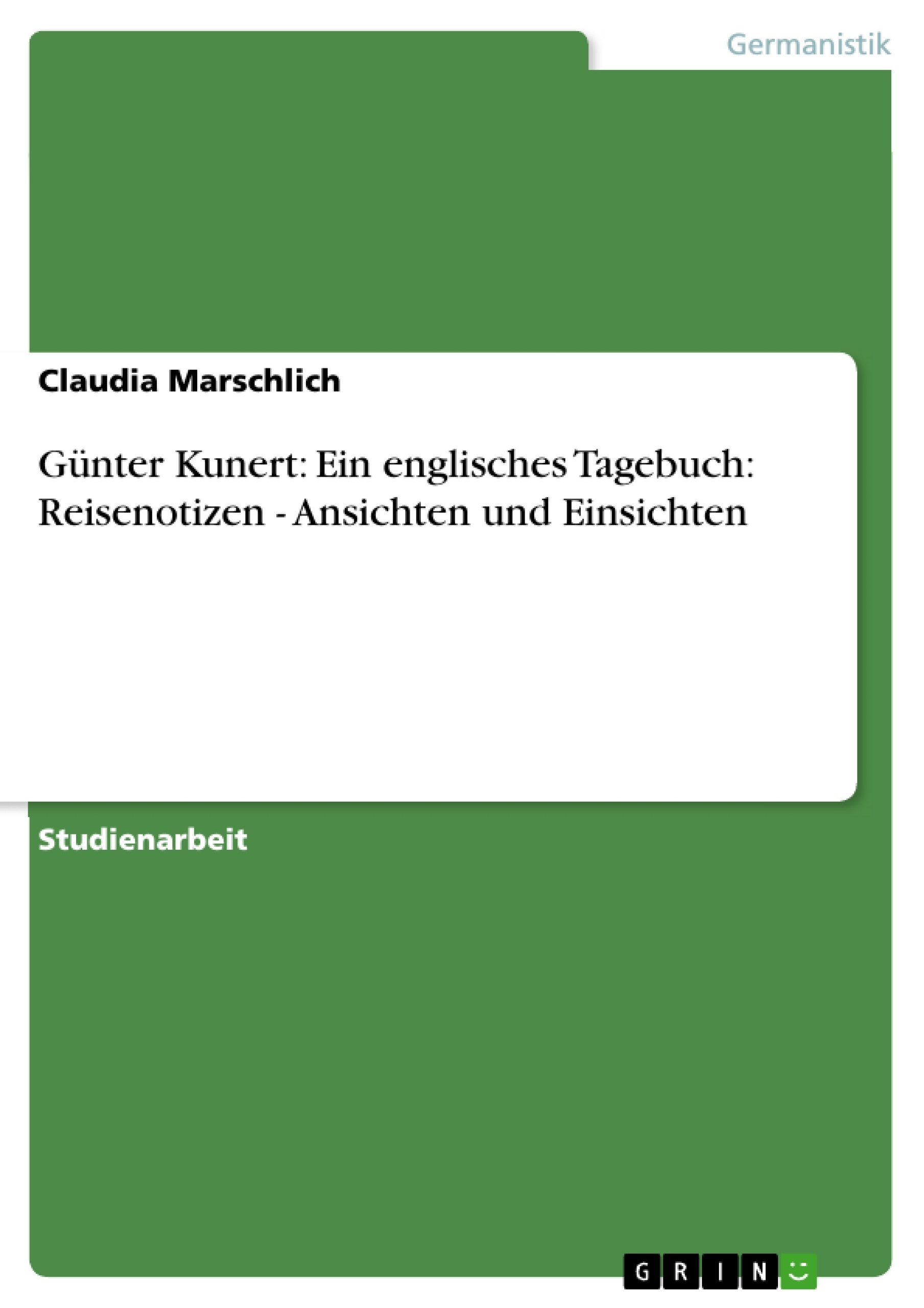Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Biographischer Exkurs
3. Das Tagebuch als literarische Form
4. Äußerer und innerer Rahmen?
4.1. Englandbild
4.1.1. (Ein) Kulturbild ?
4.1.2. Stadt- und Landschaftsbilder
4.1.3. Geschichtsphilosophischer Exkurs W. Benjamin
4.1.3.1. Verbindung zu Günter Kunert
4.1.3.2. Auswirkungen des Exkurses
4.2. Spielzeugmanie?
4.3. Kälte und Krankheiten
5. Schlussbemerkung
6. Bibliographie
1. Einleitung
Der Schriftsteller Günter Kunert begann Anfang der 50er Jahre mit seiner schriftstellerischen Arbeit. Seine Werke beschäftigen sich mit seiner Vergangenheit, da er seine in der Kindheit geprägten Erfahrungen als Halbjude mit dem Krieg und dem Hitlerregime nicht vergessen kann. Er beschäftigt sich jedoch auch mit Problemen der Gegenwart, d.h. seinem Leben in der DDR 1, und richtet seinen Blick in die Zukunft, in welcher die Menschheit, seiner Auffassung nach, in eine unausweichliche Katastrophe treibt. In seinen Werken will er appellieren, aufklären, warnen, bewusst machen und zur Selbsterkenntnis auffordern. „Kunert versteht sich als Wegweiser für die Zukunft, aber auch - angesichts der faschistischen Vergangenheit - als Warnung und Appelle an die Gegenwart.“ 2
Sein aufklärerisches Bewusstsein verbindet sich mit der Aufgeschlossenheit gegenüber Fremden und der Fremde, was sich in zahlreichen Texten äußert. Sein Literaturverständnis ist Motiv zum Reisen; seine persönliche Neugier auf Leben, Bewegung und Selbstfindung führen ihn zu Reisen, die er literarisch reflektiert. Die literarische Bearbeitung der Reisen erfolgte größtenteils in Gedichtbänden, aber auch in kurzen Prosastücken (Ortsangaben), erzählender Prosa (Gast aus England), ‚konventioneller’ Reiseliteratur (Der andere Planet. Ansichten von Amerika) und als Diarium (Ein englisches Tagebuch).
Reisen sind für ihn Versuche, sich dem zu nähern, was ihm fremd und unbekannt erscheint. Gleichzeitig sucht er beim Reisen nach Vertrautem in der Fremde (Kunert vergleicht die englische Stadt Warwick oft mit Berlin). Auf Reisen verspürt der Erzähler das Verlangen, am Vergangenen festzuhalten, ersichtlich in seinen Appellen und Warnungen vor dem Krieg, hervorgerufen durch seine Erinnerungen an seine Jugend. Andererseits führen seine Reisen auch dazu, den angeblichen historischen Fortschritt kritisch zu hinterfragen, was zum Beispiel in seinen Beschreibungen von Städten deutlich wird. Seine Literatur scheint daher eine Rückkehr zu Fixpunkten einer Vergangenheit zu sein, die dem Fortschritt unterworfen ist, dem gegenüber sich der Mensch als ohnmächtiges Objekt empfindet: „Die scheinbare Freiheit des Reisenden bleibt Einflüssen unterworfen, die er bestenfalls durchschauen, aber kaum je zu beeinflussen vermag.“3
Mit seinen Reiseberichten will er automatisierte Erfahrungen von Orten und Landschaften aufbrechen, d.h. das Andere und Fremde wahrnehmen und sich selbst in solchen Begegnungen begreifen und neu bestimmen.4 „Erst in der sogenannten Fremde“, bemerkt Kunert, „ erfährt man, wer man eigentlich ist und was man eigentlich darstellt.“5 Der Aufenthalt in der Fremde dient der Identitätsfindung, die Reflexion des Fremdbilds ermöglicht eine Reflexion des Selbstbildes.
Im Englischen Tagebuch reflektiert Günter Kunert seinen zweimonatigen Aufenthalt in Warwick, England. Diese Reflexion vollzieht sich, so meine These, in einem äußeren und inneren Rahmen. Kunert begreift demnach nicht nur die fremde Umwelt, sondern erlebt eine nachträglich formulierte Erkenntnis über sein Selbst- und Weltbild, bezogen auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Diese These soll im Folgenden anhand von Beispielen belegt werden, wobei der Prozess des Verfalls unserer Gesellschaft eine wesentliche Rolle spielt. Ferner werde ich auf Kunert und dessen Wahl der literarischen Form ‚Tagebuch’ eingehen.
2. Biographischer Exkurs
Im Englischen Tagebuch reflektiert Kunert - wie bereits erwähnt - sowohl seine Außenwelt als auch sich selbst. Um diese Reflexion zu verstehen, ist es wichtig, einige biografische Eckdaten Günter Kunerts zu kennen.
Günter Kunert wurde am 6. März 1929 in Berlin geboren. Da seine Mutter Jüdin war, bestand für ihn nach dem Besuch der Volksschule keine Weiterbildungsmöglichkeit. 1943 arbeitete er als Lehrling in einem Bekleidungsgeschäft. Aufgrund seiner Abstammung erklärten die NS Behörden ihn als ‚wehrunwürdig’. Bei Kriegsende war Kunert 16 Jahre alt und begann an der Hochschule für angewandte Kunst in Berlin- Weißensee Grafik zu studieren. Nebenher arbeitete er für die Zeitschrift „Ulenspiegel“. Sein Eintritt in die SED erfolgte 1948. Zwei Jahre später wurde er von Johannes R. Becher entdeckt. Zu seinem geistigen Mentor wurde Bertolt Brecht, den er 1950 erstmals traf. Kunert schrieb Texte für das Radio, Beiträge für Film und Fernsehen, Opernlibretti und Prosa. Hauptsächlich wandte Kunert sich jedoch in diesen frühen Jahren der Lyrik zu. Seit 1965 verstärkte sich die Kritik an Kunert im Rahmen kulturpolitischer Debatten. Kunert, seine Parteizugehörigkeit in Frage stellend, begann sich häufiger im Ausland aufzuhalten.
Eines seiner Reiseziele war England. Sein erster kurzer Englandaufenthalt im Herbst 1965 führte ihn zum Literaturfestival in Cheltenham Spa. Es folgte ein zweiter kurzer Aufenthalt 1971. Auf seiner Reise 1965, auf welche er auch im Englischen Tagebuch immer wieder zurückgreift, war er begeistert von der Insel, von der ungebrochenen Tradition. Die Auszeichnung, als ‚Writer-in-Residence’ (Stadtschreiber) an der Warwick-Universität zu arbeiten, nahm er dankend an und genoss einen zweimonatigen Aufenthalt im Winter 1974/75 mit seiner Frau Marianne. Sie lebten in Warwick und besuchten auf kurzen Reisen London, Birmingham, Brighton und Stonehenge.
Aus dieser zweimonatigen Reise resultierten 13 englische Gedichte und retrospektiv ein Tagebuch (erschienen 1978). Im Rahmen dieser Hausarbeit möchte ich mich nur auf Kunerts Englisches Tagebuch beziehen.
3. Das Tagebuch als literarische Form
Tagebücher sind tägliche bzw. regelmäßige Aufzeichnungen von Erfahrungen, Beobachtungen, Ereignissen, Gedanken und/ oder Gefühlen. Datums- und Ortsangaben setzen die einzelnen Eintragungen voneinander ab. Die Distanz zum Gegenstand ist gering und der Charakter der Aufzeichnungen monologisch.6 Das Tagebuch richtet sich im Unterschied zum literarischen Tagebuch an keinen Rezipienten.
Im Englischen Tagebuch als literarischem Tagebuch finden sich diese Merkmale der Definition. Der Autor Günter Kunert ist Ich-Erzähler und schildert autobiographische Begebenheiten. Er ist zugleich die literarische Hauptfigur, und Teilnehmer am Geschehen. In monologischer Form gibt er seine subjektiven Eindrücke über äußere und innere Ereignisse des eigenen
Lebens wieder. Wie im Tagebuch folgt die Erzählung einer Chronologie. Er reflektiert somit nicht nur die literarischen, politischen, gesellschaftlichen, philosophischen, wissenschaftlichen, usw. Phänomene seines Umfelds, sondern nutzt die Beschreibung der äußeren Ereignisse monologisch für eine Reflexion und Durchleuchtung des inneren ‚Ichs’.
Kunerts Aufzeichnungen beziehen sich auf vergangene, gegenwärtige und zukünftige Reflexionen des ‚Ich’, was in den nachfolgenden Kapiteln verdeutlicht wird. Das ‚Ich’ gilt als literarischer Mittelpunkt im Englischen Tagebuch. Um es herum werden Ereignisse, Beobachtungen und Erlebnisse wahrgenommen und reflektiert. Somit bietet die literarische Form „Tagebuch“ auch hier einen äußeren (Lebensumstände) und einen inneren (Reflexion) Rahmen. Die äußeren Ereignisse geben Impulse zur inneren Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen und eigenen Wirklichkeit, was den inneren Rahmen bildet. Bezüglich der Reflexion ist zu bemerken, dass Kunert das Tagebuch erst 1978, also drei Jahre nach seiner Reise, geschrieben hat. Zu vermuten ist, dass er während seiner Reise Notizen und Stichpunkte angefertigt hat. Eine nachträgliche Bearbeitung (Reflexion) ist im Text selbst zu erkennen. Zum Beispiel:
Noch ahnt keiner von uns beiden, nicht wahr, Marianne, dass dieser eisige Anhauch, dem unser Frösteln antwortet, erst der Beginn eines häufig sich wiederholenden physikalischen Dialogs wäre, bei dem wir stets die Unterlegenen, nämlich erbärmlich Frierenden sein werden. 7
An den Worten „noch ahnt keiner von uns beiden“ oder „erst der Beginn eines sich häufig wiederholenden physikalischen Dialogs wäre“ ist zu erkennen, dass er in gegenwärtigen Situationen schon zukünftige Vorhersagen trifft, welches die retrospektive Bearbeitung des Tagebuchs verdeutlicht.
Aufgrund dieser retrospektiven Reflexion widerspricht das Englische Tagebuch in einem Merkmal obiger Definition, denn der Text ist stark durchstrukturiert. Kurze Sätze oder einzelne Wörter lenken den Leser an die Zielorte und Personen, z.B. „Bill.“, „Und Bill?“, „Mit Bill ins Krankenhaus.“8 oder „Redruth“, „Nochmals: Redruth.“, „Rasch vorbei“, „Saint Michaels Mount“9. Diese Notizen scheinen den äußeren Rahmen zu bilden. Solchen Wegweisern, die als ‚Erinnerungspfeiler’ fungieren, folgen meist längere Passagen: bewertende Ausführungen, die versuchen, das Erlebte einzuordnen. Es sind Exkurse in die Philosophie, Wissenschaft und Psychologie. Beispielsweise bezieht sich Kunert schon im ersten Kapitel auf den Philosophen Walter Benjamin, was in Kapitel 4.1.3. ausführlicher behandelt wird. Somit ist sowohl in Form - kurze Notizen, seine Eckpunkte - als auch im Inhalt zu erkennen, dass Kunert im Nachhinein seine Erinnerungen zur Seelen- und Selbsterforschung reflektiert, oft unter dem Aspekt der Problembewältigung: „Die während der Reise gemachte Beobachtung wird zum Anlass, sich zu erinnern und solche Erinnerungen literarisch verbindlich zu bewältigen.“10
Insofern ist das Englische Tagebuch nicht nur eine sozialkritisch motivierte Reaktion auf äußere Umstände, sondern auch eine innere Auseinandersetzung mit dem Erlebten, ein Weg zu sich selbst. Das Tagebuch erscheint als ein Spiegel der inneren Biographie und der eigenen Zeitverhältnisse: Eine Zusammensetzung aus Bericht und Reflexion, Bild und Erkenntnis.11
4. Äußerer und innerer Rahmen?
Wie bereits erwähnt, ist Beschriebenes nicht etwa als journalistischer Kommentar zum Fremden (äußerer Rahmen), sondern als Reflexion zum Selbst- und Weltbild von Günter Kunert (innerer Rahmen) zu sehen. Er durchlebt verschiedene Phasen in der Auseinandersetzung mit dem Fremden und reflektiert diese Erfahrungen in der literarischen Form ‚Tagebuch’. „Wo die äußerliche Bewegung zum Stillstand gekommen ist, beginnt die Reise durch den Text - zunächst im Kopf und dann auf dem Papier.“12 Im Folgenden soll dies anhand seiner Eindrücke über England, seiner Spielzeugmanie, seinem Kälte- und daraus resultierenden Krankheitsempfinden näher erläutert werden. Ferner wird der Zusammenhang des Englischen Tagebuchs mit dem Philosophen Walter Benjamin dargestellt.
4.1. Englandbild
4.1.1. (Ein) Kulturbild ?
Im äußeren Rahmen beschreibt Kunert seinen Aufenthalt in England negativ, denn der Leser erhält ein deprimierendes Bild Englands. Die von Kunert erlebte ‚verfallende’ Kultur Englands zeigt sich sowohl in der Beschreibung der Städte und Landschaften, als auch in der Schilderung der schlechten Behausung, Verpflegung, des Klimas, generell im ‚grauen’ Alltag der Kunerts: „[Das Englische Tagebuch ] liest sich als ein Kompendium all der tagtäglichen Missgeschicke, die dem Fremden in einem Land drohen, das aus einer Unzahl schlechtbeheizter Herbergen, regennasser Straßen und ständig streikender Bus- und Eisenbahnlinien zu bestehen scheint“.13 In alltäglichen Situationen tritt der Traditionsverfall hervor: Zwar sei die Qualität etwa der Speisen immer noch vorhanden, aber der schlechte Service verstärke das ‚verfallende England’: „Die großen Kulturen bröckeln eben immer von den Rändern her ab“.14
Laut Baron ist Kunerts Englandbild stark durch seine Phantasie geprägt und wirkt dadurch oft unreal und kurios. Es herrsche ein klaffender Widerspruch zwischen Reisedarstellung und Realität.15 Unstrittig ist, dass Kunert ein negatives Englandbild zeichnet. Die Gründe dafür können jedoch auch im Kontext von Kunerts Auseinandersetzung mit dem Fremden interpretiert werden. Wie jeder Reisende hatte Kunert gewisse Vorstellungen vom fremden Land. Sein erster Besuch führte zu emphatischen Beschreibungen, denen dann - während des zweiten Besuchs - eine Desillusionierung folgte. Es scheint demnach, dass Kunerts Reaktionen auf vorher nur flüchtig Gekanntes und Betrachtetes seinen zweimonatigen Aufenthalt beeinflussten, da seine ablehnenden Darstellungen sich nicht nur auf London beziehen, sondern auch auf das restliche England. Unter Einbeziehung des ‚Kulturschockphänomens’, nach welchem Kunert möglicherweise ein anderes - intensiveres und dadurch vielleicht negativeres - Englandbild erfährt als bei seinen ersten Besuchen in England, wäre diese Kritik verständlich. [Das Phänomen Kulturschock näher zu durchleuchten, wäre ein weiterer Interpretationsansatz, den ich im Rahmen dieser Hausarbeit nicht verfolgen möchte.] Jedoch bezieht sich die Kritik meiner Meinung nach nur auf den äußeren Rahmen und ist daher zu oberflächlich gefasst. Kunert hat - wie schon erwähnt - das Tagebuch erst später verfasst. Seine Reiseeindrücke und seinen Tagesablauf schreibt er eben nicht auf Ansichtskarten oder in einem Reiseführer, sondern beschrieben werden innere Eindrücke, verpackt in einer äußeren Hülle. Kunert erlebt während seines Aufenthaltes mehrere Missgeschicke, welche generell den Prozess des Verfalls widerspiegeln. Kunert verweist auf England als Land des Ursprungs der industriellen Revolution. 1965 war er begeistert von den traditionsreichen Plätzen und deren Erhaltung, 10 Jahre später schildert er England als verfallendes Industrieland, als Land von verlorener Größe16. Dies ist an der Beschreibung Londons erkennbar: „Ich war in zwei verschiedenen London.“17 1965 war er vom Tower und Soho noch begeistert, nahezu fassungslos und von jedem Stein angesprochen, aber 1974 fand er den „Zauber des Ortes verschwunden...“.18 Es scheint, als wolle Kunert an der Vergangenheit festhalten und als könne er eine Ausbreitung der Modernisierung nicht akzeptieren. Er sagt über Soho: „Dieser winzige Distrikt ist überhaupt nicht mehr identisch mit meinem Soho von 1965.“19. Kunert lehnt den mit der industriellen Revolution verbundenen rasanten Fortschritt und die Traditionsfeindlichkeit der Gegenwart ab. Er appelliert an eine Rückbesinnung auf die Natur, vergleicht vom Menschen Geschaffenes und Ursprüngliches.
4.1.2. Stadt- und Landschaftsbilder
Der von Kunert angesprochene Prozess des Verfalls spiegelt sich auch in dem ständigen Vergleich der düsteren Stadtlandschaften und der Natur wider, wobei die Beschreibung von Städten und Landschaften meistens mit kultur- und geschichtsphilosophischen Ausführungen kombiniert ist20: Die Dörfer der Cotswolds sind „mürbe“ geworden, Stratford ist durch den Tourismus ruiniert, Birmingham durch die Stadtrenovierung: Das „Zentrum [ist] von niederschmetternder Modernisierung, nämlich kastenförmig, einfallslos, menschenfeindlich und deprimierend eckig [...] Nichts als kubisch gehöhlter Zement, Stockwerke, Läden, Büros, Gräue, vom schwärzendem Regen mit finsteren Rinnsalen versehen.“21 Ergänzt werden diese Darstellungen durch seine Ausführungen über die Natur in England. „Die Bäume auf dem Campus der Universität sind ‚verkrüppelt’, in Birmingham gibt es nur Unkraut, in Blists Hill lediglich ‚magere Bäume’ [...]“.22 Dies deutet in erster Betrachtung auf eine eher unrealistische Darstellung Englands, jedoch ist es keine explizite Darstellung von Realität, sondern weist auf eine innere Problembewältigung Kunerts hin, die es nun kurz zu erörtern gilt.
Kunert zeigt im Englischen Tagebuch verschiedene Stadtbilder Englands. Die Stadt erhält nahezu Symbolcharakter, dient als Zeuge der Kultur. Sie ist Erbe der Vergangenheit, der Hort der Zivilisation und wird häufig auf die Heimat bezogen23: „Das Stadt-Motiv [...] bedeutet also von Beginn an eine Auseinandersetzung mit der kulturellen und zivilisatorischen Leistung des Menschen.“24 Die eher negative Darstellung der Stadt- und Landschaftsbilder im Englischen Tagebuch beschreiben demnach einen allgemeinen Verfallsprozess. Alte Häuser wurden abgerissen, um neuen Platz zu schaffen. Durch die Traditionsfeindlichkeit der Gegenwart geht das Erbe der Vergangenheit verloren. Hier sieht Kunert seinen Platz als Schriftsteller. Für ihn hat Literatur einerseits eine persönliche Funktion: die einer individuellen Kompensation, um selbst mit den Widrigkeiten des Lebens zurecht zu kommen. Andererseits dient sein Schreiben der literarischen Sicherung von Kulturstätten, die der Modernisierung unaufhaltsam zum Opfer fallen. Das Englische Tagebuch ist ein literarisches Werk, „dass die konkrete Beobachtung eines bestimmten Realitätsausschnittes mit geschichtlicher Einordnung und philosophischer Reflexion verbindet, ihn so aus seiner Isolation reißt und ihm eine allgemeine menschliche Bedeutung verleiht.“25 Das Motiv ‚verfallendes England’ hängt demnach mit dem Weltbild Kunerts zusammen, welches im Folgenden durch einen kleinen Exkurs zum Philosophen Walter Benjamin näher belegt werden soll.
4.1.3. Geschichtsphilosophischer Exkurs W. Benjamin
Im folgenden Exkurs soll kurz dargelegt werden, warum Kunert sich auf den Philosophen Walter Benjamin bezieht und welche Kernaussagen von Benjamins Thesen auch in Kunerts Denken eine große Rolle spielen.26
Walter Benjamin lebte Anfang des 20. Jahrhunderts und gilt neben Theodor W. Adorno als einer der wichtigsten Philosophen dieser Epoche. Seine Theorien, die offene Interpretationsansätze zulassen, beschäftigen sich unter anderem mit dem ‚zirkulären’27, immer wiederkehrenden Geschichtsprozess, mit der technischen Reproduktion und dem damit verbundenen Verfallsprozess sowie mit Phänomenen der Massenkultur. Walter Benjamin war Kritiker klassischer und moderner Literatur sowie Vorläufer der Frankfurter Schule, deren sozialphilosophischen Grundgedanken in seinen Theorien angelegt sind. Die Vertreter der Frankfurter Schule, von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer begründet, versuchten, die politische Ökonomie von Marx mit der Psychoanalyse von Freud zu einer ‚kritischen Theorie’ über die kapitalistische Gesellschaft zu verbinden.28
Günter Kunert verweist kontinuierlich im Englischen Tagebuch auf Walter Benjamins Thesen und bedient sich dessen Sichtweise. Biografische Gemeinsamkeiten verbinden Günter Kunert und Walter Benjamin: Benjamin ist wie Kunert jüdischer Herkunft, gebürtiger Berliner und ein guter Freund Bertolt Brechts. Kunert bezeichnet Benjamin im Englischen Tagebuch als „... [seinen] unsichtbaren Weggenosse[n] und Stadtführer...“.29 Laut Benjamin ist die Geschichte „[...] ‚nicht als Prozess eines ewigen Lebens, vielmehr als Vorgang unaufhaltsamen Verfalls’ zu verstehen“.30 Er prognostiziert ein Abgleiten der welthistorischen Praxis in ein affirmatives Fortschrittsvertrauen, das in der Katastrophe mündet. Benjamin übt Kritik am leeren Fortschritt sowie Zweifel am Materialismus. Benjamin sieht Massenkultur und die von ihr verbreiteten Mythen als Ursprung einer ‚Bewusstseinsvernebelung’, aber auch als mögliches Erwachen. Mythenbesetzte Städte (wie London oder Berlin) verschwinden zugunsten einer Anhäufung durchrationalisierter und durchgestylter Leere, denn nichts Gealtertes entgeht mehr der Alternative, entweder durch Vernichtung oder Überkonservierung liquidiert zu werden.31
4.1.3.1. Verbindung zu Günter Kunert
In vielen seiner literarischen Werke setzt sich Kunert mit Walter Benjamins Gedanken eines ‚zirkulären’ Geschichtsprozesses und des Endzeitbewusstseins auseinander. Kunerts Absage an Fortschrittsglauben und Geschichtsoptimismus, die für ihn Reflex der Isolation, Angst und Ohnmacht des modernen Menschen sind, prägen seine schriftstellerische Arbeit besonders in den 70ern und zu Beginn der 80er Jahre.32 Im Englischen Tagebuch äußert sich Kunert dazu folgendermaßen:
Geschichtspessimismus? Kaum. Weil ich kein Telos der Geschichte erkenne, so dass mir auch ihr Aussetzen weniger fürchterlich vorkäme als ihr immer härterer ‚eiserner Schritt’, Fortschritt geheißen. Brechts dialektischer Witz, es käme nicht darauf an, fortschrittlich zu sein, sondern fortzuschreiten, leidet am Einverständnis mit der Welt, da auch er nicht fragt: ‚Wohin?’33
Demnach deutet der Widerspruch zwischen technischem Vermögen und den sozialen Bedingungen der menschlichen Existenz auf einen unaufhaltsamen Prozess des Verfallens sowohl in der Vergangenheit, der Gegenwart als auch in der Zukunft. Laut Kunert führt der zunehmende Fortschritt zu permanentem Scheitern und endet unvermeidbar in Katastrophen.
Ferner nimmt Kunert Bezug auf Benjamins Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“, in welchem Benjamin einen „Zusammenhang zwischen dem Verlust der Einmaligkeit eines Kunstwerks durch moderne Vervielfältigungstechniken und der Chance einer dadurch ausgelösten emanzipatorischen Politisierung der Massen“34 herstellt. Dennoch birgt ein Kunstwerk ein utopisches Potenzial. Kunert zeigt die Dialektik von Kunst („Sensibilität“35 ) und technischer Reproduktion („Unmenschlichkeit“36 ) auf. Dieses bipolare Verhältnis sei nur durch die Kunst überbrückbar, denn „Das einzige Gesetz der Geschichte ist ihre Vergänglichkeit und Unbeständigkeit.“37 Kunert verweist auf die Notwendigkeit und Voraussetzung dieses Spannungsfelds, um kreativ wirken zu können:
Dass Sensibilität und Unmenschlichkeit einander ausschließen, glaubt nur der Köhler. Zu fragen ist eher, inwieweit solch Spannungsbogen in einem Menschen notwendige Voraussetzung für seine Kreativität ist, denn das Bemühen, die inneren Extreme zu überbrücken oder miteinander in Einklang zu bringen, vollzieht sich nur im Bereich der Kunst. Sehr wahrscheinlich, dass dort, wo dieses bipolare Verhältnis schwindet oder abgebaut ist, kaum noch schöpferische Tätigkeit sich vollzieht. Die übermenschliche Anstrengung, produktiv die Gegensätze in sich selber auszugleichen, lässt nach, sobald sie einander sich annähern. Die Balance zu erhalten, ist Kunstausübung erforderlich.
... Individuen und Gemeinschaften, durch eine wie immer geartete Therapie ihrer inneren Spannungen beraubt, sind nicht die schöpferischsten. Soweit die Diagnose.“38
4.1.3.2. Auswirkungen des Exkurses
Zu erwähnen ist, dass Benjamins Theorien in der DDR nicht zugänglich waren, da sie im Kontrast zum propagierten Geschichtsoptimismus der DDR standen. Günter Kunerts Auseinandersetzung mit den Thesen Walter Benjamins im Englischen Tagebuch und seine Übereinstimmung hinsichtlich des zwangsläufigen Verfalls (Geschichtspessimismus) wirkten demnach provozierend. Die offizielle Kritik warf Kunert seit Mitte der 60er Jahre vor, insbesondere in seinen Gedichten den Geschichtsprozess zu mystifizieren und allzu sehr einem ‚mechanischen Materialismus’ zu huldigen39. Mit Kunerts Ablehnung der Ausbürgerung Wolf Biermanns verstärkte sich die Kritik an Kunert Ende der 70er Jahre. Ihm wurde nachgesagt, den gesellschaftlichen Verfall Benjamins auf den Zerfall der DDR zu übertragen. Auch die Kritiker Bullivant und Baron behaupten, dass Kunerts zunehmende Abkehr vom Marxismus seinen zunehmenden Kultur- und Geschichtspessimismus hervorrufe40, und, dass er seine Enttäuschung am realen Sozialismus somit auf die gesamte Weltgeschichte projiziere. Es wird suggeriert, dass es nicht um England als solches geht, sondern um Problematiken, mit denen sich Kunert allgemein beschäftigt.41
In England als ‚kapitalistisches Ausland’ sieht Kunert den Zustand einer Kultur: Die Reisenotizen Englands könnten somit Reflexionen auf die Zustände in der DDR sein. Die eindeutige Ironie im Englischen Tagebuch bringt die höchstpersönliche, subjektive Meinung des DDR-Bürgers Kunert zum Ausdruck. Da Kunert im Englischen Tagebuch jedoch keine offene Kritik an DDR-Verhältnissen äußert, überlässt er es dem Leser (in der DDR), diese geschilderten Zustände in England auf das eigene Land zu übertragen. Somit agiert Kunert im Hintergrund der gesellschaftspolitischen Bedingungen der Entwicklung in der DDR. Eine ausführlichere Betrachtung der Reflexion der DDR Verhältnisse wäre ein weiterer Interpretationsansatz des Englischen Tagebuchs, wird im Rahmen dieser Hausarbeit aber nicht verfolgt.
Im Englischen Tagebuch zeigt Kunert rein äußerlich die Probleme der Gegenwart und seinen Umgang mit der Fremde, innerlich beschäftigt er sich durch philosophische und geschichtliche Exkurse mit dem Verfallsprozess der Menschheit. Er warnt vor der unaufhaltsamen Modernisierung, wodurch die Menschheit nicht nur die äußere Natur, sondern auch sich selbst zerstört. Als Reisender, als Fremder ist er besonders in der Lage, den Verfallsprozess in ‚Kulturländern’ wie England feststellen zu können, und gleicht diesen durch sein Schreiben aus: „Mit der Literatur will er der Welt eine zeitlang widerstehen. Er schreibt, weil er keine andere Möglichkeit für sich sieht, die Welt und sich zu bewältigen.“ 42
4.2. Spielzeugmanie?
Die einstige Weltmacht England erlebt Günter Kunert als Land des Verfalls, was sich - wie bereits erwähnt - in der Beschreibung der Städte und Landschaften sowie seiner alltäglichen Missgeschicke widerspiegelt. Kunert ist von der Vergangenheit fasziniert und auf der fortwährenden Suche nach alten Stätten, wie Ruinen und alten Häusern, und nach alten Gegenständen verlorengehender Kultur. Seine unzähligen Besuche von Trödelmärkten sind ein Beispiel dafür, dass Antikes (Altes, Vergangenes) in sich eine unwiderstehliche Faszination auf Kunert ausübt.
Seine Suche nach Vergangenheit wird auch deutlich durch seine regelmäßigen Besuche in Spielzeugmuseen und -läden (äußerer Rahmen): das Puppenmuseum in Warwick, der Spielzeugladen in Birmingham und das Spielzeugmuseum in Rottingdean. Hier findet er „[...] vordem nie erblickte Stücke aus einem Gestern, das in seinen niedrigen Erzeugnissen ein beeindruckenderes Nachleben führt als in seinen einzigen Spitzenwerken.“43 Auf den ersten Blick scheint es, als glorifiziere er die Zeit der Kindheit, in der es möglich war, sich in eine legendäre, magische Welt - die Zeit von König Artus und Zaubermeister Merlin44 - zurückzuziehen und somit die Schwierigkeiten des Lebens noch nicht erfassen zu müssen.
Einerseits kann Kunerts Suche als eine Suche nach Traditionellem in einer in ihren Entwicklungen rasant beschleunigten Welt gesehen werden. Im Benjaminschen Sinne bedeutet dies etwa, dass die Reproduzierbarkeit eines Kunstwerks diesem den Status der Einmaligkeit raubt: „Die technische Reproduzierbarkeit des Kunstwerkes ‚löst das Reproduzierte aus dem Bereich der Tradition ab’ und ‚setzt an die Stelle seines einmaligen Vorkommens sein Massenweises.’“.45 Betrachtet man jedoch Kunerts zwingende Suche und erbitterten Drang nach dem Erwerb und Besitz von Spielzeug, veranschaulicht dies eher einen biographischen Aspekt (innerer Rahmen): die Bewältigung seiner Kindheit während der Kriegszeit. Diese Zeit reflektiert Kunert im Englischen Tagebuch in einer Unfallszene mit dem Auto, der er und seine Frau Marianne unverletzt entgehen. Die Schilderung der Unfallsituation ähnelt der einer Kriegsszene, was deutlich an der Wortwahl zu erkennen ist: „[...] ich rief: ’Weg hier! Weg hier! Die zerquetschen uns!’ Liefen auch gleich panisch ein paar Schritte und vernahmen erst jetzt einen dumpfen Aufprall nach dem anderen: Auto auf Auto krachte in ungehemmter Folge in die Masse [...]“.46 Die Beschreibung dieser Szene, in der Autos aufeinanderprallen, erinnert an das Einschlagen von Geschossen während des 2. Weltkrieges. Selbst den Unfallort vergleicht er wörtlich mit einem „Kriegsschauplatz [im] Straßenverkehr“47 und mit einer „[...] Schützengraben- und Frontstimmung[...]“48. Kunert will aus der Situation ausbrechen und fragt einen Polizisten, ob er den Unfallort verlassen könne, woraufhin er zur Antwort bekommt: „If you can get rid of it?“49 (übersetzt: Wenn Sie nur davon (los)kommen können?)50. Diese Formulierung bezieht sich weniger auf den Unfall, sondern stellt eine Verbindung zur eigenen Biographie her. Diesem Appell, sich von seinen Vergangenheitstraumata zu befreien, stellt sich Kunert und beginnt auch tatsächlich sich der damaligen Kriegsgeschehnisse zu erinnern. Er schreibt:
„Noch etwas gesellte sich dazu: Eine Euphorie aus Kindheitstagen, ungebrochen, ungeschwächt von Jahrzehnten, als sei sie bisher versiegelt gewesen für diesen und bis zu diesem Augenblick, stammte aus den Stunden nach Luftangriffen, wenn man selber unversehrt durch Schauplätze infernalischer Zerstörung lief, durch brennende Straßenzüge, an rauchenden Ziegelhügeln vorüber, die eben noch Häuser gewesen; wenn man den Brandgeruch einsog, Mörtelstaub witterte, das noch lange in der Luft hängende strenge Aroma des Sprengstoffes; wenn Glassplitter unter den Schuhen knirschten, wenn man über Mauerbrocken und Holzbalken sprang, getragen von einer unbeschreiblichen Steigerung des Lebensgefühls, des Selbstgefühls, ein Rumpelstilzchen-Gefühl, als sei man direkt beteiligt an dieser massiven Vergeltung für all das, was einem angetan worden war.
Wer getroffen wurde, war sowieso schuldig. Mitleid kam nie auf, beobachtete man die Flammen, die schwarzen Brandwolken, die rotierend sich aufwärts schraubten, das unaufhörliche Niedersinken feinster Asche, schwarzer Schnee, der sich bei schweren Angriffen mit plötzlichem Regen vermischte und einem das Haar und die Schultern färbte.
Das Bedauern entstand sehr viel später.
Als dem Kind, das keines mehr war, klar ward, dass die Vernichtung der Städte samt Bewohner mehr bedeutete als die gelungene Anwendung des Prinzips: Auge um Auge... Und als die erhoffte und erwartete Gerechtigkeit, welche als einziges letztlich die Auslöschung legitimiert hätte, ausblieb und sie somit zur gigantischen Sinnlosigkeit machte. Get rid of it.“51
Diese Ausführungen enden mit dem Satz: „Get rid of it.”52, welcher eine Aufforderung an sich selbst darstellt, die Traumata einer verlorenen Kindheit endlich zu bewältigen. Er reflektiert seine Sehnsucht und seinen Wunsch nach einer sorgenfreien Kindheit, einer Kindheit ohne Überlebenskampf, einer Kindheit, in der er Kind sein konnte. Aus diesem Grund hat Kunert einen sehnlichen Drang nach Spielzeug, der an Besessenheit grenzt. Kunert erklärt im Englischen Tagebuch seine Spielzeugmanie explizit als Therapie:
„ Es ist keineswegs allein der Versuch, die verlorene Kindheit wiederzuentdecken; er enthält in tieferen Schichten vielmehr das irrationale Bedürfnis, die zeitliche Entfernung mit all dem ihr Immanenten nicht bloß zu überbrücken, sondern sogar ungeschehen zu machen. Als erwarte ich von solchem Augeblick, der alle Vergangenheit, [...] auslöschte, dass er durch körperlichen Kontakt mit dem besagten unbekannten Gegenstand eintreten würde. Eine Therapie durch Handauflegen, wobei der Patient, indem zur Sache die taktile Verbindung herstellt, diese selbst an sich verbrächte.“53
Nach der Selbstreflexion folgt das Stadium der ‚Heilung’, der Heilung von der Spielzeugmanie als symbolischer Bewältigung der eigenen Vergangenheit. Wiederum besessen davon, einen Spielzeugladen zu ‚erobern’, stellt er sich die Frage, ob er ein ‚Spielzeug-Junkie’ sei.54 Er scheint sich seiner Aufforderung „[to] Get rid of it“ zu stellen und bemerkt am Ende des Ladenbesuchs:
„Ich ging geheilt hinaus.
Nicht das Ende der Illusion beruhigte mich, sondern das einer ungestillten Sehnsucht. Ich hätte wahrscheinlich immer geglaubt, etwas ganz wesentliches versäumt zu haben, hätte ich nicht diesen Laden betreten, der durch den Schwierigkeitsgrad, in ihn zu gelangen, sein Innerstes als glorioses Heiligtum ausgeben konnte. [...] Befreit: so kam ich mir vor. Keine verpasste Gelegenheit würde mir mehr mahnend erscheinen.
Es war vorbei.“55
Hervorgerufen durch die Selbstreflexion seiner Kindheit im Krieg erfährt Kunert eine Genesung von seiner Spielzeugmanie, wodurch es ihm möglich wird, die Vergangenheit als solche zu akzeptieren. Diese Reflexion deckt aber nur einen Teil von Kunerts Konflikt mit Vergangenem auf, was im folgenden Absatz näher erläutert wird.
4.3. Kälte und Krankheiten
Das „englische“ Klima, die Kälte, wird von Kunert als größter Störfaktor seines Aufenthalts empfunden. Er verweist in nahezu jedem Kapitel darauf, so auch schon am ersten Abend:
Das Zimmer für die Nacht ist kalt; Kälte, unauffällig, aber hartnäckig wie Kriechstrom, wird zwischen Kleidung und Haut, bald Haut und Knochen wirksam, kräuselt die Epidermis, die frierende Fläche zu verringern. [...] Noch ahnt keiner von uns beiden, nicht wahr, Marianne, dass dieser eisige Anhauch, dem unser Frösteln antwortet, erst der Beginn eines häufig sich wiederholenden physikalischen Dialogs wäre, bei dem wir stets die Unterlegenen, nämlich erbärmlich Frierenden sein werden. 56
Rein äußerlich zeigt sich hier die Erwartungshaltung eines Reisenden, der Heimat und Fremde vergleicht. Im Winter ist es zwar kalt in Deutschland, aber man hat Federbetten und eine gute Heizung. Unwillkürlich geht man davon aus, dass es im fremden Land ebenso ist. Durch die konstante Wahrnehmung des Störfaktors Kälte ist er dieser und damit der Fremde, dem Land ausgesetzt. Da die Kunerts im Winter nach England reisen, möchte man meinen, sie hätten sich auf kalte Monate einstellen müssen. Kunerts immer wiederkehrenden Beschwerden über das Klima sind demnach verwunderlich, und können nicht nur als bloße Wiedergabe äußerer Umstände interpretiert werden.
Kunert bezieht die Kälte auf die Vergangenheit, auf die Zeit vor der industriellen Revolution. Wiederum reflektiert die Darstellung der Kälte Kunerts Suche nach Vergangenem, an dem er sich aber nicht ‚erwärmen’ kann, da er - wie in den vorangegangenen Kapiteln aufgezeigt - die Erinnerungen an seine Kindheit im Krieg noch nicht überwunden hat.
Günter Kunert trifft im Englischen Tagebuch auch Aussagen über die Wärme: „Brutkasten“, „Panzer“ und „unangreifbar“ 57 sind Wörter, mit denen er das/sein Wärmeempfinden beschreibt. Ein Brutkasten bietet einen künstlichen Mutterschutz, der Panzer schottet das Individuum vor unerwünschten Fremdeinwirkungen ab, und macht es dadurch unangreifbar und unverletzbar. Bildet man von diesen Begriffen Antonyme, schildern diese Kunerts gegenwärtige Befindlichkeit. Er fühlt sich schutzlos, angreifbar, ausgeliefert. Er betrachtet sich als äußerst verletzlich: So hat er zwar den Krieg überlebt, den Autounfall unverletzt überstanden, aber die Angst dem Verfall und der damit verbundenen Zerstörung ausgeliefert zu sein, macht ihn verwundbar. Die Kälte zeigt hier besonders die physische Ohnmacht des Einzelnen gegen die äußere Natur: Sein Körper wird alt und krank.
Ferner resultieren aus der Kälte seine Krankheiten: tatsächliche oder eingebildete Krankheiten stellen sich ein und lenken die Aufmerksamkeit nach innen (Selbstreflexion). Die Wärmflasche und Bettlektüre scheinen „seine einzigen Rettungsanker in diesem Meer von feindseligen Unbegreiflichkeiten“.58 Beim Versuch des ‚Erwärmens’ hat er Zeit, sich den Bedrohungen zu entziehen, sich innerlich zurückzuziehen und selbst zu reflektieren, zu philosophieren, analysieren und interpretieren.
Kunert beschreibt seine gesundheitlichen Befindlichkeit in Form detaillierten Auflistungen seiner Krankheitssymptome:
Beim Zubettgehen wiederholt sich der befürchtete Effekt. Im Schädel ein schwer zu beschreibendes Schwanken, als hätte sich das medizinisch Unmögliche ereignet und die Gehirnmasse alle Befestigungen gekappt, um an ihrem Aufenthaltsort den Körperbewegungen ihres Besitzers nicht länger zu folgen. Kreislauftablette eingenommen. Der moderne Mensch, auch wir sind welche, führt immer eine Privatsammlung von Medikamenten bei sich, um bei Bedarf der pharmazeutischen Industrie einen Dienst zu leisten.
Mitten in der Nacht rekapitulieren sich die Phänomene, und wie die Zunge, sobald einem ein Zahn gezogen wurde, mit ungezügeltem Automatismus die Lücke im Gebiß wieder und wieder abtasten muß, so bewegte ich alle paar Sekunden meinen Kopf, um das Verschwimmen des Bewußtseins erneut zu spüren. Ist das Kreislaufschwäche? Hängt es mit dem Blutdruck zusammen, und wenn: Ist er zu hoch oder zu niedrig? Oder steckt dahinter Bedrohlicheres? Reue, ob des bisherigen zu ungesund gelebten Lebens stellt sich ein, und ehe man wieder einschläft, steigert man die Willensstärke, ferner auf Genüsse (welche eigentlich) zu verzichten und statt dessen Diät zu halten.59
Neben dem eigenen Umgang mit der Kälte, sucht er auch nach Hinweisen wie sich die ‚Fremden’ (Engländer) der Kälte stellen. Er trifft auf „junge Spartaner beiden Geschlechts auf Campus“60:
Die offenen Fenster fielen mir wieder ein, als ich nach dem Seminar auf dem Gelände einem Mädchen begegnete, die dünne Jacke aufgeschlagen, darunter nichts als ein T-Shirt, denn die Brüste fuhren bei jedem Schritt auf und ab und die Brustwarzen waren stark kontrahiert vom eisigen Wind, der ihr nichts auszumachen schien, da sie in sich gekehrt vorbeiging. „Fischblütige Engländer“ - mag was dran sein, an solcher „Volksweisheit“, zumindest bestätigt sie der Augenschein. Nicht zu leugnen, dass auch der eigene körperliche Zustand, Halsschmerz und zunehmende Erkältung, besonders idiosynkratisch auf die Witterungsnegation anderer reagiert. Einzige Gegenwehr: ins Bett: die letzte Bastion vor den Widerwärtigkeiten der Welt, welche, sobald man sich in bequemer Rückenlage befindet, heißen Tee neben sich und ein interessantes Buch vor sich, Minute um Minute, Seite um Seite ferner rückt und wesenloser wird. Was leider nicht vorhält.61
Aus diesem Absatz wird ersichtlich, dass die Kälte von Kunert oft ironisch beschrieben wird: Wie kaltblütige Fische trotzen die Engländer der Kälte, während er in einem Hotel in Brighton Sorgen hegt, sich vor dem Schlafengehen völlig „zu entkleiden, aus Sorge vor den guten alten rustikalen Keimen, Tuberkeln, ehrwürdigen Bakterien, die hier gemütlich ihren Lebensabend verbringen ...“62. An anderer Stelle gesteht er der Kälte auch eine erotische Komponente zu. Er phantasiert „über das Intimleben der Studenten“63, die anders als er an der Kälte nicht erkranken, welches wiederum ein Rückbesinnen auf seine Jugend reflektiert, in der er diesem Klima auch hätte widerstehen und in ihm diese Erotik nachempfinden können.
5. Schlussbemerkung
Im Sinne meiner eingangs geäußerten These verbindet folgende Aussage im Englischen Tagebuch Kunerts äußeren Eindrücke seiner Reise mit seiner Welt- und Selbstreflexion:
So entstand das geduldigste Geschöpf auf dem Globus, das mit humorverhülltem Stoizismus ungenießbare Nahrung, trübselige Witterung, eiskalte Heime, wirtschaftliche Krise, fortwährendes versagen lebensnotwendiger technischer Einrichtungen fatalistisch hinnimmt, ja, sich möglicherweise dadurch in jene heroischen Epochen rückversetzt meint, wo alles besser und schlimmer, auf jeden Fall jedoch urwüchsiger und originaler gewesen ist. Das Grundgesetz solchen Daseins heißt: Erinnern, um zu leben.
Und wie heißt das unsere? Vergessen, um zu leben?64
Vorrangig wird im Tagebuch seine äußere und innere Reflexion über die Fremde und seine Anpassung beschrieben. Das Englische Tagebuch zeigt Kunert im Konflikt mit seiner Umwelt, der modernen, beschleunigten Welt, die zwangsläufig verfällt. Kunert will aufrütteln und mahnen, das historische und künstlerische Bewusstsein schärfen und Orientierungshilfen geben. Diese Ansinnen findet im Kontext der späten 70er Jahre in der DDR statt und fällt in eine gesellschaftliche Aufbruchstimmung in der DDR, wie kurz im Kapitel 4.1.3.2. aufgezeigt wurde. Das Heute wird immer schon auf Zukunft hin entworfen65: „Seine Texte ziehen Wirklichkeit an und stoßen sie ab; zeigen sie generell in punktuellen Aufblendungen und dunkeln sie genauso unvermittelt wieder ab. [...] Ironie, Satire, schwarzer Humor sind Haltungen, in denen er die kritische Aufarbeitung von Realität nachhaltig zu verwirklichen mag.“66 Demnach ist die literarische Tätigkeit des Autors nicht nur eine verallgemeinernde Widerspiegelung der gesellschaftlichen Prozesse und Wandlungen, sondern vielmehr Ausdruck seines individuellen Standpunktes in und zu ihnen.67
Die Reisenotizen im Englischen Tagebuch sind demnach keine Vermittlung herkömmlicher Reiseeindrücke, sondern Kunerts retrospektiv formulierte, monologische Ansichten, Beobachtungen, Überlegungen und Einsichten. Sie kennzeichnen seine Skepsis, persönliche Bedrängnis, Schwermut (Weltschmerz), und Ohnmacht gegenüber der menschlichen Zivilisation und der äußeren Natur.68 Somit scheint der Haupttenor in Kunerts Schreiben auf die Beschleunigung des gesellschaftlichen und persönlichen Verfalls hinzuweisen und - wie Ulrich Baron bemerkt er - in der Annahme, dass: „Die scheinbare Freiheit des Reisenden Einflüssen unterworfen bleibt, die er bestenfalls durchschauen, aber kaum je zu beeinflussen vermag“.69
6. Bibliographie
- Baron, Ulrich: Günter Kunert als Reisender. ; IN: TEXT + KRITIK.
Zeitschrift für Literatur. ; Heinz Ludwig Arn (Hrsg.) ; München: edition Text + Kritik GmbH, Januar 1991 , Heft 109
- Bekes, Peter: Günter Kunert. ; IN: Kritisches Lexikon zur
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. (KGL), 17. Nlg. ; S. 1 - 16 ; edition TEXT + KRITIK
- Bullivant, Keith: Gast in England. Zur Thematisierung des England-
Bildes Im Werk Günter Kunerts. ; IN: Günter Kunert. BeitrÄge zu seinem Werk. ; Durzak, M./ Steinecke, H. (Hrsg.) ; Wien/ München: Hanser Verlag, 1992
- Frenzel, E.: Motive der Weltliteratur. Ein Lexikon der
Dichtungsgeschichtlichen Längsschnitte. ; 4. Auflage ; Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1992 ; S. 667 - 681 [Kröners Taschenausgabe, Bd. 301]
- Kunert, Günter: Ein englisches Tagebuch. ; Berlin/ Weimar: Aufbau
Verlag, 1978
- Meid, Volker: Sachwörterbuch zur deutschen Literatur. ; Stuttgart:
Reclam, 1999 ; S. 395 - 397, 507 - 509
- Träger, Claus (Hrsg.) : Wörterbuch der Literaturwissenschaft. ;
Leipzig: Bibliographisches Institut, 1986 ; S. 508/ 509
- www.werkbundarchiv-berlin/benjamin.html
- www.kubiss.de/kultur/info/erlangen/poeten/kunert19.htm
- www.yahoo.de/frankfurterschule
- www.dhm.de/lemo/html/biografien/BenjaminWalter.html
- www.medicalnet.at/horvat/benj.htm
[...]
1 Siehe 4.1.3. Walter Benjamin
2 KGL, S. 4
3 Baron, U. ; S. 53
4 siehe KGL, S.16
5 Baron ; S. 51
6 Meid, V. ; S. 507
7 Ein englisches Tagebuch; S. 15
8 Ein englisches Tagebuch; S. 120
9 Ein englisches Tagebuch; S. 145 ff.
10 KGL ; S. 16
11 siehe KGL ; S. 16
12 Baron ; S. 54
13 Baron ; S. 53 / unten
14 Ein englisches Tagebuch; S. 24
15 Vergleiche Baron ; S. 53
16 Bullivant ; S. 220
17 Ein englisches Tagebuch; S. 125
18 Ein englisches Tagebuch; S. 32
19 Ein englisches Tagebuch; S. 32/33
20 siehe Bullivant ; S. 222
21 Bullivant ; S. 222
22 Bullivant ; S. 222 (und ET; S. 45)
23 Frenzel, E. Motive der Weltliteratur, S. 681
24 Frenzel, E. Motive der Weltliteratur, S. 667
25 KGL ; S. 16
26 Walter Benjamins philosophischen Thesen werden hier nur angeschnitten, denn eine ausführliche Darstellung seiner Gedanken zum Geschichtsprozesses und zur Kunst würden den Rahmen dieser Hausarbeit sprengen. Zu bemerken ist, dass Kunert sich mit Benjamins Thesen auseinandersetzt, sie analysiert und interpretiert. Lediglich die wesentliche Verbindung zwischen Kunerts Endzeitbewusstsein und Benjamins Thesen sei hier dargestellt.
27 www.werkbundarchiv-berlin/benjamin.html
28 Nähere Informationen sind zur Frankfurter Schule und deren „Kritische Theorie“ unter www.yahoo.de/frankfurterschule erhältlich.
29 Ein englisches Tagebuch; S. 26
30 Bullivant ; S. 225
31 siehe www.werkbundarchiv-berlin/benjamin.html
32 Siehe KGL ; S. 9
33 Ein englisches Tagebuch ; S. 180
34 Aus: www.dhm.de/lemo/html/biografien/BenjaminWalter.html
35 Ein englisches Tagebuch ; S. 120
36 Ein englisches Tagebuch ; S. 120
37 KGL ; S. 8/9
38 Ein englisches Tagebuch ; S. 120/121
39 KGL ; S. 3
40 Baron ; S. 54
41 siehe Bullivant und Baron
42 KGL. ; S. 4 / oben
43 Ein englisches Tagebuch; S. 82
44 siehe Ein englisches Tagebuch; S. 128
45 siehe www.medicalnet.at/horvat/benj.htm ; S.1
46 Ein englisches Tagebuch; S. 228
47 Ein englisches Tagebuch; S. 229
48 Ein englisches Tagebuch; S. 229
49 Ein englisches Tagebuch; S. 231
50 eigene Übersetzung
51 Ein englisches Tagebuch; S. 232/ 233
52 Ein englisches Tagebuch; S. 233
53 Ein englisches Tagebuch; S. 197
54 siehe Ein englisches Tagebuch; S. 236
55 Ein englisches Tagebuch; S. 237 / Mitte
56 Ein englisches Tagebuch; S. 15
57 Ein englisches Tagebuch; S. 206
58 Baron ; S. 54
59 Ein englisches Tagebuch; S. 47
60 Ein englisches Tagebuch; S. 47
61 Ein englisches Tagebuch; S. 109
62 Ein englisches Tagebuch; S. 87
63 Bullivant ; S. 219 /220
64 Ein englisches Tagebuch; S. 127
65 KGL ; S. 5
66 KGL ; S. 4
67 KGL ; S. 3
68 siehe KGL ; S. 12
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im "Englischen Tagebuch" von Günter Kunert?
Das "Englische Tagebuch" ist ein Werk von Günter Kunert, das seine zweimonatigen Aufenthalt in Warwick, England, reflektiert. Es ist kein bloßer Reisebericht, sondern eine tiefgründige Auseinandersetzung mit dem Fremden und eine Reflexion über Kunerts Selbst- und Weltbild, wobei der Verfall unserer Gesellschaft eine wesentliche Rolle spielt.
Was ist der äußere Rahmen des "Englischen Tagebuchs"?
Der äußere Rahmen des "Englischen Tagebuchs" beschreibt Kunerts Eindrücke von England, einschließlich der Städte, Landschaften, Behausungen, Verpflegung und des Klimas. Oft wird England negativ dargestellt, als ein Land des Verfalls.
Was ist der innere Rahmen des "Englischen Tagebuchs"?
Der innere Rahmen bezieht sich auf Kunerts Reflexionen über sein Selbst- und Weltbild. Er nutzt die äußeren Eindrücke, um philosophische, geschichtliche und psychologische Exkurse zu unternehmen und sich mit Themen wie dem Verfallsprozess, der Vergangenheit und der eigenen Identität auseinanderzusetzen.
Welche Rolle spielt Walter Benjamin im "Englischen Tagebuch"?
Walter Benjamin ist ein wichtiger Bezugspunkt für Kunert. Kunert greift auf Benjamins Theorien über den zirkulären Geschichtsprozess, den Verfallsprozess und die Kritik am Fortschrittsglauben zurück. Benjamin wird als "unsichtbarer Weggenosse" und Stadtführer bezeichnet.
Was bedeutet Kunerts "Spielzeugmanie" im Kontext des "Englischen Tagebuchs"?
Kunerts Faszination für Spielzeug wird als Ausdruck seiner Suche nach der verlorenen Kindheit interpretiert, insbesondere seiner Erfahrungen während des Zweiten Weltkriegs. Der Erwerb von Spielzeug dient als eine Art Therapie, um die Traumata der Vergangenheit zu bewältigen.
Welche Bedeutung hat die Kälte im "Englischen Tagebuch"?
Die Kälte, die Kunert in England erlebt, wird als ein Störfaktor und als Symbol für die Vergangenheit interpretiert. Sie repräsentiert die physische Ohnmacht des Einzelnen gegen die Natur und den Verfallsprozess.
Welche Rolle spielt die Kritik an Kunert in der DDR im Zusammenhang mit dem "Englischen Tagebuch"?
Kunerts Auseinandersetzung mit Walter Benjamin und sein Geschichtspessimismus wurden in der DDR kritisch gesehen, da sie im Widerspruch zum propagierten Geschichtsoptimismus standen. Kritiker warfen ihm vor, den gesellschaftlichen Verfall Benjamins auf den Zerfall der DDR zu übertragen.
Welche Schlussfolgerung zieht der Text über das "Englische Tagebuch"?
Das "Englische Tagebuch" ist keine Vermittlung herkömmlicher Reiseeindrücke, sondern Kunerts retrospektiv formulierte, monologische Ansichten, Beobachtungen, Überlegungen und Einsichten. Sie kennzeichnen seine Skepsis, persönliche Bedrängnis, Schwermut (Weltschmerz), und Ohnmacht gegenüber der menschlichen Zivilisation und der äußeren Natur.
Was sind die Hauptthemen im "Englischen Tagebuch"?
Die Hauptthemen sind: der Verfall der Gesellschaft, die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die Suche nach Identität, die Kritik am Fortschrittsglauben, die Rolle des Künstlers und die Reflexion über das Selbst- und Weltbild.
Welche literarische Form hat das "Englische Tagebuch"?
Das "Englische Tagebuch" hat die Form eines literarischen Tagebuchs. Es ist eine subjektive, autobiographische Erzählung in monologischer Form, die äußere und innere Ereignisse reflektiert und eine Chronologie verfolgt.
Welchen Zweck verfolgt Kunert mit dem "Englischen Tagebuch"?
Kunert will aufrütteln und mahnen, das historische und künstlerische Bewusstsein schärfen und Orientierungshilfen geben. Er will der Welt eine zeitlang widerstehen und die Welt und sich selbst bewältigen.
Wie wird das Englandbild Kunerts im Tagebuch beschrieben?
Kunerts Englandbild ist oft negativ und unrealistisch, geprägt von seiner Phantasie. Es wird als Land des Ursprungs der industriellen Revolution und des Verfalls beschrieben, ein Land von verlorener Größe.
Was bedeutet das "Get rid of it" im Text?
"Get rid of it" ist eine Aufforderung an sich selbst, die Traumata einer verlorenen Kindheit endlich zu bewältigen.
- Quote paper
- Claudia Marschlich (Author), 2001, Günter Kunert: Ein englisches Tagebuch: Reisenotizen - Ansichten und Einsichten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/101272