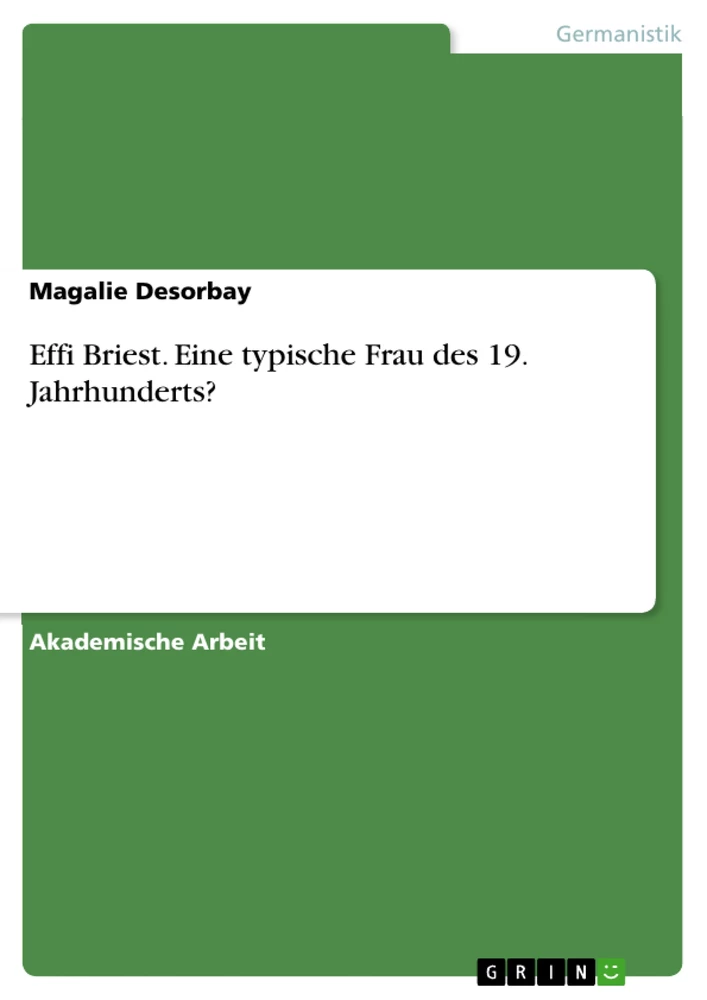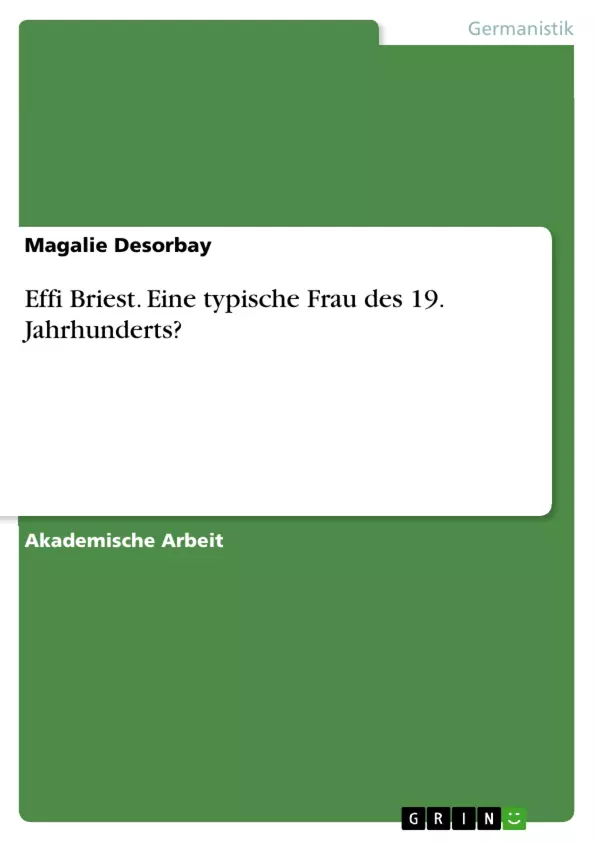Folgende Arbeit wird sich mit der Hauptfigur Effi beschäftigen und herausarbeiten, inwiefern sich Effi Briest in das typische Frauenbild des 19. Jahrhundert einordnen lässt.
Betrachtet man die Entwicklung des Menschen über die Jahre hinweg, so fällt schnell auf, dass die Geschlechterrollen von jeher genauestens festgelegt sind. Somit gibt es bereits in der Steinzeit eine typische Rollenverteilung: Die Männer gehen auf die Jagd, während die Frauen Beeren sammeln und sich um die Kinder kümmern. Im Imperium Romanum ist die Rolle der Frau auf den Haushalt und die Kindererziehung beschränkt. Zudem wird das weibliche Geschlecht hier als rechtsunfähig erklärt. Während im Mittelalter die Dichter des Minnesangs die weibliche Gestalt zwar besingen, erhält die Frau trotzdem eine untergeordnete Rolle und muss ihrem Mann Gehorsam leisten. Im 17. Jahrhundert sind die Frauen mitverantwortlich für den Arbeitsablauf im Betrieb des Mannes, was sich im 18. Jahrhundert jedoch ändert. Fortwährend soll sich die Frau drei wichtigen Aufgaben widmen: Zum einen ist sie verantwortlich für die Erziehung der Kinder. Sie ist außerdem Hausfrau und muss sich um das Wohlbefinden ihres Ehemanns kümmern. Die Frauen sind somit auf die häusliche Sphäre begrenzt und in das öffentlichen Leben nicht mit eingebunden. Im 19. Jahrhundert wird in Deutschland von Louise Otto-Peters die Frauenbewegung angeführt. Frauen sollen Rechte erhalten und in politische Entscheidungen mit einbezogen werden. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist es den Frauen gestattet Universitäten zu besuchen. Dies ist zudem die Zeit, in der sich die bürgerliche Welt etabliert und langsam ein gleichberechtigtes Nebeneinander in Ehen möglich wird. Die Bestimmung der Frau im 19. Jahrhundert bleibt nichtsdestotrotz die Heirat und die Kindererziehung. „Das Private wird zunehmend zu einer problematisch empfundenen ‚gesellschaftlichen Öffentlichkeit’, zur Projektionsfläche für Werte und Normen, die wenig Anwendungsspielraum lassen.“
Einer der wichtigsten Autoren dieser Zeit ist Theodor Fontane (1819 – 1898), der seinen Gesellschaftsroman Effi Briest erstmals in sechs Teilen, von 1894 bis 1895, in einer literarischen und wissenschaftlichen Zeitung veröffentlichte. 1896 erschien das Werk, das als Höhepunkt des poetischen Realismus gilt, erstmals als Buch. Die Handlung des Romans erstreckt sich über zwölf Jahre und beschreibt das Schicksal von Effi, nach der Fontane sein Werk benannt hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Rolle der Frau in der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts
- Bovarysme und Ehebruchsroman
- Effis Rolle in der Gesellschaft
- Effis Untergang - Ihr Scheitern in der Gesellschaft
- Fontanes Frauenwandel in Effi Briest
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Hauptfigur Effi Briest in Theodor Fontanes Roman "Effi Briest" und untersucht, inwiefern sich Effi in das typische Frauenbild des 19. Jahrhunderts einordnen lässt.
- Die Rolle der Frau in der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts
- Die Auswirkungen gesellschaftlicher Normen und Erwartungen auf Frauen
- Die Darstellung von Ehebruch und dessen Folgen
- Die Entwicklung der Figur Effi Briest und ihre persönliche Tragödie
- Fontanes Kritik am konservativen Gesellschaftsbild und dessen Einfluss auf die weibliche Identität
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung der Geschlechterrollen und führt in die Problematik der weiblichen Identität im 19. Jahrhundert ein. Sie stellt Theodor Fontane als zentralen Autor des poetischen Realismus vor und führt in die Handlung von "Effi Briest" ein.
- Kapitel 2: Die Rolle der Frau in der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts
Dieses Kapitel analysiert die gesellschaftliche und geistige Unterwerfung der Frau im 19. Jahrhundert. Es beleuchtet die Theorien von Arthur Schopenhauer und Henrik Ibsen und deren kritische Ansichten zur Rolle der Frau in der Ehe. Außerdem wird die Frauenbewegung und die sozialistischen Ideen zur Frauenemanzipation im 19. Jahrhundert beleuchtet.
- Kapitel 3: Bovarysme und Ehebruchsroman
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Thema des Bovarysmus und der Bedeutung des Ehebruchsromans im 19. Jahrhundert. Es untersucht, wie Fontane dieses literarische Motiv in "Effi Briest" nutzt, um die gesellschaftlichen Zwänge und die Folgen von Untreue darzustellen.
- Kapitel 4: Effis Rolle in der Gesellschaft
Dieses Kapitel analysiert Effis Position in der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Es untersucht die Erwartungen, die an sie gestellt werden, und die Schwierigkeiten, denen sie aufgrund ihrer Rolle als Frau und Ehefrau begegnet.
- Kapitel 5: Effis Untergang - Ihr Scheitern in der Gesellschaft
Dieses Kapitel beleuchtet Effis Tragödie und ihren Untergang in der Gesellschaft. Es untersucht, wie ihre Entscheidungen und Handlungen von den gesellschaftlichen Normen und Erwartungen beeinflusst werden und zu ihrem Scheitern führen.
- Kapitel 6: Fontanes Frauenwandel in Effi Briest
Dieses Kapitel analysiert Fontanes Darstellung des weiblichen Charakters in "Effi Briest". Es untersucht, wie er die Entwicklung der Figur Effi Briest schildert und welche Kritik er am konservativen Gesellschaftsbild und dessen Einfluss auf die weibliche Identität übt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die folgenden Schlüsselwörter: Frauenbild, bürgerliche Gesellschaft, 19. Jahrhundert, Ehebruch, Bovarysme, Effi Briest, Theodor Fontane, gesellschaftliche Erwartungen, weibliche Identität, Tragödie, Unterwerfung, Emanzipation.
- Quote paper
- Magalie Desorbay (Author), 2019, Effi Briest. Eine typische Frau des 19. Jahrhunderts?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1012556