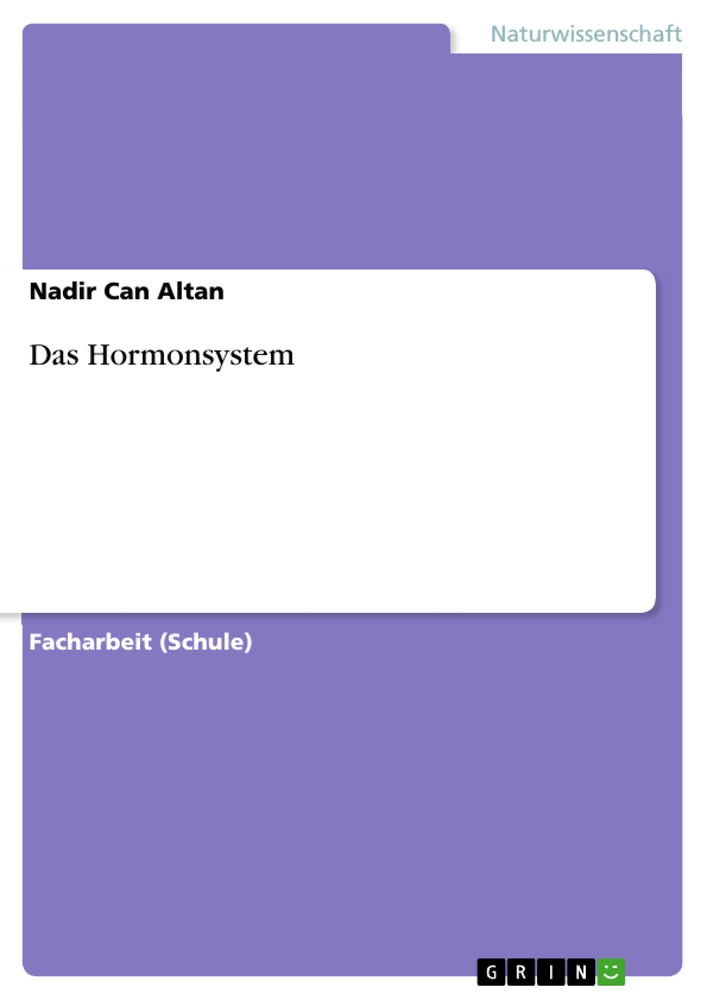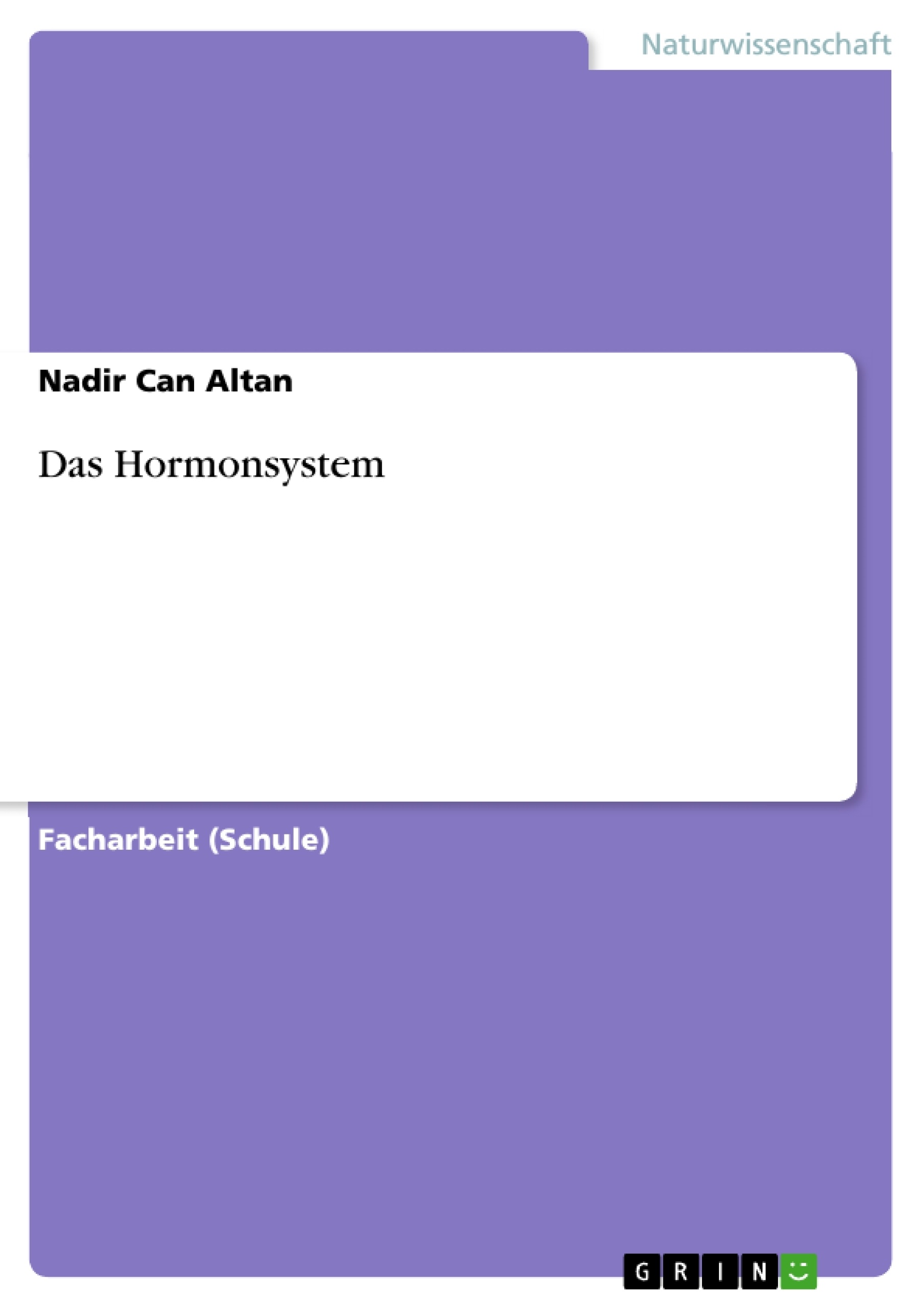Stellen Sie sich vor, Ihr Körper wäre ein Orchester, in dem Hormone die Rolle der Dirigenten übernehmen, um ein harmonisches Zusammenspiel aller Organe und Systeme zu gewährleisten. Dieses Buch enthüllt die faszinierende Welt des Hormonsystems, einem komplexen Netzwerk chemischer Botenstoffe, die weit mehr beeinflussen als nur Stoffwechsel und Wachstum. Tauchen Sie ein in die Grundlagen der Hormonwirkung, von den winzigen Mengen, die ausreichen, um lebensverändernde Effekte auszulösen, bis hin zu den vielfältigen Mechanismen, durch die Hormone in die Zellregulation eingreifen, sei es durch Beeinflussung der Enzymbildung, Veränderung der Zellmembrandurchlässigkeit oder Interaktion mit spezifischen Rezeptoren. Entdecken Sie die Schlüsselrolle der Hypophyse als "Dirigent des Dirigenten", die übergeordnete Kontrolle über das endokrine System ausübt, und lernen Sie die spezifischen Funktionen von Schilddrüse, Nebenschilddrüsen, Nebennieren, Bauchspeicheldrüse, Zirbeldrüse und Thymusdrüse kennen. Erfahren Sie, wie Gewebshormone wie Prostaglandine, Serotonin und Histamin lokal wirken und wichtige physiologische Prozesse steuern. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Geschlechtshormonen und ihrem Einfluss auf den weiblichen Zyklus sowie die Entwicklung der männlichen Geschlechtsmerkmale. Dieses Buch bietet nicht nur einen umfassenden Überblick über die normale Funktion des Hormonsystems, sondern beleuchtet auch die Ursachen und Auswirkungen von Hormonstörungen wie Über- und Unterfunktionen der Schilddrüse, Diabetes mellitus und Hypophysentumoren. Es ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die ihr Verständnis von Gesundheit und Krankheit vertiefen und die komplexen Zusammenhänge des menschlichen Körpers besser verstehen möchten. Mit klaren Erklärungen und anschaulichen Beispielen wird dieses Buch zu einem wertvollen Ratgeber für Studenten, medizinisches Fachpersonal und interessierte Laien, die mehr über die biochemischen Prozesse erfahren möchten, die unser Leben steuern. Verstehen Sie, wie Hormone Ihr Temperament, Ihren Charakter und Ihr Seelenleben beeinflussen und wie ein Ungleichgewicht zu vielfältigen gesundheitlichen Problemen führen kann. Eine spannende Reise durch die Welt der endokrinen Regulation erwartet Sie!
Das Hormonsystem
1. Wesen und Wirkung der Hormone
Außer dem Nervensystem verfügt der K örper über einen weiteren Regulator, der die Stoffwechselvorgänge der Zellen, Gewebe und Organe zu harmonischer Zusammenarbeit bringt: das System der Hormone. Als "chemische Botenstoffe" werden Hormone durch das Blut im ganzen Körper verbreitet und erreichen so, wie auch das Nervensystem, alle Körperteile. Sie greifen nicht nur regelnd und steuernd in die Tätigkeit der Organe ein; auch Wachstum und Entwicklung hängen weitgehend von ihrem Wirken ab. Beim Menschen, entsprechend auch bei höheren Wirbeltieren, haben sie einen tiefgreifenden Einfluß auf Temperament, Charakter, Gemüts- und Seelenleben und damit auf die ganze Persönlichkeit. Sie finden sich in verschwindend kleinen Mengen im Blut.
Hormone gehören keiner einheitlichen Stoffgruppe an. Sie können relativ einfach oder kompliziert gebaute Moleküle sein. Einige Hormone sind Proteohormone, d. h Eiweißkörper oder Polypeptide, deren Wirkung an die Reihenfolge der verschiedenen Aminosäuren gebunden ist, aus denen sie bestehen. Sie sind zum Teil artspezifisch (z. B Insulin). Die anderen Hormone sind nicht eiweißartig; sie sind in der Regel niedermolekular. Die chemische Konstitution einer Reihe von Hormonen konnte aufgeklärt werden, so dass sie auch z. T. synthetisiert und die Syntheseprodukte für thereutische Zwecke verwendet werden konnten (z. B. Schilddrüsenhormone, Nebennierenhormone, Keimdrüsenhormone). Zur Wirkung eines Hormons gehört außer seinem chemischen Aufbau und der abgegebenen Menge auch die Bereitschaft der Zellen und Organe, auf dessen Reiz zu antworten.
Mit dem Blutstrom kreisen sämtliche Hormone im Körper und werden zu allen lebenden Zellen verfrachtet. Allein nur dasjenige Organ spricht auf ein Hormon an, dessen Zellen darauf eingestellt sind. Wunderbar ist es auch, in welcher außerordentlichen Verdünnung die Hormone ihre Wirkung entfalten. Das Hormon der Schilddrüse zeigt noch bei einer Verdünnung von 1:500 Millionen eine deutliche Wirkung, und das Adrenalin des Nebennierenmarks soll sogar noch bei Verdünnung von 1:1000 Millionen wirksam sein. Es ist tatsächlich so, dass ein Tröpfchen Schilddrüsenhormon zu viel oder zu wenig darüber entscheidet, ob sich der Körper durch zu raschen Ablauf aller Lebensprozesse selbst verzehrt, oder ob er infolge Hemmung des Stoffwechselgeschehens und der geistigen Tätigkeit der Schlafsucht, dem Stumpfsinn und der Idiotie verfällt.
Hormonale Steuerung der Lebensvorgänge ist im ganzen Organismenreich verbreitet. Hormone sind nicht nur innerhalb desjenigen Körpers wirksam, der die Hormone erzeugt, sondern wirken auch bei anderen Lebewesen. Deshalb ist es möglich, tierische Hormone, ja sogar synthetisch hergestelltes Hormon für Heilzwecke beim Menschen anzuwenden.
Wirkungsprinzipien von Hormonen:
Hormone greifen in die Regulation des Organismus ein
- durch Wirkung auf die Enzymbildung in den Zellen (Enzyminduktion)
- durch Eingriff in die Durchlässigkeit von Zellmembranen bestimmter Zellarten
- durch Einwirkung auf Enzymreaktionen an der Zellmembran oder innerhalb der Zelle Für eine Hormonwirkung ist immer eine Wechselwirkung zwischen dem Hormon und einem "Rezeptor" erforderlich.
Hormonrezeptoren können sowohl an der Zellmembran als auch im Zellinneren lokalisiert sein. Der Rezeptor ist nicht unbedingt mit derjenigen Struktur der Zelle identisch, die die eigentliche Stoffwechselwirkung in der Zelle auslöst. Hormone greifen vielmehr oft nur indirekt in den Stoffwechsel ein und lösen eine Kette von Reaktionen aus, die schließlich zum Effekt führen. Ein Hormon kann also auch über Vermittlersubstanzen auf die Zelle wirken. Bisweilen ist die Wirkung von Hormonen schon nach der Wechselwirkung mit spezifischen Rezeptorstrukturen an der Zellmembran der Zielzelle beendet. Die in der Zelle ausgelösten Reaktionen laufen dann ohne weitere Beteiligung des Hormons ab.
Nicht alle Zellen verfügen über Rezeptoren, die auf jedes Hormon ansprechen. Die auf ein bestimmtes Hormon reagierenden Zellen bezeichnet man als "Target-Zellen" oder Zielzellen dieses Hormons. Einige Hormone, z. B.
Schilddrüsenhormone, entfalten ihre Wirkungen an einer großen Zahl von Zellarten, andere Hormone besitzen dagegen nur wenige Zelltypen als Targetzellen (z. B. manche weiblichen Sexualhormone).
Hormonrezeptor und Adenylatcyclase-System:
Die biochemische Aufklärung der Hormonwirkungen ergab, dass bei einer großen Anzahl von Hormonwirkungen auf ganz verschiedene Zellarten ein einheitlicher Mechanismus an der Zellmembran beteiligt ist, der vom Vorhandensein eines Enzym-Systems an der Innenseite der Zellmembran abhängig ist. Dieses System, die Adenylatcyclase, wird durch die Wechselwirkung des Hormons mit dem Zellmembranrezeptor aktiviert und löst innerhalb der Zelle die Bildung von zyklischen Adesosinmonophosphat (cAMP) aus ATP aus (s. Abb. 1). Das cAMP startet dann eine Reihe chemischer Reaktionen, die für die betreffenden Zellen spezifisch sind. Ein Hormon, das nach diesem Wirkungsprinzip arbeitet, löst demnach seinen Effekt nicht direkt im Zellinneren der Zielzelle aus, sondern es hat eine "Botenfunktion", die nur vom extrazellulären Raum, in den es von der Hormonbildungsstätte über das Blut abgegeben wurde, bis zur Zellmembran reicht. Das Hormon wirkt damit nur als erster Bote (first messenger). Diese Botschaft wird innerhalb der Zelle von einem zweiten Boten (second messenger) weitergereicht. Der second messenger ist das cAMP. Es kann dann noch ein dritter Bote eingeschaltet werden, bis schließlich die Endwirkung im Stoffwechsel der Zelle zustande kommt.
Die so vermittelten Wirkungen werden durch diesen Mechanismus variabel, denn einerseits kann eine einzelne Zelle mehrere spezifische Rezeptoren für verschiedene Hormone auf ihrer Oberfläche besitzen (s. Schema Abb. 1) und andererseits können verschiedenartige Zelltypen die gleichen Rezeptoren an ihrer Zelloberfläche besitzen.
Die spezifischen Eigenschaften des Stoffwechsels der verschiedenartigen Zellen und ihrer Ausstattung mit Enzymen haben eine weitere Spezialisierung der Wirkungen zur Folge, denn das cAMP kann nur einen, den biochemischen Reaktionsketten entsprechenden, spezifischen Effekt innerhalb der Zielzellart auslösen. Das erklärt z. B. , dass Adrenalin unter Mitwirkung von cAMP in der Leber eine Erhöhung der Glykogenfreisetzung, im Fettgewebe eine Bereitstellung von Lipiden und an der Bronchialmuskulatur eine Erschlaffung bewirkt. Diese verschiedenen Möglichkeiten sind in Abbildung 1 als Zellantwort bezeichnet. Das bei der Hormonwirkung beteiligte cAMP wird von einem Enzym innerhalb der Zelle schnell wieder abgebaut.
Hormonrezeptor und Proteinsynthese:
Ein weiterer Mechanismus, auf den der Rezeptorbegriff angewendet werden kann, betrifft die Wirkung von Hormonen auf intrazelluläre Strukturen. Hormone, die z. B. auf der Basis von Steroidmolekülen aufgebaut und lipidlöslich sind, können in die Zellen eindringen. Sie binden dort vorhandenen spezifischen Stoff, denn "Rezeptor". Der Hormon-Rezeptor- Komplex wird dann in den Zellkern transportiert. Hier ist der Wirkort des Hormons (vgl. Abb. 2). Ohne diesen Rezeptor kann das Hormon in der Zelle nicht wirken. Die Spezifität der Zielzelle hängt also in solchen Fällen davon ab, ob die Zelle den betreffenden Rezeptor enthält oder nicht.
Innerhalb der Zelle greift das Hormon in den Mechanismus ein, durch den genetische Information für die Herstellung von spezifischen Enzymproteinen übertragen wird. Die DNA (Desoxyribonucleinsäure) enthält das Struktur-Gen. Dieses ist in der Zelle durch einen Repressor blockiert. Eine Inaktivierung des Repressors erfolgt durch den Hormon-Rezeptor- Komplex und ermöglicht die Bildung von messenger Ribonukleinsäure (mRNA), die ihrerseits eine Ingangsetzung der Proteinbiosynthese auslöst. Die mRNA verlässt dabei den Zellkern und gelangt zu den Ribosomen, dem Ort der Proteinsynthese. Hier ermöglicht die erhöhte mRNA eine vermehrte Kopierung (Translation) von Proteinen, d. h. es kommt zu verstärkter Proteinsynthese. Durch diesen Induktion genannten Mechanismus kommt es zur vermehrten Proteinbildung, der Antwort der Zelle auf das Eindringen von Hormonen.
Nicht nur Steroidhormone, sondern auch viele andere Hormone sind in der Lage, Induktionsvorgänge im Gewebe auszulösen. Die Induktion kann die Synthese einiger weniger Proteine bzw. Enzyme oder vieler bzw. fast aller Proteine in der Zelle betreffen. Dass nicht schon ohne Mitwirkung von Hormonen solche Proteinvermehrungen erfolgen, liegt daran, dass die vorhandenen genetischen Informationen zur Synthese bestimmter Proteine durch die Repressoren der Zelle verdeckt sind. Erst die Hemmung der Repressoren durch Einwirkung von Hormonen kann die vorhandene genetische Information freilegen und die Proteinsynthese anlaufen lassen.
Hormonrezeptor und Membrantransport:
Eine Veränderung der Umsatzgeschwindigkeit in der Zelle kann aber auch durch Veränderung der Bereitstellung von Substrat für bestimmte enzymatische Umsetzungen erfolgen. Änderungen der Permeabilität von Zellmembranen führen zu Konzentrationsänderungen für bestimmte Stoffe innerhalb der Zelle und dadurch zu Veränderungen der Stoffwechselleistungen. Sie können ebenfalls durch Hormon-Rezeptor-Wechselwirkungen ausgelöst werden, die die Wirkung von Transportproteinen in der Zellmembran beeinflussen. Es konnte gezeigt werden, dass unter der Wirkung von cAMP einzelne Transportproteine phosphoryliert werden, was eine Änderung ihrer spezifischen Funktionen bewirkt. Es sind jedoch auch Permeabilitätsänderungen durch Hormone bekannt, die ohne Vermittlung von cAMP ablaufen.
Die meisten Hormone entstehen in Drüsen, welche ihre Absonderungsstoffe unmittelbar an das durchströmende Blut abgeben. Man spricht deshalb von Drüsen mit innerer Abscheidung oder innersektorischen Drüsen. Man kann sie ihrer
Wirkung nach in zwei Gruppen einteilen. Die eine, zu welcher die Hormone der Nebennieren, der Bauchspeicheldrüse, der Schilddrüse und der Nebenschilddrüsen gehören, beherrscht vorwiegend den Stoffwechsel. Die andere Gruppe, aus den Abscheidungen der Keimdrüsen, der Hypophyse und ebenfalls der Schilddrüse bestehend, wirkt auf das Wachstum und die körperliche und geschlechtliche Entwicklung ein. Den Drüsenhormonen stellt man Gewebs- und Zellhormone gegenüber, die in fast allen Geweben und Zellen entstehen, deren Wirkungsbereich aber im allgemeinen auf das Entstehungsgebiet und seine Umgebung beschränkt bleibt. Hormone sind auch bei der Reizübertragung von einer Ganglienzelle zur anderen und zwischen Nerv und Erfolgsorgan wirksam.
Alle endokrinen Drüsen und Gewebe haben die folgenden, allgemeinen Eigenschaften: Sie setzen ihre Hormonprodukte ohne Ausfuhrgang ins Blut frei Sie besitzen eine ausgiebige Blutversorgung Jede Drüse enthält mehr als einen Zelltyp und produziert mehr als ein Hormon Die Drüsen werden durch das autonome Nervensystem kontrolliert oder stehen unter der direkten Kontrolle durch den Hypothalamus
A) Die Gewebshormone:
Gewebshormone umfassen eine Gruppe völlig heterogener Stoffe, die nicht in speziellen Drüsen, sondern von verschiedenartigen Zellen oder Zellgruppen gebildet und ins Blut oder an das Nervensystem abgegeben werden. Ein Teil von ihnen wirkt am Ort der Entstehung, andere spezifisch auf Organsysteme. (Gastrin, Pancreozymin,
Adrenalin, Noradrenalin, Acetylcholin, Renin, Angiotensin (eine Überproduktion von Renin und Angiotensin führt zur Erhöhung des arteriellen Blutdrucks und hat insofern klinische Bedeutung))
Prostaglandine: In den 60er Jahren wurde ein Stoff isoliert, der zuerst in der menschlichen Samenflüssigkeit entdeckt worden war und zur Kontraktion der Uterusmuskulatur führt. Er wurde Prostaglandin genannt und findet sich vor allem im Gewebe der Samenblase und Prostata, aber auch in vielen anderen Geweben, so dass man annehmen muss, dass Prostaglandine an vielen Stellen des Körpers gebildet werden können. Prostaglandine werden aus der 20 Kohlenstoffatomen bestehenden und vier Doppelbindungen enthaltenden Fettsäure gebildet, die in Membranlipiden enthalten ist.
Es lassen sich verschiedenartige Prostaglandine unterscheiden, die man in die Gruppen A, E und F zusammengefasst. Sie wirken auf eine Vielzahl von Organen, besonders auf solche mit glatter Muskulatur, auf endokrine Drüsen, Nervengewebe, Zellen mit Transportleistungen und auf Blutzellen. Die Einzelwirkungen sind außerordentlich vielfältig. Die Prostaglandine der Gruppe A bewirken Hemmung der Magensaftsekretion, Erschaffung arterieller Blutgefäße, Blutdrucksenkung und Änderung der Natriumausscheidung. Die Prostaglandine der Gruppe E hemmen allergische Reaktionen, die Fettmobilisation und die Thrombocytenverklebung, sie steigern die Sekretion der Hormondrüsen, den Augeninnendruck und die Kapillarwanddurchlässigkeit und erweitern die Bronchien. Typische Wirkungen von Gruppe F sind Kontraktion der Blutgefäßmuskulatur, Hemmung der Gelbkörperfunktion und Änderung der Erregersübertragung an sympathischen Nerven. Nach den bekannten Befunden sind an der Übermittlung der Prostaglandineffekte an den Zielzellen spezifische Rezeptoren und das Adenylatcyclase-System beteiligt.
Serotonin: Das biogene Amin Serotonin(5-Hydroxytryptamin) zählt ebenfalls zu den Gewebshormonen. Es hat Seite 3 kontrahierende Wirkung auf die Muskulatur der Blutgefäße, der Bronchien, des Uterus und des Darms. Bei Thrombocyctenzerfall wird es freigesetzt und fördert bei Gefäßverletzungen die Konstriktion des Gefäßes während der Blutgerinnung.
Histamin:Es spielt beim Ablauf von Antigen-Antikörper-Reaktionen eine wichtige Rolle. Es wird in den basophilen Granulocyten transportiert. Bei Freisetzung tritt Quaddelbildung mit Juckreiz in der Haut und in Schleimhäuten auf. Es bewirkt Kontraktion der glatten Muskulatur. Ob es auch als Neurotransmitter wirkt, ist noch nicht endgültig geklärt.
Bradykinin, ein Polypeptid, verursacht Dilatakation bestimmter Gefäßgebiete. Es wirkt ähnlich wie die Kallidine, die eine ganze Stoffgruppe sind und auch den Gewebshormonen zugerechnet werden. Das Erythopoietin der Niere ist ein Stoff, der bei der Hämoglobinsynthese und der Vermehrung von Erythrocyten eine wichtige Rolle spielt. Es wird durch Sauerstoffmangel aktiviert.
B) Die Drüsenhormone :
Während die meisten Drüsen des Körpers als exokrine Drüsen ihr Sekret an die äußere oder innere Körperoberfläche (Haut, Darm, Luft-, Harn- und Geschlechtswege) abgeben, tritt das Sekret der Hormondrüsen als endokrinen Drüsen in die Blutbahn über. Manche von ihnen Stammen von exokretorischen Drüsen oder Teilen solcher ab, haben aber ihren Aufführungsgang verloren. Sie sind besonders gut durchblutet und etliche von ihnen sind auch reich an eingelagerten Vitaminen.
Die Funktionen der Hormondrüsen können auf verschiedene Weise untersucht werden:
1) durch Ausschalten der Drüse
2) durch Verfütterung oder Injektion von Drüsenextrakten
3) durch Transplantation der Drüse
4) durch die Herstellung und Anwendung von Stoffen, die den Hormonen entsprechen
2) Die Leistungen der Innersektorischen Drüsen:
A) Die Hypophyse:
Die Hirnanhangdrüse (Hypophyse) nimmt eine gewisse Führungsrolle im endokrinen System ein. Sie steht in enger Beziehung zu dem Hypothalamus, dem wichtigsten Bindeglied zwischen Nervensystem und endokrinen System. Unter dem Einfluß des Hypothalamus produziert die Hypophyse sog. glandotrope Hormone, die ihrerseits die peripheren Körperdrüsen zur Bildung und Freisetzung eigener Hormone veranlasst. Als Kontrolle dient in der Regel ein Rückkopplungsmechanismus im Sinne eines negativen Feedbacks, der entweder auf der Ebene der Hypophyse oder des Hypothalamus greift. Das ausgeschüttete Endhormon wirkt nicht nur an der Zielzelle, sondern hemmt rückläufig entweder die Freisetzung der glandotropen Hormone der Hypophyse oder den fördernden Einfluß des Hypothalamus auf die Hypophyse.
Der Informationsaustausch zwischen Hypothalamus und Hypophyse erfolgt ebenfalls über Hormone, die in den Neuronen des Hypothalamus gebildet werden (sog. Neurosekretion). Die Mehrheit dieser Botenstoffe gelangt über eine Art Pfortader-System auf kurzem Blutweg zur Hypophyse, zwei Hypothalamushormone kommen entlang von Nervenbahnen in die Hirnanhangdrüse und werden dort gespeichert.
Die Hypophyse teilt sich in zwei Bereiche: einen Vorderlappen (HVL) und einen Hinterlappen (HHL), beide mit unterschiedlichen Aufgaben(Abbildung 3). Der HVL stellt Hormone her, die die peripheren Drüsen zur Tätigkeit anregen; zwei davon wirken als Endhormone direkt auf ihr Zielgewebe (Somatotropin und Lipotropin).. Der HHL dient als Zwischenspeicher der beiden Hypothalamushormone Adiuretin (ADH) und Oxytocin.
Fast alle Gewebe des Körpers werden durch Somatotropin (STH) - bekannt als Wachstumshormon - direkt beeinflußt; es steuert das Wachstum von Muskeln, Knorpel und Knochen. Kinder mit einem STH-Mangel zeigen den sog. hypophysären Zwergwuchs, sie behalten einen kleinen Körper mit kindlichen Gesichtszügen, ausgeglichene Proportionen, aber altersentsprechender Intelligenz. Bei rechtzeitiger Diagnose kann der hypophysäre Zwergwuchs durch Hormonersatz erfolgreich behandelt werden. Überproduktion von STH bei Kindern führt hingegen zum hypophysären Riesenwuchs, Körpergrößen von über zwei Meter sind die Folge. Bei Erwachsenen führt die Hormonüberproduktion zur abnormen Vergrößerung der Körperenden (Akren: z. B. Kinn, Fingern, Zehen) - ein Krankheitsbild mit dem Namen Akromegalie. (Abbildung 4)
Prolaktin ist ein Hormon des HVL, das bei Wöchnerinnen die Milchbildung anregt. Es wirkt außerdem hemmend auf die weibliche Gonaden. Stillende Mütter haben selten einen Eisprung und Monatsblutungen, das Schwangerschaftsrisiko ist vermindert und alle Anforderungen sind auf Stillen eingestellt.
Der Saugreiz an der mütterlichen Brustwarze fördert nicht nur die Sekretion von Prolaktin, sondern auch die von
Oxytocin. Dieses im HHL gespeicherte Hormon ist zum Einschießen der Milch notwendig. Körperliche und seelische Belastungen schränken den Effekt von Oxytocin ein und verringern den Milchfluß. Entspannung löst das Problem.
Eine Untergruppe der glandotropen Hormone des HVL sind die Gondatropine, die auf die Keimdrüsen wirken: luteinisierendes Hormon (LH) und Follikel-stimmulierendes Hormon (FSH).
Die letzten beiden bisher genauer bekannten Hormone des HVL sind das Adrenokortikotropin (ACTH) und das Thyreotropin (TSH). Thyreotropin steigert die Schilddrüsentätigkeit und Adrenokortikotropin regt die Glukokortikoidproduktion in den Nebennieren an. Auch hier besteht ein Feedback: Neben ihrem spezifischen Effekt wirken die Glukokortikoide zurück auf die Hypophyse und hemmen eine weitere Abgabe von ACTH.
Der Verlust des Geschlechtstriebes und die Impotenz beim Mann kann manchmal auf die überschüssige Produktion von Prolaktin in der Hypophyse zurückgeführt werden. Dieselbe Störung führt bei der Frau zur Unfruchtbarkeit und ruft eine Milchsektretion der Brustdrüsen hervor, auch wenn kein Säugling zu stillen ist. Dies sind typische Beispiele einer Hypophysenfehlfunktion. Ihre häufigste Ursache sind Tumoren mit übermäßiger Hormonproduktion. Diese können direkt auf ihre Zielorgane wirken, aber auch die Wirkung anderer Hormone beeinflussen. Die gewöhnliche Behandlung eines Tumors ist seine chirurgische Entfernung oder seine radiologische Zerstörung. Der operative Zugang zur Hypophyse erfolgt über die Nase. Bei der Geschwulstentfernung besteht immer die Gefahr, daß der noch normale Rest der Drüse mitbeseitigt wird. Dann benötigt der Patient für die Dauer seines Lebens einen medikamentösen Hormonersatz.
Der Hinterlappen der Hypophyse ist viel kleiner als ihr Vorderlappen; er speichert die Hypothalamushormone Oxytocin und Vasopressin. Das erstere ist für das Einschießen der Milch in die Brustdrüse der stillenden Mutter verantwortlich. Außerdem stimuliert es die Kontraktion der glatten Muskulatur, besonders die der Gebärmutter, und verstärkt die Austreibungswehen unter der Geburt. Es hilft bei der Nachgeburt und veranlaßt, daß die Gebärmutter einer Stillenden rasch ihre ursprüngliche Größe wiedergewinnt.
Vasopressin - auch als Antidiuretisches Hormon (ADH) bekannt - kontrolliert das zirkulierende Blutvolumen und seine Kochsalzkonzentration. Rezeptoren in der Herzwand und im Gehirn registrieren Blutverlust oder einen Anstieg der Salzkonzentration im Blut und lösen eine ADH-Freisetzung aus dem HHL aus. Dieses regt die Nieren zur vermehrten Rückresorpbtion des Wassers aus dem Harn ins Blut an, wodurch der Urin konzentrierter wird. Das Blutvolumen steigt an, die Salzkonzentration verringert sich weiter.
B) Die Schilddrüse:
Die Schilddrüse stammt vom Mundboden als ursprünglich exkretorische Drüse ab, deren ehemalige Bedeutung aber unbekannt ist. Ihre Mündung lag in der Mitte der V-förmigen Grenze zwischen Zungenrücken und -grund. Dort wird die Drüse auch beim Embryo angelegt; sie wandert dann unter Verlängerung ihres Ganges vor dem Zungenbeinkörper und dem Kehlkopf abw ärts an ihre endgültige Lage. Danach bildet sich der Gang zurück, doch können Reste (diese werden als Nebenschilddrüsen bezeichnet, was aber nicht zu verwechseln ist mit den Beischilddrüsen oder Epithelkörperchen. )erhalten bleiben, die bei kropfartiger Entartung, besonders am Zungengrund, Beschwerden verursachen.
Das weiche und normalerweise nicht tastbare Organ liegt mit zwei Lappen der Luft- und Speiseröhre und dem Kehlkopf seitlich an. Sie sind durch ein Mittelstück verbunden, das unter dem Kehlkopf seitlich an. Sie sind durch ein Mittelstück verbunden, das unter dem Kehlkopf vor dem 2. -4. Luftröhrenknorpel liegt (Abbildung 5). Das zwischen 20 und 60g schwere Organ besteht aus einer Unmenge kleiner, bis 0, 5 mm großer Bläschen (Follikel), deren Wandung von einem einschichtigen Epithel ausgekleidet ist (Abbildung 6). Dieses hat je nach dem Sekretionsstadium der einzelnen Bläschen verschiedene Höhe. Es produziert das Sekret in die Bläschen hinein, wo es als sog. Kolloid gespeichert wird.
Die Schilddrüse ist eine inkretorische Drüse, in der mindestens vier stoffwechselaktive Jodverbindungen vorkommen, die unterschiedlich stark wirken. Darunter ist das Triiodthronin 3- bis 5mal so aktiv wie das Tetraiodthronin(Thyroxin).
Die Schilddrüse enthält ein Protein, Thyreoglobulin, das sehr reich an der Aminosäure Throsin ist. Dieses Tyrosin wird enzymatisch jodiert und zwischen zwei benachbarten Throsinresten findet eine Umlagerungsreaktion statt, durch die Throxin am Protein gebunden entsteht. In dieser gebundenen Form wird es in die Follikel abgegeben und als Kolloid gespeichert. Die Ausscheidung des Schilddrüsenhormons wird dadurch eingeleitet, dass das Threoglobulin in die Epithelzellen zurücktransportiert und dort proteolytisch abgebaut wird. Das hierdurch freigesetzte Hormon kann dann ans Blut abgegeben werden. Im Blut werden Triiodthronin (T3) und Tetraiodtyronin zum Teil an Albumin zum Teil an das Thyroxin-bindende-Globulin (TBG) gebunden. Da das TBG die Schilddrüsenhormone sehr fest bindet, ist die Konzentration an freiem Hormon im Blut sehr niedrig, es ist jedoch stets eine Reserve vorhanden. Bei Fehlen von TBG treten die Symptome einer Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) auf.
Die Ausschüttung des Thyroxins wird über das Hypophysenhormon Thyrotropin oder TSH (Thyreoidea stimulierendes Hormon) reguliert. Die Hormonpruduktion und die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Hormonkonzentration im Blut wird in Form eines Regelkreises beschrieben. (Abbildung 7) Steigt der Hormonspiegel im Blut an, so kommt es zu einer Verminderung der Ausschüttung aus der Schilddrüse. Man bezeichnet einen solchen als negative Rückkopplung. Der erhöhte Hormonspiegel wirkt nicht direkt auf die Schilddrüse, sondern auf den Hypothalamus, der bei zu hohen Hormonkonzentrationen veranlasst wird, weniger Thyrotropin-Releasing-Hormon auszuschütten, so dass auch die Hypophyse weniger Thyrotropin bilden kann. Auch auf die Hypophyse selbst scheint Thyroxin im Sinne einer Hemmung der Throtropin-Ausschüttung zuwirken. Bei Hormonbedarf wird aus dem gespeicherten Threoglobulin der Schilddrüse das aktive Hormon frei, das dann im Blut wieder an Eiweiß gebunden und am Wirkort freigesetzt wird. Die Ausschütterung des Throtropins erfolgt über das Throliberin mit Hilfe des cAMP.
Die biochemische Wirkungsweise von T3 und T4 ist im Einzelnen noch nicht bekannt. Schilddrüsenhormone bewirken eine Steigerung des Umsatzes von Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten. Die dadurch bedingte Energieumsatzsteigerung ist mit Erhöhung der Körpertemperatur und Herzfrequenz verbunden, sowie mit einer Verringerung des peripheren Blutgefäßwiderstandes und einer Senkung der Schwelle für Erregungen im Zentralnervensystem.
In den Körperzellen werden auf noch unbekannte Weise die Bildung von RNA und vermehrte Enzymaktivität der
Mitochondrien induziert. Eiweißsynthese, Lipidsynthese und Energieumsatz steigen an. An der Zellmembran aktiviert T3 die Natriumpumpe, die schon in der Norm 30-40% des Ruheenergieumsatzes beansprucht. Weil unter Thyroxinwirkung gleichzeitig der passive Natriumeinstrom in die Zellen ansteigt, tritt ein "Leelaufumsatz" mit erhöhter Energieverbrauch ein, die Wärmebildung steigt. Mit anderen Hormonen wirkt es folgendermaßen zusammen:
Es erhöht die Wirkung des Adrenalins auf den Grundumsatz, es erhöht auch dessen lipolytische Wirkung und beeinflusst den Kohlenhydrathaushalt sowohl durch sein Zusammenwirken mit Adrenalin als auch mit Insulin. Bei Mangel an Schilddrüsenhormon wird die Ausschütterung von Wachstumhormon sowie dessen periphere Wirkung gebremst. Der Funktionszustand der Schilddrüse hat einen ausgeprägten Effekt auf die Sekretion und den Stoffwechsel der weiblichen und männlichen Sexualorgane. Durch das Zusammenspiel mit anderen Hormonen ist seine Wachstumswirkung auf die Knochen und seine Wirkung auf Haut, Haare und Zähne sowie auf den Wasserhaushalt zu erklären (Abbildung 8).
Überfunktion der Schilddrüse: Vermehrte Produktion von Schilddrüsenhormonen geht oft mit Vergrößerung der
Schilddrüse einher. Die häufigste Ursache ist ein gutartiges tumorartiges Wachstum von Schilddrüsenteilen (Adenom), die nicht mehr der hypothalamisch-hypophysäuren Steuerung unterliegen, sondern autonom vermehrt Schilddrüsenhormon produzieren und abgeben. Die Beschleunigung des Stoffwechsels macht sich in einer Erhöhung des Energieumsatzes und der Körpertemperatur bemerkbar. Trotz Appetitssteigerung tritt Abmagerung auf. Auch ist die Herztätigkeit beschleunigt
(Herzklopfen); es kommt zu Schlaflosigkeit und seelischer Übererregbarkeit, die in ausgesprochene Psychosen und Tobsuchtsanfälle übergehen kann.
Die BASEDOWsche Erkrankung ist ebenfalls eine Überfunktion der Schilddrüse mit den gleichen Erscheinungen. Sie beruht auf einer genetisch determinierten Anlage, die jedoch nicht unbedingt zur Erkrankung führen muss. Sie besteht darin, dass von den T-Lymphocyten stimulierte B-Lymphocycten veranlasst werden, ein Gammaglobulin zu bilden und abzugeben, das als "thyroid stimulating antibody"(Tsab) die Throxinproduktion in gleicher Weise steigert wie das TSH. Außerdem sind damit meist rheumatische Beschwerden sowie eine myxoedermatöse Schwellung besonders des Orbitagewebes verbunden, was ein Hervortreten der Augäpfel mit weit geöffneten Lidspalten zur Folge hat; außerdem erfolgt der Lidschlag auffällig selten.
Unterfunktion der Schilddrüse: In manchen Gegenden, in denen das Trinkwasser zu wenig Jod enthält, kommt eine Form der Schilddrüsenunterfunktion vor, die mit starker Vergrößerung der Schilddrüse, einem harten Kropf (Struma), einhergeht (Abbildung 9). Die erhebliche Vergrößerung der Schilddrüse wird darauf zurückgeführt, dass sie wegen Thyroxinmangels zu stetigem Wachstum angetrieben wird, wobei allerdings weniger das Drüsengewebe als vorwiegend das Bindegewebe vermehrt wird. Der Kropf kann erhebliche Ausmaße annehmen und auf die Halsorgane einengend drücken.
In denselben Gegenden tritt auch der Kretinismus auf. Wenn nämlich Frauen mit einem Jodmangelkropf, der sämtliches vorhandene Jod speichert, schwanger sind, entwickeln sich bei dem Kind Jod - und Schilddrüsenmangel, die eine nicht mehr rückbildungsfähige allgemeine Entwicklungsstörung zur Folge haben. Nach der Geburt bleiben körperliches und geistiges Wachstum bei diesen Kindern zurück. Dadurch, dass die Epiphysenfugen der langen Röhrenknochen zu früh verknöchern, bleibt das Längenwachstum der Knochen zurück, die Haut ist runzelig und trocken, die Lidspalten sind eng, die Intelligenz ist gering. Der Energieumsatz ist um 30-40% niedriger beim Gesunden. Besonders deutlich ist die schleimige Durchtränkung der Haut, was der Krankheit den Namen Myxödem eintrug.
C) Die Nebenschilddrüsen:
Ziemlich versteckt hinter der Schilddrüse liegen vier reiskorngroße Körperchen. Ihr Hormon regelt den Phosphor- und Kalkstoffwechsel. Unterfunktion lässt den Ca-Gehalt des Blutes stark absinken; zunehmende Überempfindlichkeit des Nervensystems bei Ca-Mangel führt zu schmerzhaften Muskelkrampfen. Gänzlicher Verlust der Nebenschilddrüsen ist lebensbedrohend. Da das Vitamin D ebenfalls in den Kalkstoffwechsel eingreift, wird auch hier das Prinzip der doppelten Steuerung deutlich. (Abbildung 10).
D) Die Nebennieren:
Die als bohnengroße Kappen auf den Niederrändern liegenden Nebennieren stellen eigentlich zwei verschiedene innersekretorische Drüsen dar, da im bräunlichen Markgewebe andere Hormone als in der gelblichfetten Rinde gebildet werden.
Die zahlreichen Hormone der Nebennierenrinde wirken regulierend auf den Wasser-, Kohlenhydrat-, Eiweiß und Fetthaushalt sowie auf die Funktion der Keimdrüsen ein; bei vermehrter Absonderung bilden sich die sekundären
Geschlechtsmerkmale verführt aus. Ein besonderes Hormon des Hirnanhang regt die Bildung der Rindenhormone an, die ihrerseits wieder hemmend auf die Tätigkeit des Hirnanhangs einwirken.
Das bekannteste Hormon des Marks ist das Adrenalin. Seine Absonderung wird durch das Eingeweidenervensystem veranlasst; es regt seinerseits wieder das sympathische System an und erhöht durch die Regelung der Blutverteilung die Reaktionsgeschwindigkeit und die Leistungen des Körpers. Das Verdauungssystem wird weitgehend stillgelegt und dafür die Bewegungsmuskulatur stärker durchblutet, der Blutdruck wird gesteigert, die Herztätigkeit beschleunigt, die Ausschüttung des Glykogens aus der Leber gefördert. Bezeichnend ist, dass Muskelarbeit und auch seelische Erregungen, wie Zorn, Wut, Angst die Angabe des Hormons steigern, was wiederum eine vermehrte Abgabe von Zucker ins Blut und dadurch eine gesteigerte Leistungsfähigkeit der Muskulatur zur Folge hat. Zusammen mit dem Eingeweidenervensystem sorgt das Adrenalin für die Rasche Anpassung der Körperfunktionen an die wechselnden Bedürfnisse. Mit der Schilddrüse steht der Nebennierenmark in Wechselbeziehung; beide Hormone haben ähnliche, den Stoffwechsel anregende Wirkungen. (Abbildung 11)
E) Die Bauchspeicheldrüse und der Zuckerhaushalt des Körpers:
In der Bauchspeicheldrüse entdeckte Langerhans(1869) inselartig verteilte, 0, 3mm große Zellhäufchen, welche mit der
Tätigkeit der eigentlichen Bauchspeicheldrüse nichts zu tun haben. 1889 stellte man fest, dass die völlige Entfernung der
Bauchspeicheldrüse beim Tier Zuckerkrankheit hervorrief, was jedoch ausblieb, wenn nur der Ausführungsgang der Drüse für den Bauchspeichel unterbunden wurde. 1921 gelang es dann den kanadischen Forschern Banting und Best, aus den Langenhansshen Inseln ein Hormon, das Insulin, zu isolieren, das in den Zuckerhaushalt des Körpers eingreift. Diese Entdeckung hat seitdem Tausenden von Menschen gerettet.
Außer Insulin liefern die Langerhansschen Inseln das ähnlich zusammengesetzte Hormon Glucagon, welches dem Insulin entgegenwirkt. Beide sind Eiweisskörper.
Das Zentralorgan für den Zuckerstoffwechsel ist die Leber. Sie entnimmt aus dem Pfortaderblut den vom Darm kommenden Traubenzucker, wandelt ihn Glykogen um und gibt davon nach Bedarf wieder Zucker an das Blut ab, so dass der Blutzuckergehalt mit 0, 1% dauernd auf gleicher Höhe gehalten wird. Dieser Blutzuckerspiegel wird nun durch die Wechselwirkung von Insulin einerseits und Glukagon sowie Hormonen des Hirnanhangs, der Nebennierenrinde und der Schilddrüse greifen ein. Ihr Zusammenspiel wird durch das vegetative Nervensystem geregelt; Ausgang der Regulation ist das Zwischenhirn. Steigt der Blutzuckergehalt zu hoch, dann scheiden die Langerhansschen Inseln auf Reize des Parasympathikus hin das stoffwechselhemmende Insulin aus, welches bewirkt, dass der überschüssige Zucker teils verbrannt, teils in Leber und Muskeln zu Glykogen aufgebaut und gespeichert wird. Sinkt er, dann greifen das Glukagon und die anderen Hormone ein und veranlassen die Leber, durch Abbau von Glykogen Traubenzucker ans Blut abzugeben. In Augenblicken von Not und Gefahr schüttet dann das Nebennierenmark, von Sympathikus veranlasst, das stoffwechselbelebende Adrenalin aus, das den Blutzuckergehalt rasch ansteigen lässt.
Mangelhafte Insulinbildung ruft die Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) hervor. Der Körper kann den Zucker nicht mehr richtig verbrennen, so dass die auftretenden Zwischenprodukte den Körper vergiften und die Nieren Zucker in Harn abscheiden. Ständig wiederholte Einspritzungen von Insulin vermögen die Krankheitserscheinungen für die Dauer der Insulinwirkung zu beseitigen. Doch müssen Insulingaben genau eingestellt sein, denn zu große Mengen von Insulin lassen den Blutzuckergehalt rasch absinken, so dass es zu schweren Krämpfen, Bewusstlosigkeit und Atemlähmung kommt. Für die Entstehung der Zuckerkrankheit ist eine Krankheitsbereitschaft, die vielfach auf erblichen Anlagen beruht, maßgebend. Umweltfaktoren kommt nur eine auslösende Wirkung zu. Die Krankheit nimmt in der letzten Zeit merklich zu.
F) Die Zirbeldrüse (Epiphyse):
Die Zirbeldrüse besteht beim Menschen aus einem etwa 0, 15g schweren, kaum erbsengroßen, drüsenartigen Zellhaufen. Bereits vom 7. Lebensjahr ab wird das Organ wieder rückgebildet. Über seine Leistungen ist wenig sicheres bekannt. Es dürfte einen hemmenden Einfluss auf die Keimdrüsenentwicklung ausüben, denn Unterentwicklung der Drüse verursacht Frühreife (Wunderkinder). Wahrscheinlich liefert es auch ein wachstumsförderndes Hormon. (Abbildung 10)
G) Die Thymusdrüse:
Nicht viel mehr weiß über die Thymusdrüse, beim Schlachttier Bries genannt. Sie ist eine ausgesprochene Kindheitsdrüse, deren Gewicht bis zum 14. oder 15. Lebensjahr auf 25g ansteigt. Dann reicht die Drüse in Form zweier nach unten verbreiterter Lappen im oberen Brustabschnitt vom Kehlkopf bis zum fast zum Herzen. Mit der Reifung der Keimdrüsen wird sie bis auf unbedeutende Reste zurückgebildet. Da Verfütterung von Bries an Kaulquappen Riesenformen unter gleichzeitiger Verzögerung der Umwandlung hervorruft, dürfte das Hormon das jugendliche Wachstum fördern, dagegen hemmend auf die Entwicklung der Keimdrüsen wirken. Andererseits wird die Thymusdrüse durch die Bildung von Keimdrüsenhormonen außer Tätigkeit gesetzt, welche nun den weiteren Ausbau des männlichen oder weiblichen Körpers steuern. Übermäßig langes Bestehen dieser Jugenddrüse beim Menschen kann nicht nur Riesenwuchs, sondern auch eine kindliche Seelenhaltung begünstigen.
H) Die Keimdrüsen:
Männliche Geschlechtshormone: Zwischen den Hodenkanälchen befinden sich vor der Geburt die hormonsezernierenden LEYDIGschen Zwischenzellen. Nach der Geburt erfolgt ihre Rückbildung; sie werden erst zu Beginn der Pubertät durch das Interstitialzellen stimulierendes Hormon (ICSH=LH siehe oben bei der Hypophyse) des
Hypophysenvorderlappens zur endgültigen Reife gebracht. Sie bilden die männlichen Geschlechtshormone: Androgene , hauptsächlich des am stärksten wirksame Testosteron, nächsthäufig das schw ächer wirksame Andosteron.
Die Hormone sind unentbehrlich für die Entwicklung der Samenzellen sowie für die typische Ausbildung der sekundären männlichen Geschlechtsmerkmale und damit des reifen männlichen Körpers. Sie haben außerdem wesentliche Einflüsse auf den Eiweissaufbau und besonders auch auf die Ausbildung der Muskulatur (anabole Wirkung). Eine geringere Menge des sezenierten Testosterons wird an unbekannter Stelle im Körper zu Östrogen umgewandelt, der größte Teil wird in der Leber umgebaut. (17-Ketosteroide) und im Harn ausgeschieden. Die Hormonproduktion wird durch die Hypophyse gesteuert.
Ähnlich wie andere Steroide wird Testosteron beim Transport im Blut an ein Protein gebunden. In den Zielzellen wird es an Rezeptoren gebunden, die in den Zellkern aufgenommen werden und dort spezifische Induktionsvorgänge in Gang setzen. Wesentlich aktiver als Testosteron ist Dihydrotestosteron, das in den Zielzellen durch spezifische Reduktasten aus Testosteron gebildet wird. Interessanterweise sind die in den Muskelzellen Rezeptoren enthalten, die Testosteron besser binden als Dihydrotestosteron. Die androgene und die anabole Wirkung der männlichen Geschlechtshormone wird also durch verschiedenartige Rezeptoren vermittelt. Die Geschlechtshormone wirken im Sinne einer negativen Rückkoppelung auf im Zwischenhirn gelegene Kerngebiete, die bei der Regelung des Sexualverhaltens eine Rolle spielen, so dass bei Erhöhung der Konzentration von Sexualhormonen eine Verminderung der Freisetzung ihrer Releasinghormone einsetzt. Die extragenitialen Wirkungen der androgenen Hormone bestehen in einer Stimulierung der Eiweißsynthese (Ausbildung der Muskulatur) und verstärkter Haarbildung.
Mit Hilfe von Testosteron kann sowohl die Begattungsfähigkeit als auch die körperliche Spannkraft des Mannes gesteigert werden; doch hemmt im Überschuss künstlich zugeführtes Testosteron die LH-Produktion der Hypophyse, wodurch dann die Zwischenzellen des Hodens degenerieren. Im Hoden werden auch weibliche Geschlechtshormone gebildet, doch sind beim gesunden Mann die männlichen in vielfach größeren Mengen vorhanden. Allerdings kann gegebenenfalls bei einer Hodengeschwulst das Follikelhormon die Vorherrschaft bekommen, wodurch dann ein verweiblichender Umschlag der sekundären Geschlechtsmerkmale hervorgerufen wird.
Bei Frühkastration (im Kinderalter) bleibt infolge Fehlens des Geschlechtshormons die Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale aus, die Geschlechtsorgane bleiben klein, der Stimmbruch fehlt, außerdem kommt es zu verlängertem Wachstum mit langen Gliedmaßen, starkem Fettansatz und schlecht entwickelter, leicht ermüdbarer Muskulatur. Bei Spätkastraten kommt es zur Rückbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale und zum Verlust an Libido (Lust), die Kopulationsfähigkeit bleibt jedoch für einige Zeit bestehen; manchmal kommt es zu Hitzewallungen, häufiger treten Reizbarkeit, Passivität und Depressionen auf.
Testosteron bewirkt bei stark ausgezehrten Patienten eine Vermehrung der Körpermasse, im Sport wird es zuweilen als Anabolikum missbraucht.
Weibliche Geschlechtshormone:
Der weibliche Zyklus: Der weibliche Organismus unterliegt mit den Eintreten der Geschlechtsreife einem inneren Rhythmus von ca. 28 Tagen, in dem das hormonelle Programm zyklisch durchlaufen wird. Einmal eingesetzt, läuft dieser Zyklus bis zur Menopause (letzte Menstruation), nur während einer Schwangerschaft und der Stillzeit wird er unterbrochen. Die Hormonproduktion von Hypothalamus, Hypophyse und Eierstöcken ist dabei genau aufeinander abgestimmt und beeinflusst sich gegenseitig. Dem gleichen Zyklus unterliegt die heranreifende Eizelle mit ihren Hilfszellen (Follikelzellen) und der Auf- bzw. Abbau der Gebärmutterschleimhaut, die Menstruation, ist äußeres Zeichen dieser inneren Vorgänge.
Gesteuert durch den Hypothalamus gibt die Hypophyse zwei Hormone in das Blut ab, das Follikel stimulierende Hormon (FSH) und das luteinisierende Hormon (LH). FSH bewirkt die Reifung des Follikels, LH verursacht im Follikel die Synthese von Östradiol. Die Wirkung des zweiten Hypophysenhormons tritt erst mit Zeitverzögerung ein. Der steigende Östradiolspiegel fördert einerseits das Follikelwachstum, andererseits stellt Östraidol die Sensibilität der Hypophyse auf die Stimulation des Hypothalamus ein. Die FSH-Ausschüttung wird durch Östraidol gehemmt, die LH-Ausschüttung gefördert (Rückkopplung). Mit zunehmender Östradiolkonzentration erreicht die FSH- und LH-Ausschüttung um die Zyklusmitte ihr Maximum. Es kommt zum Eisprung (Ovulation). Der geplatzte Follikel wandelt sich unter dem Einfluss von LH zum Gelbkörper um, der das Hormon Progesteron bildet.
Progesteron hemmt die weiteren Ausschüttung von FSH und LH und unterdrückt die Reifung eines weiteren Follikels (z. B. "Antibabypille"). Andererseits fördert Progesteron den Erhalt der Gebärmutterschleimhaut, für deren Aufbau Östradiol gesorgt hat. Der Gelbkörper kann ca. Zwei Wochen lang Progesteron produzieren. Damit sind im Organismus alle Vorbereitungen zur Einnistung eines Keims getroffen. Bleibt die Eizelle unbefruchtet, so stirbt sie ab, der Gelbkörper bildet sich zurück, die Gebärmutterschleimhaut zerfällt und der monatliche Zyklus beginnt mit der Menstruation von neuem.
Quellen :
Biologie des Menschen (Quelle&Mayer Verlag/Wiesbaden 1988) Hermann Linder Biologie (1977)
Natura 2 für Gymnasien (Klett/1998) Fen Bilimleri Merkezi Ders Notlari Internet : www. hausarbeiten. de, www. grim. heim. de,
Häufig gestellte Fragen zu "Das Hormonsystem"
Was sind Hormone und wie wirken sie?
Hormone sind chemische Botenstoffe, die vom Körper produziert und über das Blut im ganzen Körper verteilt werden. Sie regulieren Stoffwechselvorgänge in Zellen, Geweben und Organen, beeinflussen Wachstum und Entwicklung und haben beim Menschen tiefgreifenden Einfluss auf Temperament, Charakter, Gemüts- und Seelenleben.
Zu welcher Stoffgruppe gehören Hormone?
Hormone gehören keiner einheitlichen Stoffgruppe an. Einige sind Proteohormone (Eiweißkörper), andere sind niedermolekular. Die chemische Konstitution einiger Hormone ist bekannt, so dass sie synthetisiert und für therapeutische Zwecke verwendet werden können.
Wie entfalten Hormone ihre Wirkung im Körper?
Hormone zirkulieren mit dem Blutstrom im Körper und erreichen alle lebenden Zellen. Nur Zellen, die auf ein bestimmtes Hormon eingestellt sind, reagieren darauf. Hormone wirken auch in sehr starker Verdünnung.
Nach welchen Wirkungsprinzipien greifen Hormone in die Regulation des Organismus ein?
Hormone greifen in die Regulation des Organismus ein durch Wirkung auf die Enzymbildung in den Zellen, durch Eingriff in die Durchlässigkeit von Zellmembranen bestimmter Zellarten und durch Einwirkung auf Enzymreaktionen an der Zellmembran oder innerhalb der Zelle. Für eine Hormonwirkung ist immer eine Wechselwirkung zwischen dem Hormon und einem "Rezeptor" erforderlich.
Was sind Hormonrezeptoren und wie funktionieren sie?
Hormonrezeptoren können sowohl an der Zellmembran als auch im Zellinneren lokalisiert sein. Sie sind nicht unbedingt mit derjenigen Struktur der Zelle identisch, die die eigentliche Stoffwechselwirkung auslöst. Hormone können auch über Vermittlersubstanzen auf die Zelle wirken. Zielzellen eines Hormons sind diejenigen Zellen, die über die passenden Rezeptoren verfügen.
Was ist das Adenylatcyclase-System und wie ist es an Hormonwirkungen beteiligt?
Das Adenylatcyclase-System ist ein Enzym-System an der Innenseite der Zellmembran, das durch die Wechselwirkung des Hormons mit dem Zellmembranrezeptor aktiviert wird und innerhalb der Zelle die Bildung von zyklischem Adenosinmonophosphat (cAMP) aus ATP auslöst. Das cAMP startet dann eine Reihe chemischer Reaktionen, die für die betreffenden Zellen spezifisch sind. Das Hormon wirkt somit als erster Bote (first messenger), das cAMP als zweiter Bote (second messenger).
Wie greifen Hormone in die Proteinsynthese ein?
Steroidhormone können in die Zellen eindringen und an spezifische Rezeptoren binden. Der Hormon-Rezeptor-Komplex wird dann in den Zellkern transportiert, wo er in den Mechanismus eingreift, durch den genetische Information für die Herstellung von spezifischen Enzymproteinen übertragen wird. Durch diesen Induktionsmechanismus kommt es zur vermehrten Proteinbildung.
Wie verändern Hormone den Membrantransport?
Änderungen der Permeabilität von Zellmembranen führen zu Konzentrationsänderungen für bestimmte Stoffe innerhalb der Zelle und dadurch zu Veränderungen der Stoffwechselleistungen. Sie können ebenfalls durch Hormon-Rezeptor-Wechselwirkungen ausgelöst werden, die die Wirkung von Transportproteinen in der Zellmembran beeinflussen.
Was sind Gewebshormone?
Gewebshormone umfassen eine Gruppe heterogener Stoffe, die nicht in speziellen Drüsen, sondern von verschiedenartigen Zellen oder Zellgruppen gebildet und ins Blut oder an das Nervensystem abgegeben werden. Beispiele sind Gastrin, Pancreozymin, Adrenalin, Noradrenalin, Acetylcholin, Renin, Angiotensin, Prostaglandine, Serotonin, Histamin und Bradykinin.
Was sind Drüsenhormone?
Drüsenhormone werden von endokrinen Drüsen gebildet und direkt ins Blut abgegeben. Diese Drüsen sind besonders gut durchblutet. Beispiele sind die Hormone der Hypophyse, Schilddrüse, Nebenschilddrüsen, Nebennieren, Bauchspeicheldrüse und Keimdrüsen.
Welche Rolle spielt die Hypophyse im endokrinen System?
Die Hypophyse (Hirnanhangdrüse) nimmt eine gewisse Führungsrolle im endokrinen System ein. Sie steht in enger Beziehung zum Hypothalamus und produziert glandotrope Hormone, die die peripheren Körperdrüsen zur Bildung und Freisetzung eigener Hormone veranlassen. Der Informationsaustausch zwischen Hypothalamus und Hypophyse erfolgt über Neurosekretion.
Welche Hormone werden von der Hypophyse produziert und welche Funktionen haben sie?
Der Hypophysenvorderlappen (HVL) stellt Hormone her, die die peripheren Drüsen zur Tätigkeit anregen; zwei davon wirken als Endhormone direkt auf ihr Zielgewebe (Somatotropin und Lipotropin). Der Hypophysenhinterlappen (HHL) dient als Zwischenspeicher der Hypothalamushormone Adiuretin (ADH) und Oxytocin.
Welche Funktion hat die Schilddrüse und welche Hormone produziert sie?
Die Schilddrüse ist eine inkretorische Drüse, in der mindestens vier stoffwechselaktive Jodverbindungen vorkommen, die unterschiedlich stark wirken. Darunter ist das Triiodthronin (T3) 3- bis 5mal so aktiv wie das Tetraiodthronin(Thyroxin). Thyroxin wird über das Hypophysenhormon Thyrotropin (TSH) reguliert.
Was sind die Funktionen der Nebenschilddrüsen?
Die Nebenschilddrüsen liegen hinter der Schilddrüse und regeln mit ihrem Hormon den Phosphor- und Kalkstoffwechsel.
Welche Funktion haben die Nebennieren?
Die Nebennieren bestehen aus Rinde und Mark. Die zahlreichen Hormone der Nebennierenrinde wirken regulierend auf den Wasser-, Kohlenhydrat-, Eiweiß und Fetthaushalt sowie auf die Funktion der Keimdrüsen. Das bekannteste Hormon des Marks ist das Adrenalin.
Welche Rolle spielt die Bauchspeicheldrüse im Zuckerhaushalt?
Die Bauchspeicheldrüse enthält die Langerhansschen Inseln, die die Hormone Insulin und Glucagon produzieren, welche im Zuckerhaushalt des Körpers eine wichtige Rolle spielen.
Was sind die Funktionen der Zirbeldrüse (Epiphyse) und Thymusdrüse?
Über die Leistungen der Zirbeldrüse ist wenig sicheres bekannt. Es dürfte einen hemmenden Einfluss auf die Keimdrüsenentwicklung ausüben und möglicherweise auch ein wachstumsförderndes Hormon liefern. Die Thymusdrüse ist eine Kindheitsdrüse, die das jugendliche Wachstum fördert und hemmend auf die Entwicklung der Keimdrüsen wirkt.
Welche Funktion haben die Keimdrüsen (Hoden und Eierstöcke)?
Die Leydigschen Zwischenzellen der Hoden bilden die männlichen Geschlechtshormone (Androgene, hauptsächlich Testosteron), die für die Entwicklung der Samenzellen und der sekundären männlichen Geschlechtsmerkmale unentbehrlich sind. Die Eierstöcke produzieren weibliche Geschlechtshormone (Östrogene und Progesteron), die den weiblichen Zyklus steuern und für die Ausbildung der weiblichen Geschlechtsmerkmale verantwortlich sind.
- Arbeit zitieren
- Nadir Can Altan (Autor:in), 2001, Das Hormonsystem, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/101217