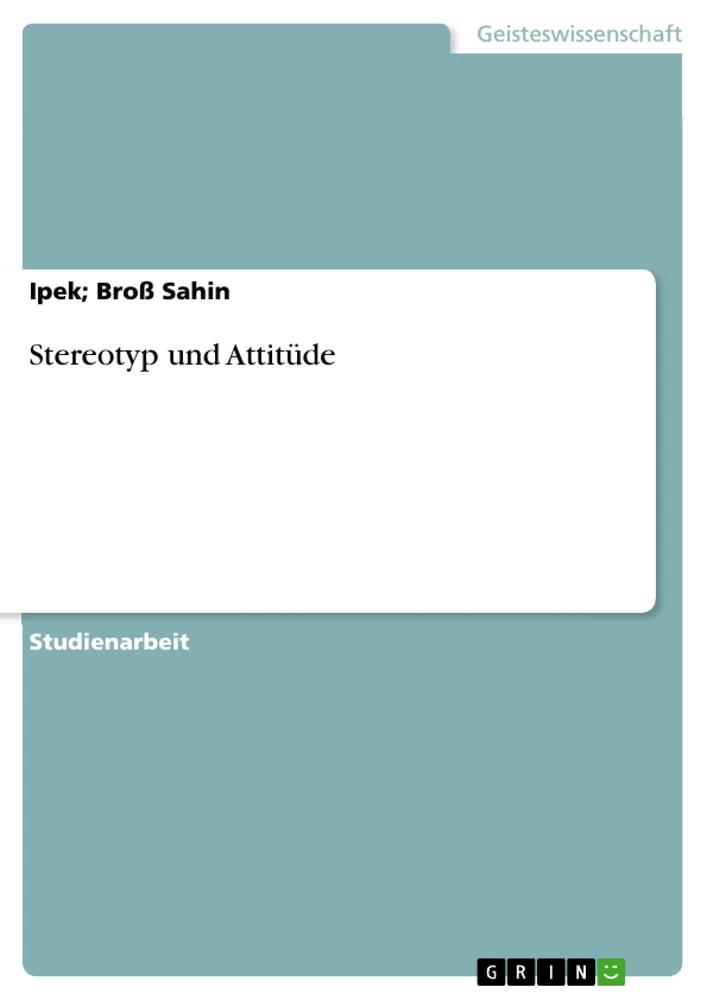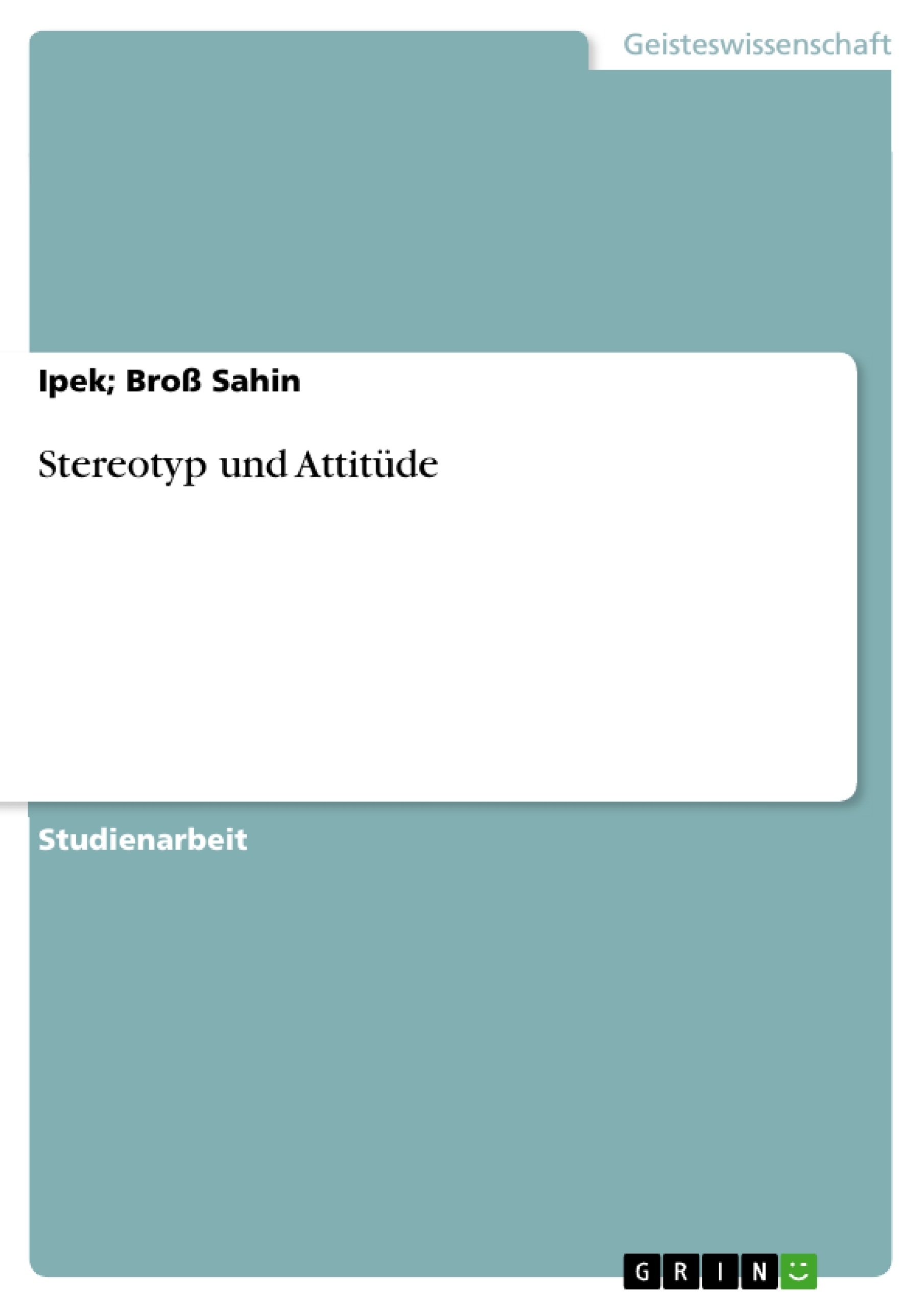Abstract
„Typisch Ausländer" ist eine Aussage, die uns allen bekannt ist. In unserem alltäglichen Leben sammeln wie die Erfahrung, sei es eine Erfahrung am eigenen Leibe oder eine Fremderfahrung, in Kategorien eingeordnet zu werden. Doch geht dabei nicht ein Teil unserer Individualität verloren? Denn man wird nicht als einzelnes Individuum, sondern nur als ein Teil, als ein Mitglied einer Gruppe gesehen. Anhand von 27 Versuchsper- sonen zwischen 20 und 25 Jahren, die drei Polaritätsprofile zu ihrem Selbstbild, zum Journalisten und zum Finanzbeamten ausgefüllt haben, wurde überprüft, ob es wirklich so ist, dass die Bewertung der Eigengruppe positiver ist, als die der Fremdgruppe.
Deswegen wollte man überprüfen, ob zwischen dem Selbstbild und dem Finanzbeam- ten ein negativer Zusammenhang besteht, und auch, ob die Urteilsübereinstimmung beim Journalisten und beim Finanzbeamten wirklich höher ist, als beim Selbstbild.
Anhand der Ergebnisse konnten wir die Hypothesen beibehalten.
Problemstellung
Oft erfährt der Mensch in seiner Umwelt, dass Vorurteile gegenüber anderen Men- schen bestehen, sei es nun auf Grund ihrer Rasse, ihres Geschlechts oder ihres Berufs. Wie aber definiert man Vorurteile?
Vorurteile sind übereinstimmende Meinungen und berechtigte Einstellungen die aber dadurch falsch werden, dass man sie verallgemeinert und Einwände sowie Ausnahmen nicht wahr haben möchte. Sie sind Klischees die ohne Rücksicht auf die Vielfalt der eigenen Umwelt gebildet werden. (Mayers Lexikon)
Bogardus (1924-25) unterschied bei der Entstehung von Vorteilen zwischen drei Hauptursachen:
1. Die Übernahme von Second-Hand Information (Jemand liest in der Zeitung, dass alle Manta-Fahrer rasen. Er wird durch den Inhalt der Medien so beeinflusst, dass der denkt das alle Manta-Fahrer rasen.)
2. Die Erfahrungen im Kindesalter. (ein Manta-Fahrer raste durch Straßen und fuhr jemanden an. Seit der Erfahrung denkt er, dass alle Manta-Fahrer rasen.)
3. Die Erfahrung im Erwachsenenalter (Man fährt mit 120 auf der Autobahn und wird von einem rasenden Manta-Fahrer überholt. Man denkt nun, das alle Manta-Fahrer rasen)
Vorurteile beinhalten zwei Komponenten, die affektive und die kognitive Komponente. Während die affektive Komponente ein wichtiges Kriterium zur Bildung von Attitüden ist, und durch ihre intensive (positive oder negative Wertung)gekennzeichnet ist, spie- gelt sich die kognitive Komponente in der Bildung von Stereotypen wieder.
Nach Secord und Backmann beruht die Bildung von Stereotypen darauf, dass
1. Urteilsgegenstände auf Grund bestimmter Merkmale in Kategorien eingeordnet werden (z.B. jemand ist geizig, er muss also Schotte sein.)
2. Eine Übereinstimmung in der Zuschreibung bestimmter Eigenschaften zu den Kate- gorien besteht. (Der Schotte ist geizig)
3. Jedem werden auf Grund seiner Zuordnung zu bestimmten Kategorien die Eigen- schaften der Kategorie zugeschrieben. (Er ist Schotte, also muss er geizig sein).
Durch die Bildung von Stereotypen vereinfacht man sich die komplexe Realität, dabei folgt man sogenannten heuristischen Prinzipien. Um sich in unserer Umwelt orientieren zu können, sucht man ständig nach Parallelen und Ähnlichkeiten zwischen den Objek- ten und Personen. „Dadurch, dass wir die Objekte trotz vieler Unterschiede auf Grund ihrer Ähnlichkeit in gewissen Eigenschaften oder Funktionen zu Äquivalenzklassen zusammenfassen und etwas als Stühle kategorisierten, sparen wir die Notwendigkeit uns in jedem Einzelfall erneut über die Eigenschaften und Funktionen eines Dinges in- formieren zu müssen. Sobald ich ein Objekt als Stuhl identifiziert habe, kenne ich seine Funktion und kann es bei Bedarf nutzen." (Stroebe) Bei der Stereotypenbildung wer- den die Informationen reduziert, organisiert und ausgearbeitet. Dies entspricht der Repräsentationsheuristik, die eine Strategie zur Zuordnung von Einzelelementen wie zum Beispiel Personen zu übergeordneten Kategorien ist. Die Repräsentationsheuristik bringt aber auch Nachteile mit sich, denn sobald man einen Gegenstand , oder eine Person in eine Kategorie einordnet, macht man Voraussagen über das wahrgenomme- ne hinaus. Die objektive Wahrscheinlichkeit wird bei der Kategorienbildung außer Acht gelassen, was zu Fehlurteilen führen kann. Bevor man aber von der Entstehung der Vorurteile bei Kategorisierungsprozessen sprechen kann, sollte erst einmal geklärt werden, wie man Stereotype messen kann.
Katz und Braly haben diese Untersuchungen 1933 begonnen. Sie gaben den Studen- ten der Universität Princeton die Aufgabe, verschiedenen Nationen 40 Eigenschaften aus einer Wortliste zuzuordnen, die ihrer Meinung nach am besten passten. Die Unter- suchung wurde 1951 von Gilbert und 1969 von Karlins, Coffimann und Walters fort- gesetzt.
Eine andere Methode um Stereotype zu erfassen ist das Polaritätsprofil, mit dem Hofstätter die Selbsteinschätzung von Wienern und Berlinern sowie die Einschätzung der Wiener durch die Berliner und die der Berliner durch die Wiener 1966 gemessen hat. Er versuchte das Heterostereotyp (über andere) mit dem Autostereotyp (über die eigene Gruppe) zu kontrastieren. Er stellte dabei unter anderem fest, dass die Beurtei- lung der jeweils anderen Stadt negativer ausfiel. Auch Quattrone und Jones haben festgestellt, dass Fremdgruppen nicht nur negativer beurteilt werden, sondern das die Fremdgruppen auch homogener beurteilt werden als Eigengruppen. Genau diese zwei Phänomene wurden untersucht. Es wird vermutet, dass erstens aufgrund der negativen Bewertung anderer die Beziehung zwischen dem Selbstbild und dem Finanzbeamten negativ ist,
Hypothese 1
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1
zeigt wie stark die durchschnittlichen Profile zusammenhängen und dass zweitens die Urteilsübereinstimmung beim Finanzbeamten am größten ist und beim Selbstbild am niedrigsten, weil die eigene Gruppe heterogener bewertet wird.
Hypothese 2
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2
zeigt die Urteilsübereinstimmung der Versuchspersonen über die Personengruppen Journalist und Finanzbeamter.
Methode
Versuchspersonen
An diesem Experiment nahmen 19 weibliche und 8 männliche Versuchspersonen teil. 24 von ihnen waren Psychologiestudenten, und drei Versuchsteilnehmer waren Stu- denten des Faches Elektro-Technik. Die Versuchspersonen wurden angesprochen, ob sie Lust hätten, bei einem Versuch teilzunehmen.
Versuchsmaterial
Das Versuchsmaterial bestand aus drei DIN A4 Blättern auf denen die Polaritätsprofi- le abgebildet waren. (s. Anhang) Über den Polaritätsprofilen stand jeweils der Begriff für den das Polaritätsprofil ausgefüllt werden sollte, so stand über dem ersten Selbst- bild, über dem zweiten Journalist und über dem dritten Finanzbeamter.
Versuchsablauf
Es handelte sich um einen Gruppenversuch. Die 27 Studenten wurden gebeten in ei- nem Raum der Universität Duisburg Platz zu nehmen und zwar so, dass zwischen ihnen ein Platz frei blieb. Es sollte verhindert werden, dass die Probanden voneinander ab- gucken und sich von ihren Nachbarn beeinflussen lassen. Die Probanden erhielten zwar die Anweisung zügig und möglichst schnell anzu kreuzen, es wurde Ihnen jedoch kein Zeitlimit gegeben. Als erstes wurden die Versuchspersonen gebeten, diese Sitz- ordnung einzunehmen. Danach wurden die Fragebögen verteilt und ihnen die Instrukti- onen zum Ausfüllen der Bögen gegeben. Nachdem alle Fragen geklärt waren, sollten die Probanden beginnen, die Bögen auszufüllen. Nach zirka 10 Minuten waren alle Versuchspersonen fertig und die ausgefüllten Bögen wurden wieder eingesammelt. Auf Wunsch wurden die Probanden danach aufgeklärt, worum es in dem Versuch ging.
Versuchsplan
Diesem Experiment liegt ein korrelativer Versuchsplan zu Grunde. Hierbei sind die jeweiligen Profilinterkorrelationen die abhängigen Variablen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1
Die drei unterschiedlichen Profile werden miteinander korreliert
Ergebnisse
Zu Beginn der Auswertung wurden die Mediane der verschiedenen Polaritätsprofile errechnet und auf die Bögen eingezeichnet, um sie untereinander zu vergleichen. (s. Anhang)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2
zeigt die einzelnen Mediane der verschiedenen Eigenschaften
Danach wurden die drei durchschnittlichen Polaritäten miteinander korreliert. Dazu berechnete man den Rang-Korrelationskoefizienten R, um das Selbstbild mit dem Journalisten zu korrelieren und das Selbstbild mit dem Finanzbeamten und den Journa- listen mit dem Finanzbeamten.
Rangkorelationskoefizient R
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3
zeigt wie stark die durchschnittlichen Polaritätsprofile miteinander korrelieren
Um die 2. Hypothese zu prüfen berechnete man noch den mittleren Quartilabstand MQ, um festzustellen ob eine Urteilsübereinstimmung bei der Beurteilung des Journa- listen und des Finanzbeamten besteht.
Durchschnittliche Streuungen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4
Die Streuungen geben an wie gross die Urteilsübereinstimmung ist.
Diskussion
In unserem Experiment beschäftigten wir uns mit den Berufsstereotypen Journalist und Finanzbeamter und mit dem Selbstbild. Wir gingen von der Annahme aus, dass das Selbstbild mit dem Finanzbeamten stark negativ korreliert und mit dem Journalisten positiv; und dass auf Grund der Urteilsübereinstimmung über das Stereotyp Finanzbe- amter die durchschnittliche Streuung des Finanzbeamten am niedrigsten ist. Auch ha- ben wir erwartet, dass die durchschnittliche Streuung beim Selbstbild am höchsten ist da man die eigene Gruppe heterogener bewertet als die Fremdgruppe. Dabei stellten wir fest, dass die Ergebnisse hypothesenkonform waren. Somit konnten wir die An- nahme von anderen Wissenschaftlern wie zum Beispiel Hofstätter, dass die Bewertung der eigenen Gruppe positiver ist als die der Fremdgruppen, und dass Fremdgruppen homogener wahrgenommen werden bestätigten.
Interessant wäre aber auch, bestehende Stereotype über Ausländer oder Rollenkli- schees zu untersuchen, weil diese gesellschaftlich relevanter sind und auch das Zusam- menleben erschweren können. Deswegen halten wir es für interessant, in späteren Experimenten die Frage zu untersuchen, ob und welche Stereotype bezüglich Auslän- dern (z.B. Türken) bestehen oder ob die deutschen heute noch Stereotype über die Juden haben. Auch wäre es interessant zu untersuchen, inwieweit die Emanzipation der Frauen bestehende Klischees über die Rollen der Geschlechter beseitigt hat. Dazu könnte man auch das Polaritätsprofil benutzen und mit anderen Begriffen wie zum Bei- spiel „Türke", „Jude", „Pole" und „Deutscher" beschriften. Oder um die Geschlechts- stereotype zu vergleichen, „Frau“ und „Mann“, und um ein differenzierteres Bild zu erhalten Hausfrauen und Hausmänner, Karrierefrauen und -Männer, oder zum Beispiel Männer in typischen Frauenberufen (Pfleger, Erzieher) und Frauen in Männerberufen (Computerspezialistin, Mathematikerin).
Wenn man den Probanden beim Versuch das Gefühl gibt, ihre Angaben seien anonym könnte man so verhindern, dass sie sozial erwünscht ankreuzen. Bei unseren Ergebnis- sen kreuzen die Probanden nämlich beim Selbstbild für positive und sozial erwünschte Eigenschaften wie zum Beispiel Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit sehr hohe Werte an. Dazu könnte man das Polaritätsprofil am Computer ausfüllen lassen, so dass der Proband das Gefühl hat der Versuchsleiter sieht es nicht, weil er ihm den Bogen nicht geben muss, sondern die Ergebnisse im Computer gespeichert werden. Man könnte auch sehr viel mehr Probanden gewinnen, wenn man die Untersuchung unter anderem auch im Internet durchführt. Hier ist auch das subjektive Gefühl der Anonymität grö- ßer, was zu ehrlicheren Antworten führen kann.
Literatur
Bogardus,M (1924-1925)Social distance and itsorigin inJournal of aplied socio- logy
Stroebe,W (1992)Sozialpsychologie eine Einführung Heidelberg: Springer- Lehrbuch
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes?
Der Text untersucht Vorurteile und Stereotypen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Selbstbild und der Wahrnehmung von Berufsgruppen wie Journalisten und Finanzbeamten. Es wird untersucht, ob die Bewertung der Eigengruppe positiver ist als die der Fremdgruppe und ob die Urteilsübereinstimmung innerhalb der Fremdgruppen höher ist.
Wie wurden Vorurteile definiert?
Vorurteile werden als übereinstimmende Meinungen und berechtigte Einstellungen definiert, die jedoch durch Verallgemeinerung und das Ignorieren von Einwänden und Ausnahmen falsch werden. Sie sind Klischees, die ohne Rücksicht auf die Vielfalt der eigenen Umwelt gebildet werden.
Welche Hauptursachen für die Entstehung von Vorurteilen werden genannt?
Es werden drei Hauptursachen genannt: die Übernahme von Second-Hand-Informationen, Erfahrungen im Kindesalter und Erfahrungen im Erwachsenenalter.
Welche Komponenten beinhalten Vorurteile?
Vorurteile beinhalten zwei Komponenten: die affektive Komponente (Wertung) und die kognitive Komponente (Stereotypenbildung).
Wie funktioniert die Bildung von Stereotypen nach Secord und Backmann?
Die Bildung von Stereotypen beruht darauf, dass Urteilsgegenstände aufgrund bestimmter Merkmale in Kategorien eingeordnet werden, eine Übereinstimmung in der Zuschreibung bestimmter Eigenschaften zu den Kategorien besteht und jedem aufgrund seiner Zuordnung zu bestimmten Kategorien die Eigenschaften der Kategorie zugeschrieben werden.
Welche Methoden wurden zur Erfassung von Stereotypen verwendet?
Frühere Studien verwendeten Methoden wie das Zuordnen von Eigenschaften zu Nationen (Katz und Braly) und das Polaritätsprofil (Hofstätter) zur Messung von Selbsteinschätzungen und Fremdeinschätzungen.
Welche Hypothesen wurden in der Studie aufgestellt?
Es wurde vermutet, dass erstens aufgrund der negativen Bewertung anderer die Beziehung zwischen dem Selbstbild und dem Finanzbeamten negativ ist. Zweitens wurde angenommen, dass die Urteilsübereinstimmung beim Finanzbeamten am größten ist und beim Selbstbild am niedrigsten, weil die eigene Gruppe heterogener bewertet wird.
Wie war der Versuchsaufbau der Studie?
An dem Experiment nahmen 27 Versuchspersonen (19 weibliche und 8 männliche) teil, hauptsächlich Psychologiestudenten. Sie füllten Polaritätsprofile zu ihrem Selbstbild, zum Journalisten und zum Finanzbeamten aus.
Was war das Ziel des Versuchs?
Das Ziel war, die Zusammenhänge zwischen dem Selbstbild und der Wahrnehmung von Journalisten und Finanzbeamten zu untersuchen und die Urteilsübereinstimmung innerhalb der Gruppen zu analysieren.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse bestätigten die Hypothesen, dass das Selbstbild negativ mit dem Bild des Finanzbeamten korreliert und dass die Urteilsübereinstimmung beim Finanzbeamten höher ist als beim Selbstbild.
Welche möglichen Weiterführungen der Forschung werden vorgeschlagen?
Es wird vorgeschlagen, Stereotypen über Ausländer oder Rollenklischees zu untersuchen, da diese gesellschaftlich relevanter sind. Auch die Auswirkungen der Emanzipation der Frauen auf bestehende Geschlechterstereotype könnten untersucht werden. Weiterhin, das Anonymität durch Online-Umfragen zur Ehrlichkeit der Antworten beitragen kann.
- Quote paper
- Ipek; Broß Sahin (Author), 2001, Stereotyp und Attitüde, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/100959