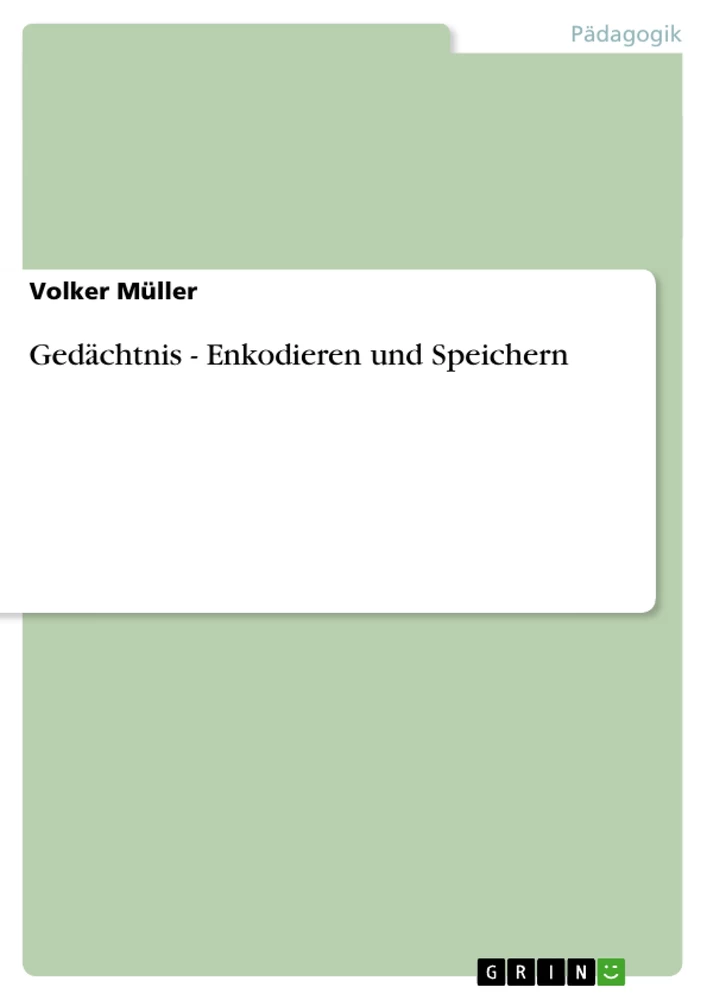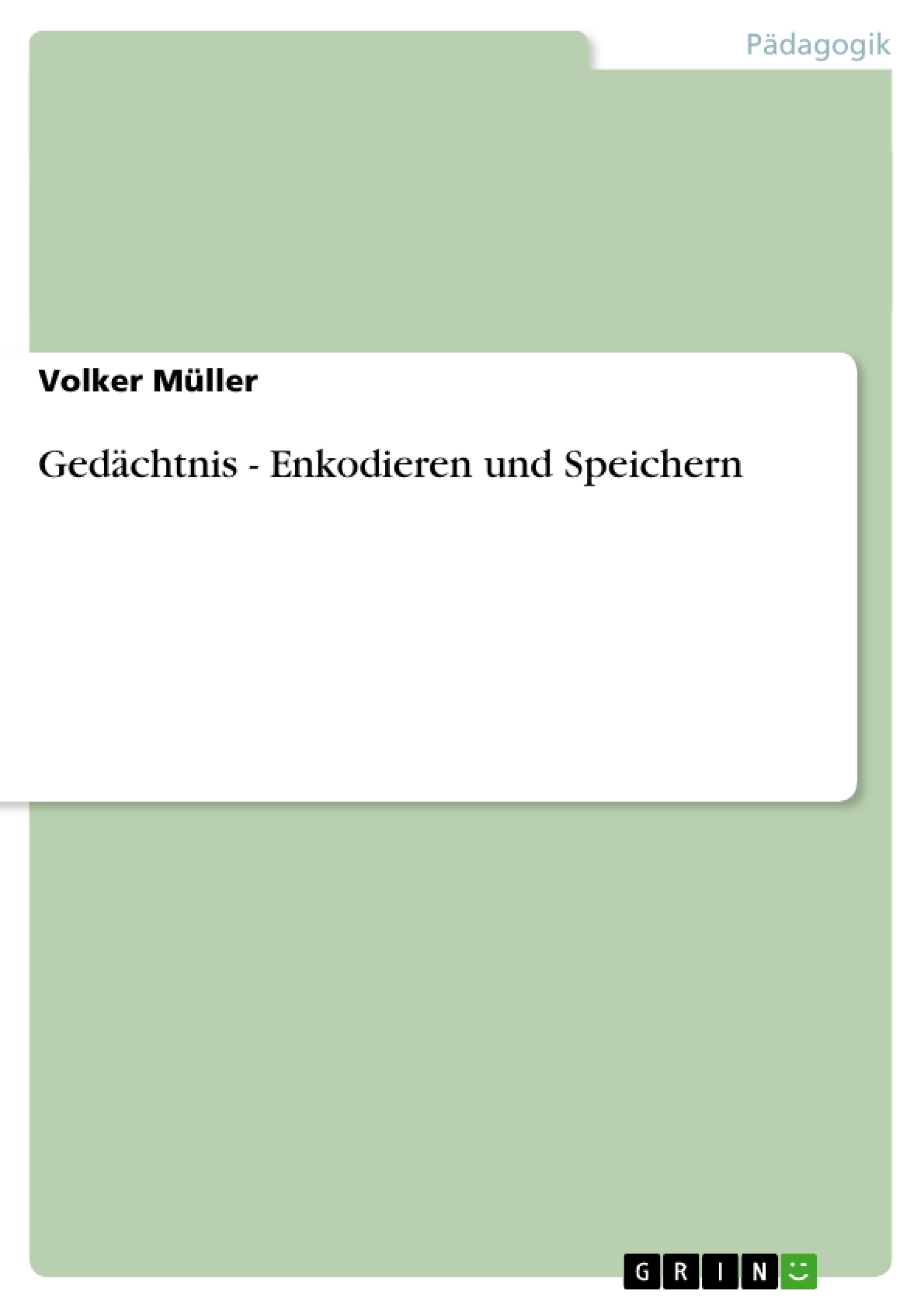Haben Sie sich jemals gefragt, wie unsere Erinnerungen entstehen, gespeichert und wieder abgerufen werden? Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des menschlichen Gedächtnisses mit dieser aufschlussreichen Analyse von Enkodierung und Speicherung. Dieses Buch enthüllt die komplexen Prozesse, die unserem Erinnerungsvermögen zugrunde liegen, von den flüchtigen Momenten, die im sensorischen Gedächtnis festgehalten werden, bis hin zu den tief verwurzelten Erfahrungen, die im Langzeitgedächtnis gespeichert sind. Entdecken Sie die Unterschiede zwischen implizitem und explizitem Gedächtnis und erforschen Sie die verschiedenen Gedächtnissysteme, die zusammenarbeiten, um unsere Wahrnehmung und unser Verhalten zu formen. Erfahren Sie mehr über die Kapazitätsgrenzen des Kurzzeitgedächtnisses und die cleveren Techniken, die wir anwenden, um diese zu überwinden, wie Wiederholung und Chunking. Untersuchen Sie die physiologischen Grundlagen des Gedächtnisses und die Rolle verschiedener Hirnareale bei der Aufrechterhaltung von Informationen. Das Buch beleuchtet auch die Bedeutung von Enkodierungsprozessen, wie z.B. Enkodierungsspezifität, serieller Positionseffekt und Verarbeitungstiefe, und bietet Strategien zur Verbesserung der Enkodierung und Gedächtnisleistung. Abschließend werden die Strukturen im Langzeitgedächtnis analysiert, von Begriffen und Prototypen bis hin zu Hierarchien und Schemata, um zu verstehen, wie wir Erfahrungen organisieren und Muster erkennen. Dieses Werk bietet einen umfassenden Einblick in die Kognitionstheorie, Lernen und Denken, ideal für Studierende der Psychologie, Neurowissenschaften und alle, die ihr Verständnis des menschlichen Geistes vertiefen möchten. Es werden Schlüsselkonzepte wie das Arbeitsgedächtnis, Abrufprozesse und Mnemotechniken erläutert, um das Erinnerungsvermögen zu optimieren.
Autor: Volker Müller
Gedächtnis - Enkodieren und Speichern
WWU Münster
Wintersemester 2000/2001
Seminar : Kognitionstheorie I - Lernen und Denken
Dozent : Prof. Dr. Sturzebecher
Gedächtnis bezeichnet das System im Gehirn, welches Erinnern von Informationen möglich macht. In der Kognitionstheorie wird Erinnern als eine Form der Informationsverarbeitung untersucht.
Erinnern wird als Prozess aus drei Stufen betrachtet :
1.Enkodieren (Enkodierung) : Erstmalige Verarbeitung von Informationen, die zu einer Repräsentation im Gedächtnis führt.
2.Speichern (Speicherung) : Aufbewahrung des enkodierten Materials über die Zeit
3.Abrufen (Retrieval) : Wiederauffinden der gespeicherten Informationen zu einem späteren Zeitpunkt.
Es werden zwei Gedächtnisarten unterschieden :
Implizites Gedächtnis : Ohne Anstrengung und bewusstes Suchen erinnert sich eine Person an Informationen.
Explizites Gedächtnis :Die Person unternimmt gezielte Anstrengungen, sich Informationen ins Bewusstsein zu rufen.
Es werden drei Gedächtnissysteme unterschieden :
(dieses Modell konnte leider nicht dargestellt werden - d.Red.)
(Hierbei handelt es sich nicht um physiologisch getrennte Komponenten.)
Abb. 1 Gedächtnismodell
Sensorisches Gedächtnis
Bei der Enkodierung für das sensorische Gedächtnis wird Reizenergie in einen neutralen Code umgewandelt. Das sensorische Gedächtnis verfügt über eine große Aufnahmekapazität, jedoch nur für kurze Dauer (visuell 0,5 s, auditiv bis zu 2 s). Aufmerksamkeit und Mustererkennung helfen, sensorische Informationen in das Kurzzeitgedächtnis zu übermitteln.
Unterteilung in zwei Bereiche :
Ikonisches Gedächtnis : visueller Bereich (Nachweis durch Sperling 1960)
Echoartiges (echoisches) Gedächtnis : akustischer Bereich
Kurzzeitgedächtnis
Das Kurzeitgedächtnis bezeichnet ein System (oder eine komplexe Kette von aufeinander einwirkenden Untersystemen), das eine kurzzeitige Speicherung von unwichtigen Informationen ermöglicht. Es kann Material aus dem sensorischen oder dem Langzeitgedächtnis übermittelt bekommen. Nur im Kurzzeitgedächtnis können Informationen bewusst verarbeitet werden. Es wird deshalb auch als Arbeitsgedächtnis bezeichnet uns ist ein Teil unserer psychologischen Gegenwart ist. Hierbei wird es als System verstanden , mit dessen Hilfe mehre Informationen gleichzeitig festgehalten und zueinander in Beziehung gesetzt werden können.
Kapazitätsbegrenzung : Dieses ist die wichtigste Eigenschaft des Kurzzeitgedächtnis. Die reine Kapazität liegt bei 2 - 4 Einheiten. Diese Kapazitätsbegrenzung wirkt als eine Art Filter um bestimmte Objekte und Ereignisse aus einer riesigen Informationsmenge auszuwählen, auf die wir unsere Aufmerksamkeit richten. Durch diesen Filter kann der Mensch seine kognitiven Ressourcen klar ausrichten.
Trotz dieser Einschränkung funktioniert das Kurzzeitgedächtnis bis zu 7 Einheiten (Gedächtnisspanne) weiterhin gut. Das liegt daran, dass der Mensch im Alltag zwei Gedächtnistechniken einsetzt :
Wiederholen : Durch einfaches oder erhaltendes Wiederholen wird die Information im Kurzzeitgedächtnis festgehalten. Ohne Wiederholung fangen die Information nach drei Sekunden an aus dem Kurzzeitgedächtnis zu verschwinden.
Chunking : Bei diesem Vorgang wird aus mehren einzelnen Informationseinheiten eine bedeutungstragende Informationseinheit zusammengesetzt, die als Chunk bezeichnet wird. Durch Chunking spart der Mensch Gedächtniskapazität. (Beispielsweise lassen sich die vier Ziffern -1-, -9-, -7-, -6-, zu einem Chunk als Jahreszahl 1976 zusammenfassen.)
Abrufen : Das Abrufen (Retrieval) aus dem Kurzzeitgedächtnis ist ein Prozess mit sehr hoher Geschwindigkeit. Wahrscheinlich erfolgt das Abrufen durch eine vollständige serielle Abtastung aller Elemente (35 ms pro Element) eines im Kurzzeitgedächtnis gespeicherten Sets von Informationen. Es scheint ein optimales Zusammenspiel von Abrufkapazität und Verarbeitungseffiziens zu geben.
Kontroverse : Viele Forscher lehnen die Kurzzeitgedächtnistheorie ab. Baddeley geht von einer Reihe von Hilfssystemen (räumlich-visueller Notizblock und artikulatorische Schleife) aus, die Informationen im Arbeitsgedächtnis aufrechterhalten. Diese Prozesse werden von einer zentralen Exekutive kontrolliert.
Physiologie : Unterschiedliche Areale des frontalen Cortex scheinen für die Aufrechterhaltung unterschiedlicher Arten von Informationen im Kurzzeit- / Arbeitsgedächtnis verantwortlich zu sein.
Langzeitgedächtnis
Das Langzeitgedächtnis einer Person besteht aus den gesamten Erfahrungen, Informationen, Emotionen, Fertigkeiten, Wörtern, Begriffsklassen, Regeln und Urteilen, die diese Person über die gesamte Lebensspanne gespeichert hat. Die Kapazität des Langzeitgedächtnisses ist theoretisch unbegrenzt und die Informationen können ein Leben lang bestehen bleiben. Somit ist das Gesamtwissen einer Person über die Welt und sich selbst im Langzeitgedächtnis biochemisch abgespeichert.
Das Langzeitgedächtnis wird wie folgt unterteilt :
Prozedurale Gedächtnis : System für Fertigkeiten - wie Dinge getan werden.
Episodische Gedächtnis : System für das Erinnern an Ereignisse, die auf persönlichen Erfahrungen beruhen; es speichert biographische Informationen.
Das semantische Gedächtnis: Das System für die grundlegende Bedeutung von Wörtern und Begriffen.
(Das semantische und das episodische Gedächtnis werden oftmals zum deklarativen Gedächtnis zusammenfasst.)
Enkodierungsprozesse
Bedeutungsvolle Organisation ist der Schlüssel zur Enkodierung ins Langzeitgedächtnis. Je spezifischer Material hinsichtlich der zu erwartenden Abrufhinweise enkodiert wird, um so effektiver wird der spätere Abruf sein.
Die folgenden Erkenntnisse stammen aus der Forschung zum expliziten Gedächtnis :
Enkodierungsspezifität : Zusammenhang von Information und Kontext, in dem sie gelernt wird. (Übereinstimmung der Kontexte des Enkodierens und Abrufen erhöhen die Gedächtnisleistung.)
serieller Positionseffekt : Dieser Effekt bei verschiedenen Experimenten bezieht sich die Reihenfolge (zeitlicher Kontext) in der Informationen gespeichert werden. Hierbei sind zwei Begriffe von Bedeutung
Primancy-Effekt :
Die ersten Elemente einer Informationskette werden besser behalten als die mittleren, obwohl sie zeitlich länger zurückliegen. Jedesmal, wenn man etwas Neues beginnt richtet man für seine Aktivität einen neuen Kontext ein. Innerhalb dieses neuen Kontextes stechen die ersten paar Erfahrungen besonders hervor.
Recency-Effekt :
Die letzten Elemente einer Informationskette werden besser behalten als die mittleren.
Kontextuelle Distinktheit :
Der zeitliche Abstand zwischen den Elementen einer Informationskette spielt bei der Enkodierung ebenfalls eine wichtige Rolle. Durch eine proportionale Anordnung des Abstandes der Zeitpunkte, zu denen die Elemente der Informationskette gespeichert werden kann die Erinnerungleistung an die mittleren Elemente einer Informationkette gesteigert werden.
Verarbeitungstiefe : Der Grad an Aufmerksamkeit, den eine Person während des Enkodierens den Informationen widmet, hat einen Einfluss auf den Abrufungsprozess.
Theorie der Verarbeitungstiefe : Wenn die Informationsverarbeitung mehr Analyse, mehr Interpretation, mehr Vergleich und sorgfältige Ausarbeitung beinhaltet, dann ergibt sich daraus eine bessere Erinnerung. Die Verarbeitungstiefe bestimmt den Umfang des Erinnerns stärker als die Lernmotivation.
Die folgenden Erkenntnisse stammen aus der Forschung zum impliziten Gedächtnis :
Priming-Effekt : Durch die Beschäftigung mit einer Information, beispielsweise ihrer Bewertung, wird diese implizit abgespeichert. Durch diese Vorerfahrung mit der Informationen kann diese später leichter abgerufen werden.
Enkodierungszusammenhang :Wenn die Art und Weise der Verarbeitung* von Informationen bei der Enkodierung und dem späteren Abrufen identisch ist, wird die Information am wirksamsten abgerufen.
*(Art und Weise der Verarbeitung : z.B. physikalische Merkmale oder Bedeutung eines Begriffs / geistige Tätigkeit in deren Rahmen der Begriff auftaucht.)
Strategien zur Verbesserung der Enkodierung :
_Elaboriertes Wiederholen
_mentale Bilder / visuelle Vorstellungen
_Mnemotechniken :
- Loci-Methode
- Wort- und Tonassoziationen
- Akronym-Mnemotechnik
Metagedächtnis : Bezeichnung für die Kognitionen, die das Denken über das Gedächtnis betreffen. Das Gefühl, etwas zu wissen, trifft im allgemeinen zu. Hierfür gibt es zwei Erklärungshypothesen :
- Hypothese der Vertrautheit mit der Abrufhilfe
- Zugänglichkeitshypothese
Strukturen im Langzeitgedächtnis
Eine wesentliche Aufgabe des Gedächtnisses besteht darin, einander ähnliche Erfahrungen zusammenzuführen, damit der Person das Erkennen von Mustern in der Interaktion mit der Umwelt ermöglicht wird. Aus zahllosen Einzelereignissen müssen ständig Informationen extrahiert werden, die zu einer kleineren, einfacheren Menge zusammentgesetzt werden, damit sie kognitiv zu bewältigen werden können.
Begriff : Summarische Einheit für die mentalen Repräsentationen einer bestimmten Menge von Erfahrungen mit der Welt. Begriffe repräsentieren Objekte, Klassen von Objekten oder eine Kategorie von Erfahrungen.
(z. B. Die Begriffe Tier, Käse, Kurvendiskussion, Gerhard Schröder)
Prototyp :Aus den Elementen einer Kategorien von Erfahrungen bildet sich als Mittelwert ein Prototyp. Dieser verändert sich bei jeder neuen Erfahrung aus dieser Kategorie.
(z. B. der Prototyp des Begriffs Hund, Student oder Stein)
Hierachie :Verschiedene Begriffe werden im Gedächtnis zu einer sinnvollen hierachischen Struktur kategorisiert um möglichst effizient mit ihnen arbeiten (z.B. denken, erkennen oder bewerten) zu können.
(z.B. Tier -> Fisch -> Lachs oder Psychologie -> Lerntheorie -> Bandura -> Reproduktionsphase)
Basisniveau: Es gibt für Menschen ein optimales Niveau, auf dem sie Gegenstände kategorisieren. Dieses Basisniveau hängt von der Zahl der Erfahrungen zu einem Gegenstand ab.
Schema : Die Begriffe im Gedächtnis werden zu größeren Einheiten organisiert. Ein Schema entsteht aus den durchschnittlichen Erfahrungen mit den Strukturen in der Umwelt, die mit einen Begriff bilden. Die Schemata enthalten deshalb nicht alle Einzelheiten der unterschiedlichen Begriffe sondern sind eine komplexe Verallgemeinerung.
(z.B. haben wir alle implizit ein Schema von ,,Klassenzimmer", ,,Frühstück" oder ,,Technoparty")
Nutzung der Strukturen : Klassifikation, Erklärung, Vorhersage, Schlussfolgerung, Kommunikation
Literatur :
Zimbardo, Ph. G., Psychologie (7. Auflage). Berlin / Heidelberg: Springer, 1992. (7. Aufl. 1999).
Baddeley, A., So denkt der Mensch: Unser Gedächtnis und wie es funktioniert (Orig. 1982). München: Droemer-Knaur, 1986
Anderson, J.R., Kognitive Psychologie (2. Auflage). Heidelberg: Spektrum Akad. Verlag, 1996
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Gegenstand des Dokuments "Gedächtnis - Enkodieren und Speichern"?
Das Dokument behandelt die Grundlagen des Gedächtnisses, insbesondere die Prozesse des Enkodierens und Speicherns von Informationen. Es werden verschiedene Gedächtnissysteme und -arten vorgestellt, sowie Strategien zur Verbesserung der Gedächtnisleistung diskutiert.
Was sind die drei Stufen des Erinnerungsprozesses laut diesem Dokument?
Der Erinnerungsprozess wird in drei Stufen unterteilt: Enkodieren (erstmalige Verarbeitung von Informationen), Speichern (Aufbewahrung des enkodierten Materials) und Abrufen (Wiederauffinden der gespeicherten Informationen).
Welche Arten von Gedächtnis werden unterschieden?
Es werden zwei Hauptarten von Gedächtnis unterschieden: Implizites Gedächtnis (unbewusstes Erinnern) und Explizites Gedächtnis (bewusstes Erinnern).
Welche Gedächtnissysteme werden beschrieben?
Es werden drei Gedächtnissysteme beschrieben: das Sensorische Gedächtnis, das Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis.
Was sind die Hauptmerkmale des Sensorischen Gedächtnisses?
Das Sensorische Gedächtnis hat eine große Aufnahmekapazität, aber eine sehr kurze Speicherdauer (0,5 s für visuelle Informationen, bis zu 2 s für auditive Informationen). Es unterteilt sich in das Ikonische Gedächtnis (visuell) und das Echoartige Gedächtnis (akustisch).
Was sind die Hauptmerkmale des Kurzzeitgedächtnisses (Arbeitsgedächtnis)?
Das Kurzzeitgedächtnis dient der kurzzeitigen Speicherung unwichtiger Informationen. Es hat eine begrenzte Kapazität (2-4 Einheiten). Wichtige Techniken zur Erweiterung der Kapazität sind Wiederholen und Chunking.
Was ist Chunking?
Chunking ist der Prozess, bei dem mehrere einzelne Informationseinheiten zu einer bedeutungstragenden Einheit (Chunk) zusammengefasst werden, um Gedächtniskapazität zu sparen.
Was sind die Hauptmerkmale des Langzeitgedächtnisses?
Das Langzeitgedächtnis speichert Erfahrungen, Informationen, Emotionen, Fertigkeiten usw. über die gesamte Lebensspanne. Seine Kapazität ist theoretisch unbegrenzt. Es wird unterteilt in Prozedurales Gedächtnis, Episodisches Gedächtnis und Semantisches Gedächtnis.
Was ist der serielle Positionseffekt?
Der serielle Positionseffekt beschreibt, wie die Position von Informationen in einer Reihenfolge die Wahrscheinlichkeit beeinflusst, dass sie erinnert werden. Er umfasst den Primacy-Effekt (bessere Erinnerung an die ersten Elemente) und den Recency-Effekt (bessere Erinnerung an die letzten Elemente).
Was ist die Theorie der Verarbeitungstiefe?
Die Theorie der Verarbeitungstiefe besagt, dass die Intensität der Informationsverarbeitung (Analyse, Interpretation, Vergleich) während des Enkodierens die Gedächtnisleistung beeinflusst. Tiefere Verarbeitung führt zu besserer Erinnerung.
Was ist der Priming-Effekt?
Der Priming-Effekt beschreibt, dass die vorherige Beschäftigung mit einer Information (z.B. Bewertung) das spätere Abrufen dieser Information erleichtert.
Welche Strategien zur Verbesserung der Enkodierung werden genannt?
Genannt werden elaboriertes Wiederholen, mentale Bilder/visuelle Vorstellungen und Mnemotechniken (z.B. Loci-Methode, Wort- und Tonassoziationen, Akronym-Mnemotechnik).
Was ist Metagedächtnis?
Metagedächtnis bezeichnet das Denken über das Gedächtnis, also das Wissen über die eigenen Gedächtnisfähigkeiten und -prozesse.
Welche Strukturen im Langzeitgedächtnis werden beschrieben?
Beschrieben werden Begriffe, Prototypen, Hierarchien und Schemata.
Was sind Schemata?
Schemata sind größere Einheiten, in die Begriffe im Gedächtnis organisiert werden. Sie entstehen aus durchschnittlichen Erfahrungen mit Strukturen in der Umwelt und sind komplexe Verallgemeinerungen.
Welche Literatur wird als Quelle angegeben?
Als Literatur werden angegeben: Zimbardo, Ph. G., Psychologie (7. Auflage). Berlin / Heidelberg: Springer, 1992. (7. Aufl. 1999). Baddeley, A., So denkt der Mensch: Unser Gedächtnis und wie es funktioniert (Orig. 1982). München: Droemer-Knaur, 1986 und Anderson, J.R., Kognitive Psychologie (2. Auflage). Heidelberg: Spektrum Akad. Verlag, 1996.
- Arbeit zitieren
- Volker Müller (Autor:in), 2001, Gedächtnis - Enkodieren und Speichern, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/100919