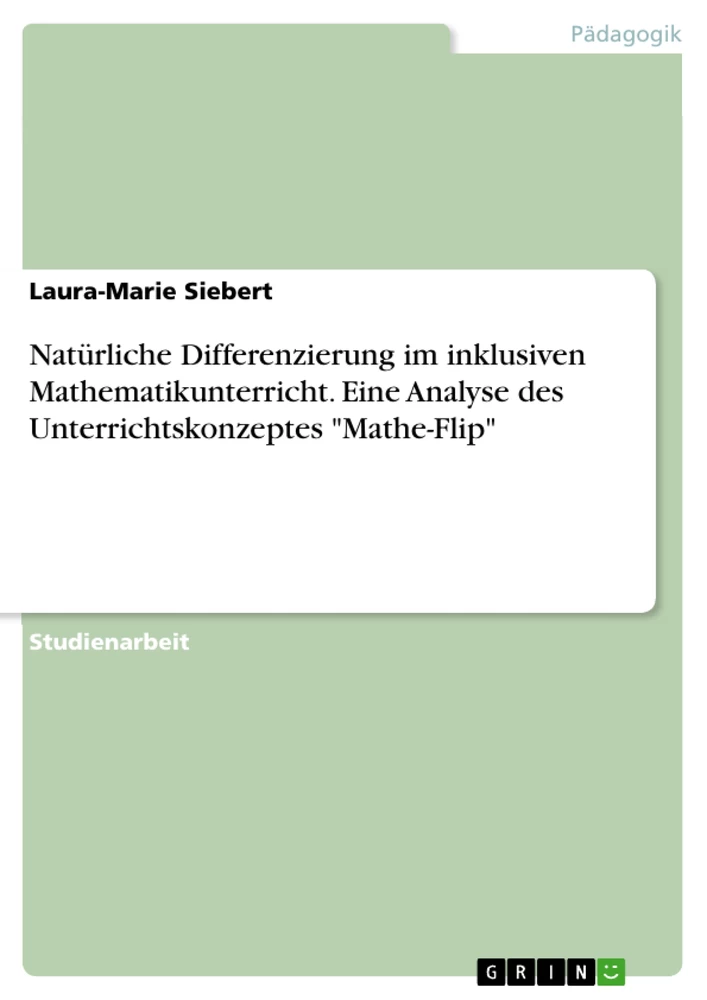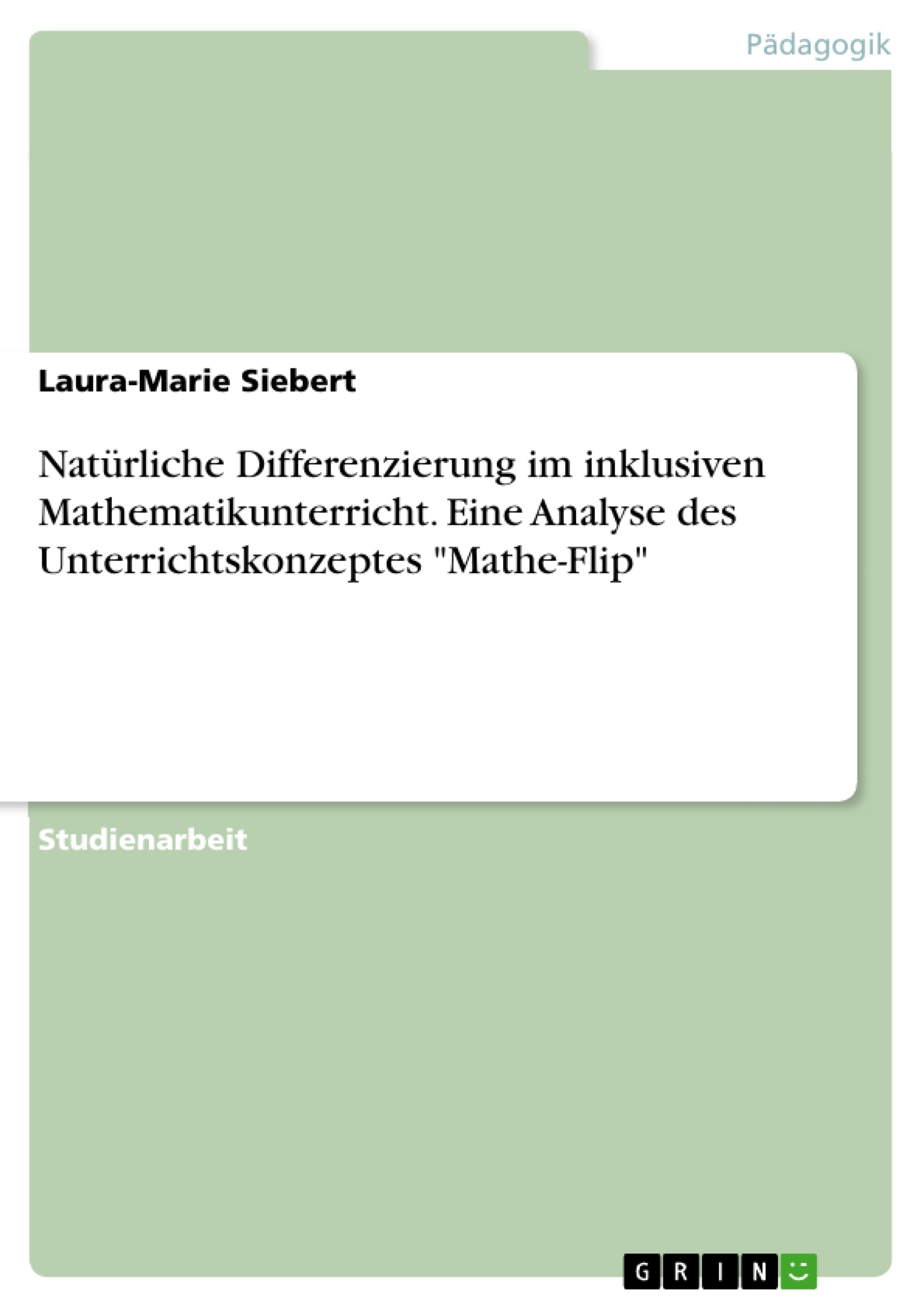Das Konzept "Mathe-Flip" wird in der vorliegenden Hausarbeit einer genaueren Betrachtung unterzogen und folgende Frage beantwortet: Inwiefern genügt das Unterrichtskonzept "Mathe-Flip" den Ansprüchen eines inklusiven Mathematikunterrichts unter besonderer Berücksichtigung der natürlichen Differenzierung? Im ersten Teil der Arbeit wird das Unterrichtskonzept genauer beschrieben und die drei zur Analyse stehenden Aufgaben vorgestellt. Dabei werden auch die Erläuterungen der Erstellerinnen selbst mit einbezogen, um auch diese mithilfe der Ergebnisse der Hausarbeit zu überprüfen. Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit der genaueren Definition eines inklusiven Mathematikunterrichts, wobei besonders die Rolle der natürlichen Differenzierung dargelegt wird und ihre Merkmale und Kriterien erläutert werden. Danach werden die vorgestellten Aufgaben anhand dieser Merkmale und Kriterien analysiert und auf ihre Tauglichkeit hinsichtlich eines inklusiven Mathematikunterrichts überprüft. Dabei werden die Bedürfnisse von Schüler:innen mit einem FSP Lernen besonders mit einbezogen. Die Ergebnisse dieses Abschnitts werden im Fazit noch einmal pointiert zusammengefasst und
ein abschließendes Resümee hinsichtlich der anfänglichen Fragestellung gezogen.
Inklusion ist ein Thema, mit dem sich alle Studierende in der Lehramtsausbildung beschäftigen müssen – zu Recht, im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Beschulung aller, auch sog. Inklusionskinder, ist im 9. Schuländerungsgesetz verankert. Die Heterogenität von Lerngruppen ist heutzutage stärker als je zuvor. Gleichzeitig gilt der Anspruch jedem Kind die Möglichkeit zu bieten, sich und seine Kompetenzen bestmöglich zu entwickeln und gemeinsam mit und von anderen zu lernen. Jedes Konzept, das für eben jenen inklusiven Unterricht und hier im Speziellen den inklusiven Mathematikunterricht erstellt wurde, sollte diesen Ansprüchen genügen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Vorstellung des Konzeptes „Mathe-Flip“ und des Materials
- 3. Natürliche Differenzierung im inklusiven Mathematikunterricht
- 3.1 Inklusion und inklusiver Unterricht nach UN-BRK und KMK
- 3.2 Natürliche Differenzierung
- 3.2.1 Der gemeinsame Gegenstand
- 3.2.2 Offenheit
- 3.2.3 Komplexität
- 3.2.4 Kooperatives Lernen
- 4. Analyse des Materials
- 4.1 Mit einem Blick
- 4.2 Flip räumt auf
- 4.3 Meine Lieblingszahl
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Unterrichtskonzept „Mathe-Flip“ hinsichtlich seiner Eignung für inklusiven Mathematikunterricht unter besonderer Berücksichtigung der natürlichen Differenzierung. Es wird analysiert, inwieweit das Konzept den Ansprüchen eines inklusiven Unterrichts gerecht wird und die Bedürfnisse von Schüler*innen mit Förderbedarf berücksichtigt.
- Beschreibung des Unterrichtskonzepts „Mathe-Flip“
- Definition von inklusivem Mathematikunterricht und der Rolle der natürlichen Differenzierung
- Analyse von ausgewählten Aufgaben aus „Mathe-Flip“ bezüglich ihrer Inklusivität
- Bewertung der Eignung von „Mathe-Flip“ für die Förderung von Schüler*innen mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen
- Zusammenfassende Beurteilung der Tauglichkeit des Konzepts für inklusiven Mathematikunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des inklusiven Mathematikunterrichts ein und hebt die Bedeutung der UN-Behindertenrechtskonvention und des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes hervor. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Eignung des Konzepts „Mathe-Flip“ für inklusiven Unterricht und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Heterogenität heutiger Lerngruppen und der Anspruch, jedem Kind optimale Lernmöglichkeiten zu bieten, werden als Ausgangspunkt der Untersuchung benannt. Die Arbeit kündigt eine detaillierte Beschreibung des Konzepts „Mathe-Flip“ an, gefolgt von einer Analyse der ausgewählten Aufgaben im Kontext inklusiven Unterrichts unter besonderer Berücksichtigung der natürlichen Differenzierung.
2. Vorstellung des Konzeptes „Mathe-Flip“ und des Materials: Dieses Kapitel präsentiert das von Melanie Frank und Heike Müller entwickelte Unterrichtskonzept „Mathe-Flip“. Es beschreibt die grundlegenden Prinzipien des Konzepts, die auf Förderung, lernstandorientiertem, individualisierten und produktivem Lernen basieren. Das Konzept gliedert den Unterricht in „Flip-Zeit“ (inhaltliche Kompetenzen) und „Entdecker-Zeit“ (prozessbezogene Kompetenzen). Die Kapitel erläutert das Spiralprinzip der Differenzierung innerhalb der „Flip-Zeit“, wobei alle Schüler*innen denselben Inhalt bearbeiten, und betont die Offenheit der Aufgaben für unterschiedliche Kompetenzniveaus. Es werden die drei im Folgenden analysierten Aufgaben aus dem „Mathe-Flip“-Material vorgestellt, die aus der „Flip-Zeit“ und der „Entdecker-Zeit“ stammen und für die Schuleingangsphase konzipiert sind. Die Auswahl dieser Aufgaben wird begründet und deren Repräsentativität für das gesamte Konzept hervorgehoben.
3. Natürliche Differenzierung im inklusiven Mathematikunterricht: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse des „Mathe-Flip“-Konzepts. Es beginnt mit einer Erörterung der UN-Behindertenrechtskonvention und der KMK-Empfehlungen zum inklusiven Unterricht, um die rechtlichen und bildungspolitischen Rahmenbedingungen zu verdeutlichen. Der Schwerpunkt liegt auf der natürlichen Differenzierung als Alternative zur Binnendifferenzierung. Die Kapitel erläutert die Kernmerkmale der natürlichen Differenzierung, wie den gemeinsamen Gegenstand, die Offenheit der Aufgaben, die Komplexität und das kooperative Lernen, und betont deren Bedeutung für einen inklusiven und alltagstauglichen Mathematikunterricht. Der Abschnitt 3.2.1 "Der gemeinsame Gegenstand" verdeutlicht den Fokus auf den Lerngegenstand und die Bereitstellung verschiedener Zugangsmöglichkeiten für die Schüler*innen, um jedem Kind den Zugang zum Lerninhalt zu ermöglichen.
Schlüsselwörter
Inklusion, inklusiver Mathematikunterricht, natürliche Differenzierung, Mathe-Flip, UN-Behindertenrechtskonvention, KMK, Förderbedarf, Lernstandorientierung, individuelle Förderung, offene Aufgaben, gemeinsamer Gegenstand, Kompetenzentwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu „Mathe-Flip“ im inklusiven Mathematikunterricht
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Unterrichtskonzept „Mathe-Flip“ auf seine Eignung für inklusiven Mathematikunterricht, insbesondere im Hinblick auf natürliche Differenzierung. Sie beinhaltet eine Einleitung, die Vorstellung des Konzepts und des Materials, eine theoretische Auseinandersetzung mit inklusiven Unterricht und natürlicher Differenzierung, eine detaillierte Aufgabenanalyse ausgewählter Beispiele aus „Mathe-Flip“ und ein abschließendes Fazit. Die Arbeit untersucht, wie gut das Konzept den Bedürfnissen von Schüler*innen mit unterschiedlichem Förderbedarf gerecht wird.
Was ist „Mathe-Flip“?
„Mathe-Flip“ ist ein von Melanie Frank und Heike Müller entwickeltes Unterrichtskonzept, das auf lernstandorientiertem, individualisiertem und produktivem Lernen basiert. Es gliedert den Unterricht in „Flip-Zeit“ (zur Erarbeitung inhaltlicher Kompetenzen) und „Entdecker-Zeit“ (zur Entwicklung prozessbezogener Kompetenzen). Innerhalb der „Flip-Zeit“ bearbeiten alle Schüler*innen denselben Inhalt, jedoch mit unterschiedlichen Zugängen und Schwierigkeitsgraden, basierend auf dem Spiralprinzip der Differenzierung.
Was ist natürliche Differenzierung und ihre Rolle in dieser Arbeit?
Natürliche Differenzierung ist ein Ansatz im inklusiven Unterricht, der im Gegensatz zur Binnendifferenzierung auf einen gemeinsamen Gegenstand für alle Schüler*innen setzt, aber unterschiedliche Zugangsweisen und Komplexitätsstufen ermöglicht. Die Arbeit untersucht, wie „Mathe-Flip“ die Prinzipien der natürlichen Differenzierung (gemeinsamer Gegenstand, Offenheit der Aufgaben, Komplexität, kooperatives Lernen) umsetzt und ob dies inklusiven Ansprüchen genügt.
Welche Aspekte des inklusiven Mathematikunterrichts werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die rechtlichen Grundlagen inklusiven Unterrichts (UN-Behindertenrechtskonvention, KMK-Empfehlungen), die Definition von inklusivem Mathematikunterricht und die Bedeutung der natürlichen Differenzierung. Sie analysiert, inwieweit „Mathe-Flip“ den Anforderungen an einen inklusiven Unterricht gerecht wird und die Bedürfnisse von Schüler*innen mit Förderbedarf berücksichtigt.
Wie wird „Mathe-Flip“ in der Arbeit analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf ausgewählte Aufgaben aus dem „Mathe-Flip“-Material für die Schuleingangsphase. Diese Aufgaben stammen sowohl aus der „Flip-Zeit“ als auch der „Entdecker-Zeit“. Die Auswahl der Aufgaben wird begründet und ihre Repräsentativität für das Gesamtkonzept hervorgehoben. Die Analyse beurteilt die Inklusivität der Aufgaben anhand der Kriterien der natürlichen Differenzierung.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und bewertet die Eignung von „Mathe-Flip“ für den inklusiven Mathematikunterricht. Es beurteilt, inwieweit das Konzept Schüler*innen mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen fördert und die Prinzipien der natürlichen Differenzierung erfolgreich umsetzt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Inklusion, inklusiver Mathematikunterricht, natürliche Differenzierung, Mathe-Flip, UN-Behindertenrechtskonvention, KMK, Förderbedarf, Lernstandorientierung, individuelle Förderung, offene Aufgaben, gemeinsamer Gegenstand, Kompetenzentwicklung.
- Quote paper
- Laura-Marie Siebert (Author), 2021, Natürliche Differenzierung im inklusiven Mathematikunterricht. Eine Analyse des Unterrichtskonzeptes "Mathe-Flip", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1005514