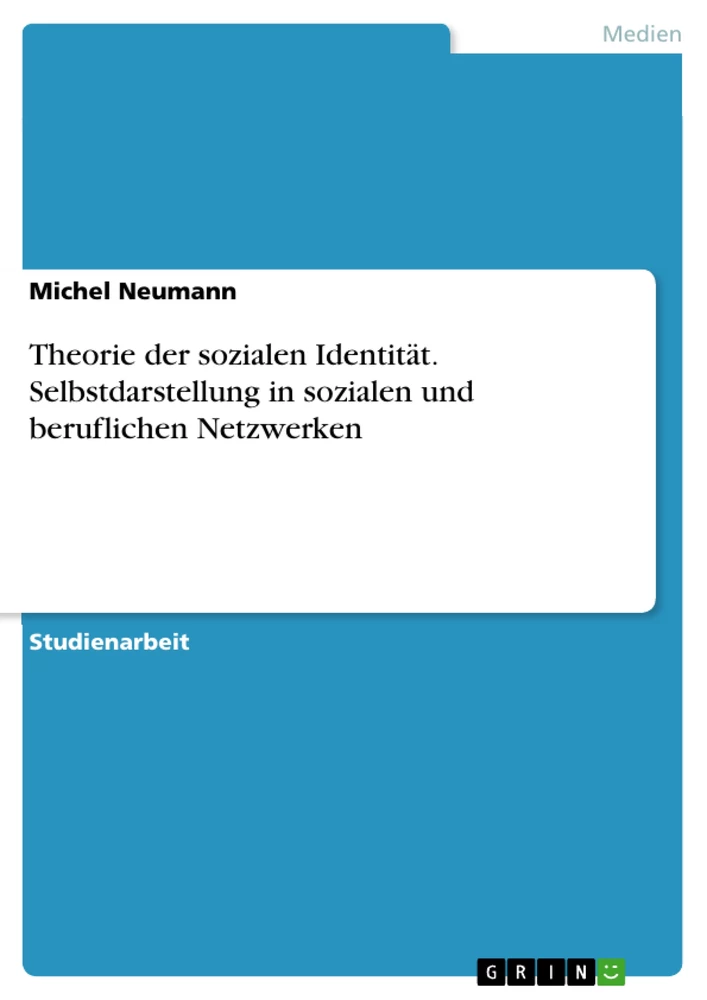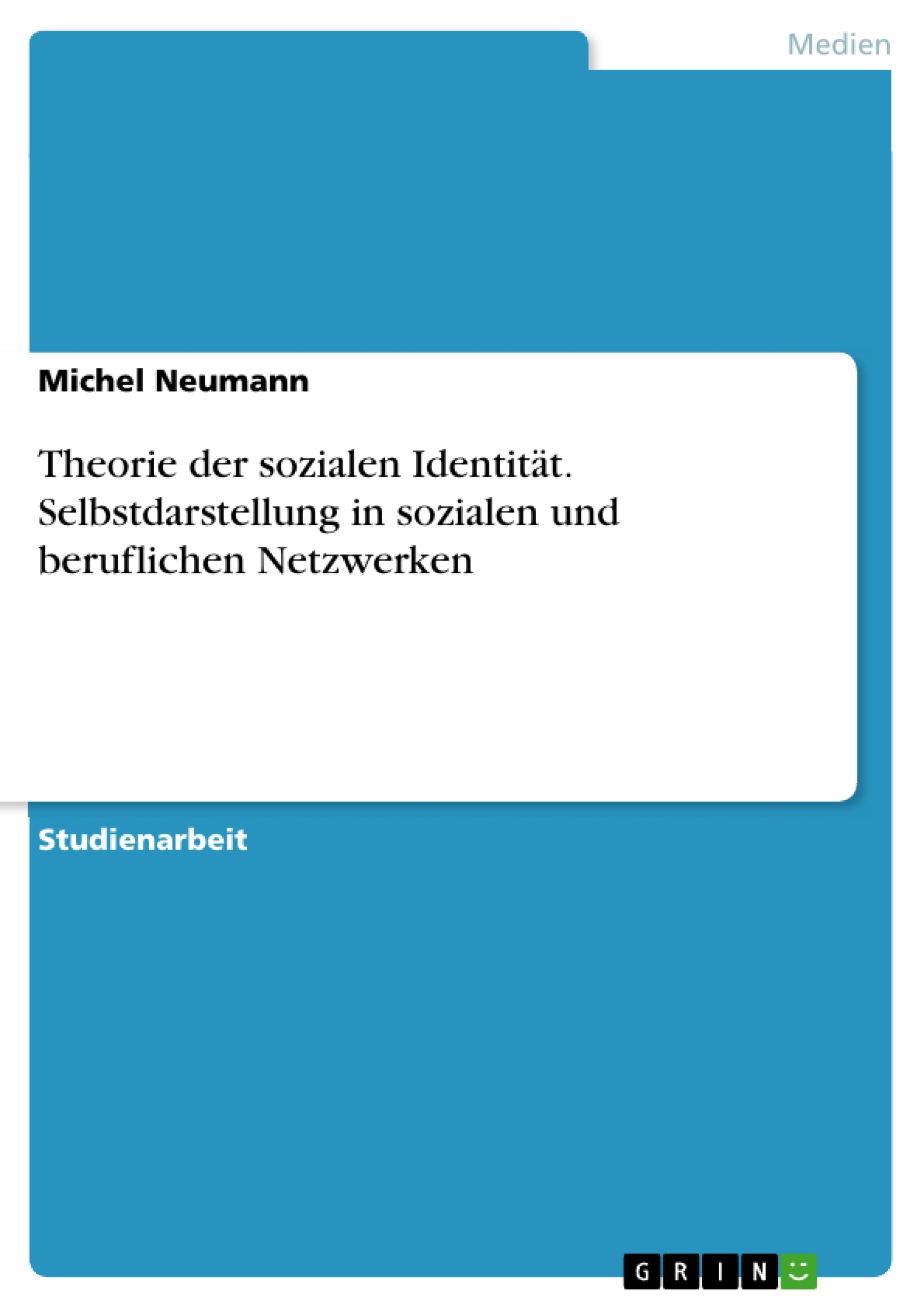Welche Unterschiede gibt es in der eigenen Darstellung in sozialen und beruflichen Netzwerken? Gibt es Erfolgsfaktoren für die Selbstdarstellung?
Angelehnt an das alte griechische Sprichwort „Zeig mir deine Freunde und ich sag dir wer du bist“ heißt es in der heutigen Welt „Zeig mir deine Likes und ich sag dir wer du bist“.
Das Internet ist fester Bestandteil unserer menschlichen Interaktionen und hat somit auch einen großen Einfluss auf unser Sozialleben. 3,5 Milliarden Menschen nutzen soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram oder WhatsApp und bauen somit weltweit Kontakte auf bzw. pflegen ihre bestehenden Beziehungen.
In der Schweiz, in Österreich und deutschlandweit erfreuen sich auch berufliche Netzwerke einer immer größer werdenden Beliebtheit. Die Nutzerzahlen von LinkedIn und Xing steigen dort kontinuierlich an. So nutzen derzeit in den DACH-Regionen (Deutschland, Schweiz und Österreich) in etwa 13 Millionen Personen LinkedIn und ca. 15 Millionen Xing. Die Nutzer haben dabei die Möglichkeit ihr Profil zu repräsentieren, indem Sie ihren beruflichen Werdegang darlegen und ihre Qualifikationen darstellen. Weiterhin können sie potenzielle Arbeitgeber auf sich aufmerksam machen, indem sie Ihre Fähigkeiten bei „Ich biete“ und ihre Jobwünsche bei „Ich suche“ angeben. Darüber hinaus können wichtige Geschäftsbeziehungen und berufliche Netzwerke aufgebaut werden. In Zeiten des Fachkräftemangels präsentieren sich aber nicht nur Arbeitnehmer, sondern vielmehr wollen sich auch Arbeitgeber möglichst positiv in sozialen und beruflichen Netzwerken darstellen. Nur so können sie bei steigendem Wettbewerb die Mitarbeiter für sich gewinnen und ihren Bekanntheitsgrad auch weiterhin ausbauen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Problembezug und Fragestellung
- Zielsetzung und Vorgehensweise
- Selbstkonzept
- Selbstkonzept und Identitäten
- Selbstdiskrepanztheorie
- Theorie der sozialen Identität
- Grundannahmen der Theorie der sozialen Identität
- Zugehörigkeit zu Gruppen und intergruppales Verhalten
- Grundlegende Prozesse der sozialen Identität
- Soziale Kategorisierung
- Soziale Identifikation
- Soziale Vergleiche
- Positive Distinktheit
- Taktiken zur Erlangung positiver sozialer Identität
- Digitale Selbstdarstellung
- Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken
- Merkmale
- Impression Management
- Selbstdarstellung in beruflichen Netzwerken
- Chancen und Risiken
- Kritische Erfolgsfaktoren
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Theorie der sozialen Identität im Kontext der Selbstdarstellung in sozialen und beruflichen Netzwerken. Ziel ist es, die Unterschiede in der Selbstdarstellung zwischen diesen beiden Bereichen zu beleuchten und Erfolgsfaktoren zu identifizieren.
- Das Selbstkonzept und seine Rolle in der sozialen Identität
- Die Theorie der sozialen Identität und ihre grundlegenden Prozesse
- Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken: Chancen und Risiken
- Selbstdarstellung in beruflichen Netzwerken: Erfolgsfaktoren
- Unterschiede in der Selbstdarstellung in sozialen und beruflichen Netzwerken
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einleitung stellt den aktuellen Stand der Selbstdarstellung in sozialen und beruflichen Netzwerken dar, unterlegt mit Statistiken zur Nutzung von Plattformen wie Facebook, Instagram, LinkedIn und Xing. Sie etabliert den Forschungsbedarf durch die Fragestellung nach den Unterschieden in der Selbstdarstellung und nach Erfolgsfaktoren. Der Bezug zum Sprichwort "Zeig mir deine Freunde..." wird modern interpretiert, um den Einfluss digitaler Plattformen auf das soziale Leben und die Selbstwahrnehmung zu unterstreichen. Die methodische Vorgehensweise der Arbeit, eine Literaturanalyse mit qualitativer Zuordnung der Quellen, wird ebenfalls skizziert.
Selbstkonzept: Dieses Kapitel beleuchtet das Selbstkonzept als Wissen und Empfinden einer Person über sich selbst, inklusive der Aspekte der Selbstkomplexität und des Strebens nach einem positiven Selbstbild. Es legt den Grundstein für das Verständnis der sozialen Identität, indem es die Basis für die Selbstwahrnehmung und -bewertung beschreibt. Der Bezug zu relevanten Theorien wird hergestellt, um ein umfassendes Bild des Selbstkonzepts zu liefern und den Übergang zur Theorie der sozialen Identität zu ebnen.
Theorie der sozialen Identität: Dieses Kapitel widmet sich ausführlich der Theorie der sozialen Identität. Es erläutert die Grundannahmen, die Bedeutung der Gruppenzugehörigkeit und des intergruppalen Verhaltens. Im Kern werden die grundlegenden Prozesse – soziale Kategorisierung, Identifikation, Vergleiche und das Streben nach positiver Distinktheit – detailliert beschrieben und ihre Interaktionen erklärt. Abschließend werden Strategien zur Erreichung einer positiven sozialen Identität erörtert, was den praktischen Bezug zu den folgenden Kapiteln herstellt.
Digitale Selbstdarstellung: Dieses Kapitel verbindet die Theorie mit der Praxis, indem es die Selbstdarstellung in sozialen und beruflichen Netzwerken analysiert. Es beschreibt Merkmale der Selbstdarstellung in sozialen Medien und beleuchtet das "Impression Management" als strategische Gestaltung des eigenen öffentlichen Bildes. Der Schwerpunkt liegt auf der Selbstdarstellung in beruflichen Netzwerken, inklusive einer ausführlichen Diskussion der Chancen und Risiken sowie wichtiger Erfolgsfaktoren. Die Darstellung von Beispielen, wie Online-Bewerberüberprüfung und Gründe gegen Einstellungen, veranschaulicht die praktische Relevanz.
Schlüsselwörter
Theorie der sozialen Identität, Selbstdarstellung, soziale Netzwerke, berufliche Netzwerke, Selbstkonzept, Impression Management, positive soziale Identität, digitale Identität, Erfolgsfaktoren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Digitale Selbstdarstellung und soziale Identität
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Theorie der sozialen Identität im Kontext der Selbstdarstellung in sozialen und beruflichen Netzwerken. Sie beleuchtet die Unterschiede in der Selbstdarstellung zwischen diesen beiden Bereichen und identifiziert Erfolgsfaktoren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Selbstkonzept, die Theorie der sozialen Identität (inklusive sozialer Kategorisierung, Identifikation, Vergleiche und positive Distinktheit), Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken (mit Fokus auf Impression Management), Selbstdarstellung in beruflichen Netzwerken (Chancen, Risiken und Erfolgsfaktoren) und den Vergleich der Selbstdarstellung in beiden Bereichen.
Welche Theorie steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die Theorie der sozialen Identität bildet das zentrale theoretische Fundament der Arbeit. Sie dient als Grundlage, um die Prozesse der Selbstdarstellung in sozialen und beruflichen Netzwerken zu verstehen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, Kapitel zum Selbstkonzept, zur Theorie der sozialen Identität, zur digitalen Selbstdarstellung und ein Fazit. Die Einführung beschreibt die Fragestellung und Methodik. Jedes Kapitel behandelt einen Aspekt des Themas detailliert. Schlüsselwörter und eine Zusammenfassung der Kapitel erleichtern das Verständnis.
Welche Rolle spielt das Selbstkonzept?
Das Selbstkonzept, also das Wissen und Empfinden einer Person über sich selbst, bildet die Grundlage für das Verständnis der sozialen Identität und beeinflusst die Selbstdarstellung in digitalen Medien.
Was versteht man unter "Impression Management" im Kontext der Arbeit?
Impression Management bezeichnet die strategische Gestaltung des eigenen öffentlichen Bildes in sozialen Netzwerken. Die Arbeit untersucht, wie dieses Management in sozialen und beruflichen Netzwerken unterschiedlich eingesetzt wird.
Welche Unterschiede in der Selbstdarstellung zwischen sozialen und beruflichen Netzwerken werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Unterschiede in der Selbstdarstellung zwischen Plattformen wie Facebook und Instagram (soziale Netzwerke) und LinkedIn und Xing (berufliche Netzwerke). Dabei werden sowohl Chancen als auch Risiken betrachtet.
Welche Erfolgsfaktoren für die Selbstdarstellung in beruflichen Netzwerken werden identifiziert?
Die Arbeit identifiziert kritische Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Selbstdarstellung in beruflichen Netzwerken. Diese Faktoren werden im Kapitel zur digitalen Selbstdarstellung ausführlich erläutert.
Welche Methodik wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit basiert auf einer Literaturanalyse mit qualitativer Zuordnung der Quellen. Die Ergebnisse werden durch Beispiele aus der Praxis veranschaulicht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Theorie der sozialen Identität, Selbstdarstellung, soziale Netzwerke, berufliche Netzwerke, Selbstkonzept, Impression Management, positive soziale Identität, digitale Identität, Erfolgsfaktoren.
- Arbeit zitieren
- Michel Neumann (Autor:in), 2020, Theorie der sozialen Identität. Selbstdarstellung in sozialen und beruflichen Netzwerken, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1004636