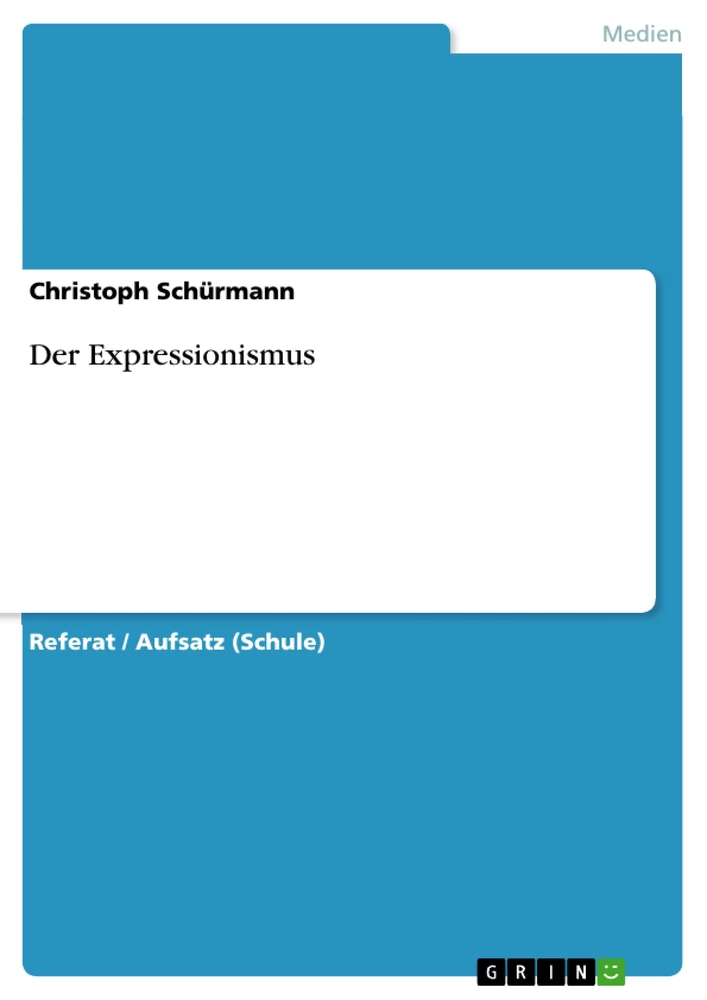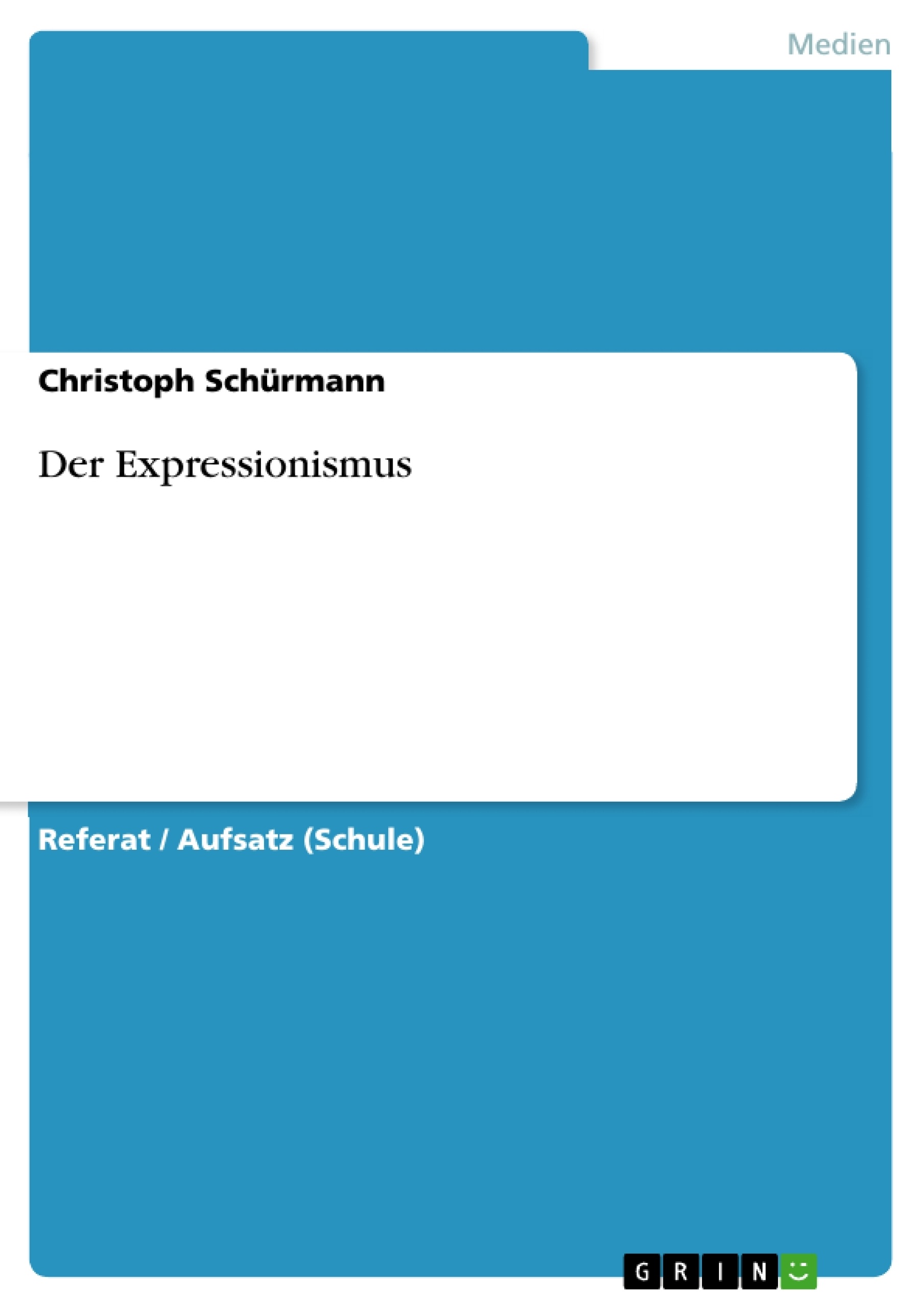Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Musik die rohe, ungefilterte Essenz der menschlichen Seele widerspiegelt, eine Welt, die von den Turbulenzen des frühen 20. Jahrhunderts geprägt ist. Der Expressionismus in der Musik, eine revolutionäre Bewegung, die um den Ersten Weltkrieg aufblühte, brach radikal mit den Konventionen der Vergangenheit, um eine neue Sprache der Emotionen und des inneren Erlebens zu entwickeln. Diese Epoche, die ihre Wurzeln in Deutschland schlug, fand ihren Ausdruck in der Auflösung tonaler Beziehungen, der Verwendung extremer Dissonanzen und einer nie dagewesenen Intensität des Ausdrucks. Komponisten wie Arnold Schönberg, Alban Berg und Anton Webern suchten nach einer schonungslosen Ehrlichkeit, die sich in fragmentierten Melodien, abrupten dynamischen Wechseln und einer Reduktion auf das Wesentliche manifestierte. Der Expressionismus manifestiert sich in vier Kernelementen: Irritation, Expression, Reduktion und Abstraktion. Die Irritation, besonders in der Frühphase, schockiert durch unerwartete Wendungen und Dissonanzen, während die Expression das Ausufernde und Subjektive betont, die Reduktion das Überflüssige verwirft und die Abstraktion in der Spätphase zur Vergeistigung führt. Von Schönbergs atonalen Klavierstücken bis zu Bergs Oper "Wozzeck" schuf der Expressionismus Werke von erschütternder Kraft und psychologischer Tiefe. Entdecken Sie, wie diese musikalische Revolution die Grenzen des Hörbaren sprengte und den Weg für neue Ausdrucksformen ebnete, die bis in die heutige Zeit nachwirken und Komponisten wie Hindemith, Stockhausen und Boulez beeinflussen. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Musik zum Spiegelbild der menschlichen Psyche wird, ein Echo der inneren Zerrissenheit und der Suche nach Sinn in einer Welt des Umbruchs. Erforschen Sie die drei Phasen des Expressionismus – Früh-, Hoch- und Spätphase – und lernen Sie die Schlüsselwerke kennen, die diese Epoche geprägt haben. Diese Analyse bietet einen umfassenden Einblick in die stilistischen Merkmale, die historischen Hintergründe und die einflussreichsten Vertreter dieser bedeutenden Strömung der Musikgeschichte, die bis heute Künstler inspiriert und herausfordert.
Expressionismus
1.Zeitliche Einordnung / Geschichtlicher Kontext
Der Musikalische Expressionismus lässt sich zeitlich etwa in die ersten Jahrzente des 20. Jahrhunderts einordnen, insbesondere in die Zeit um und nach dem ersten Weltkrieg. Seine Heimat und auch die größte Verbreitung hatte der Expressionismus in Deutschland. Ausgehend von der Malerei fand der Begriff Expressionismus auch auf alle anderen Künste Verwendung, also auch auf die Musik.
Als Prägendes geschichtliches Ereignis steht mit Sicherheit der erste Weltkrieg im Zentrum des Expressionismus. Angeregt durch die Leidvolle Zeit und die fortschreitende Technisierung suchten die Künstler Europas nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten.
2.Der musikalische Stil / Wesensmerkmale des Expressionismus
Will Hofmann nennt zur Stilbestimmung des musikalischen Expressionismus vier wesentliche Hauptelemente : 1.Irritation
2.Expression
3.Reduktion
4.Abstraktion
Irritation ist besonders in der Frühphase des Expressionismus ein wesentliches musikalisches Merkmal. Sie drückt sich aus in schnellem Wechsel der melodischen Richtung, unvermitteltem Nebeneinander der Harmonien mit extremen Dissonanzen, Unruhe der Motive, schnellem Wechsel zwischen homophonen und linearen Teilen, Verwendung von extremen Höhen- und Tiefenlagen, der Neigung zu freiem Rhythmus, stoßhaften Impulsen, ständigem Rubato und anderen Mitteln.
Diese extreme Irritation führt zu einer ständigen Zuspitzung und letztendlich zur Kulmination im Extremen. Jeglicher Bereich der Ausgeglichenheit wird verlassen, alles wird bis in die Endwerte getrieben, und das in plötzlichen Wechseln : Akkorde springen von einer Extremlage in die Andere, nach Takten im ppp folgen plötzlich herausstechende fff Stellen. Es wird eine hektische, fieberhafte Atmosphäre erzeugt.
Durch dieses Verfahren wird eine gewisse Dissoziation in der Musik erreicht, d.h. ein Auseinanderfall, eine Zersplitterung findet statt. Der große Zusammenhang geht verloren, Der Melodiestrom scheint zu stocken, alles wirkt bruchstückhaft und flüchtig.
Einen völlig neuen Stellenwert im Expressionismus bekommen Dissonanz und Tonalität. Jegliche tonalen Beziehungen werden aufgelöst, jeder Akkord ist sein eigenes Zentrum.
Die Expression, welche schon in der Wortbildung Expressionismus auftaucht, ist der zweite Aspekt. Expressionistische Gestaltung trägt alle Merkmale des Expansiven, des Ausufernden, Allumfassenden. Der Expressionismus begreift die Welt als einen von Kräften durchwirkten Raum, in welcher alle Dinge und Wesen, so auch der Mensch, verschiedene Kraftzentren darstellen. Aus diesen Kraftzentren wirkt der Wille zur Expansion, zur Raumergreifung. Diese ,,Raumergreifung" offenbart sich auch musikalisch, z.B weit Auseinanderliegende Töne im Diskant- und Bassbereich die Parallel laufen sind nur scheinbar beziehungslos. Auch der Einzelton wird als expansiv erfülltes Kraftzentrum gedeutet. Das musikalische Geschehen läuft also in mehreren Schichten übereinander ab.
Ein weiteres Mekmal der Expression ist die Subjektivierung in der Musik.
Ihr wird die klare Gliederung und Form geopfert. Es findet ein Entgrenzungsprozeß statt, bei dem auch Dinge mit einer Seele begabt werden.
Schon in Strawinskys Sacre zum Beispiel beginnt ,,die Erde zu tönen".
Den dritten Aspekt stellt die Reduktion dar. Hinter ihr steht der Wille, das Innere und wirklich wesentliche der Dinge zu ergründen. Bei dieser Suche nach dem Inneren wird das Überflüssige zwangsweise als zufällig und beliebig enthüllt.
Diese starke Konzentration auf das Wesenhafte verbietet jegliche Umspielung, alles doppelt gesagte, alles Vorbereitendes und Abklingendes. Dies macht sich natürlich auch musikalisch bemerkbar. Jeder Ton ist elementar und substanzhaft, alles überflüssige wird entfernt. So bildet sich eine hohe ,,spezifische Dichte" der Musik heraus.
Die Reduktion wirkt sich auch als eine Vereinfachung des Orchesterapparates aus.
Letztendlich vollzieht sich in Schönbergs Bühnenwerken op.17 und op.18 die letztmögliche Reduktion auf das Emotionale. Die Musik übernimmt die Funktion eines Psychogramms. Der Affekt beherrscht Alles. Die Musik ist alleiniges Mittel zur Darstellung von Emotionen, sie ist nur noch Ausdruck, nur noch Expression.
Der letzte Aspekt, der der Abstraktion, ergibt sich aus dem der Reduktion.
In der Spätphase des Expressionismus wird das durch die Reduktion gewonnene Material durch rational-gliedernde Kräfte neu geordnet. Die Subjektivierung schlägt in Objektivierung um. Das Emotionale und Irrationale wird am Schluß nicht mehr anerkannt. So folgt als letzte Konsequenz der Reduktion die Aufhebung des Gefühls. Das Ziel ist es nun endgültig zum innersten Vorzustoßen, und das Ziel dieser Phase ist Die Befreiung von der Materie durch Vergeistigung und die Errichtung einer rein geistigen Welt als Erscheinung einer reinen Idee und im Wirken reiner Kräfte.
3.Geschichtlicher Ablauf des musikalischen Expressionismus
Der geschichtliche Ablauf des musikalischen Expressionismus läßt sich in Drei Phasen einteilen : Den Früh-, Hoch-, und Spätexpressionismus.
Zeitlich gesehen beginnt der Frühexpressionismus Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts mit Schönberg (Pelleas und Melisande), Skrijabin und Ives.
Der Hochexprssionismus beginnt etwa 1907/08 und die Spätphase etwa 1914/15 bei Skrijabin und um 1923 bei Schönbergs ersten zwölftönigen Werken.
Allerdings setzte sich ein Expressionistischer Strom auch nach Beendigung der Späphase fort. Während Komponisten wie Hindemith, Busoni, Prokoffiew und Honnegger nur eine expressionistische Periode durchliefen, ist der Expressionismus bei Schönberg, Berg und Webern immer bestimmend geblieben.
Der Einfluß des Expressionismus reicht auch noch bis in unsere Zeit. Jeder bedeutende Komponist in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mußte sich mit dem Expressionismus Auseinandersetzen und auch in der Gegenwart finden sich immer wieder neoexpressionistische werke, wie z.B. von Zimmermann, Stockhausen, Henze und Boulez.
4.Hauptvertreter / Schlüsselwerke des Expressionismus
Arnold Schönberg : -Klavierstücke op. 11, op. 33 (1874-1951) - fis-moll Quartett
- ,,Buch der hängenden Gärten" für Sinstimme und Klavier
- ,,Pierrot Lunaire" op.21
Alexander Skrijabin: -mittlere und späte Klaviersonaten (1871-1915) - ,,Poeme de l'Extase"
Alban Berg : -Wozzeck (Oper) (1885-1935) -Streichquartett op.3
Paul Hindemith : -Suite 1922 (1895-1963) -,,Mörder, Hoffnung der Frauen" (Oper)
Anton v. Webern : -Streichquartett op.5 (1883-1945) - Lieder -Orchesterstücke op.6
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zeitliche Einordnung und der geschichtliche Kontext des musikalischen Expressionismus?
Der musikalische Expressionismus wird etwa in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts eingeordnet, besonders in die Zeit um den Ersten Weltkrieg. Er hatte seine größte Verbreitung in Deutschland. Der Begriff wurde von der Malerei auf andere Künste, einschließlich der Musik, übertragen. Der Erste Weltkrieg gilt als prägendes geschichtliches Ereignis, das die Künstler zu neuen Ausdrucksformen anregte.
Welche stilistischen Merkmale kennzeichnen den musikalischen Expressionismus?
Will Hofmann nennt vier wesentliche Elemente: Irritation, Expression, Reduktion und Abstraktion. Irritation äußert sich in schnellem Wechsel der Melodierichtung, Dissonanzen, Unruhe der Motive, extremen Höhen- und Tiefenlagen und freiem Rhythmus. Expression zeigt sich in expansiver Gestaltung und Subjektivierung. Reduktion zielt auf das Wesentliche ab und vereinfacht den Orchesterapparat. Abstraktion ordnet das gewonnene Material rational neu und hebt das Gefühl auf.
Wie äußert sich die "Irritation" im musikalischen Expressionismus?
Irritation ist ein wesentliches Merkmal, besonders in der Frühphase. Sie drückt sich aus in schnellen melodischen Wechseln, unvermittelten Harmonien mit Dissonanzen, unruhigen Motiven, Wechsel zwischen homophonen und linearen Teilen, extremen Lagen, freiem Rhythmus und stoßhaften Impulsen. Dies führt zu einer Zuspitzung und Kulmination im Extremen, wodurch eine hektische und fieberhafte Atmosphäre entsteht und eine Dissoziation in der Musik erreicht wird.
Was bedeutet "Expression" im Kontext des Expressionismus?
Expression bedeutet, dass die Gestaltung expansiv und ausufernd ist. Die Welt wird als von Kräften durchwirkter Raum begriffen, in dem Mensch und Dinge Kraftzentren darstellen. Es gibt eine Subjektivierung, bei der klare Gliederung und Form geopfert werden, und auch Dinge werden mit einer Seele begabt.
Wie äußert sich die "Reduktion" im Expressionismus?
Reduktion zielt darauf ab, das Innere und Wesentliche der Dinge zu ergründen. Überflüssiges wird entfernt, was zu einer hohen "spezifischen Dichte" der Musik führt. Es gibt eine Vereinfachung des Orchesterapparates, und in Schönbergs Bühnenwerken reduziert sich die Musik auf das Emotionale, wodurch sie zum Psychogramm wird.
Was versteht man unter "Abstraktion" im späten Expressionismus?
In der Spätphase wird das durch Reduktion gewonnene Material durch rational-gliedernde Kräfte neu geordnet. Die Subjektivierung schlägt in Objektivierung um, das Gefühl wird aufgehoben, und es wird eine rein geistige Welt als Erscheinung einer reinen Idee angestrebt.
In welche Phasen lässt sich der musikalische Expressionismus einteilen?
Der musikalische Expressionismus lässt sich in drei Phasen einteilen: Frühexpressionismus, Hochexpressionismus und Spätexpressionismus.
Wer sind die Hauptvertreter und Schlüsselwerke des Expressionismus?
Zu den Hauptvertretern gehören Arnold Schönberg (Klavierstücke op. 11, op. 33, "Pierrot Lunaire"), Alexander Skrijabin (späte Klaviersonaten, "Poème de l'Extase"), Alban Berg ("Wozzeck"), Paul Hindemith (Suite 1922) und Anton v. Webern (Streichquartett op.5).
- Quote paper
- Christoph Schürmann (Author), 2000, Der Expressionismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/100183