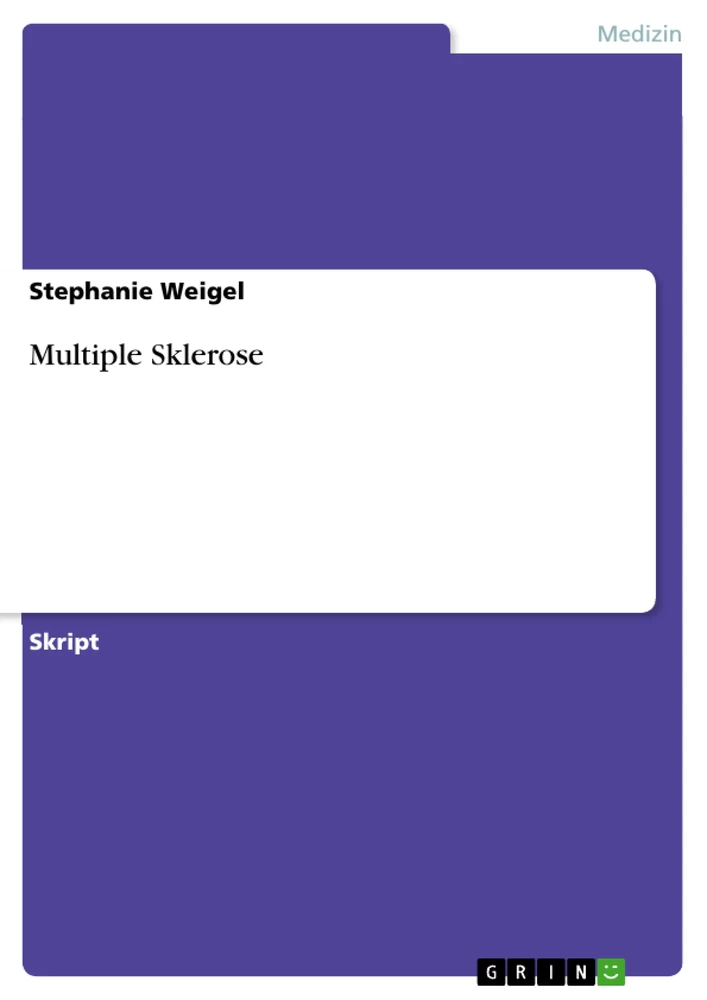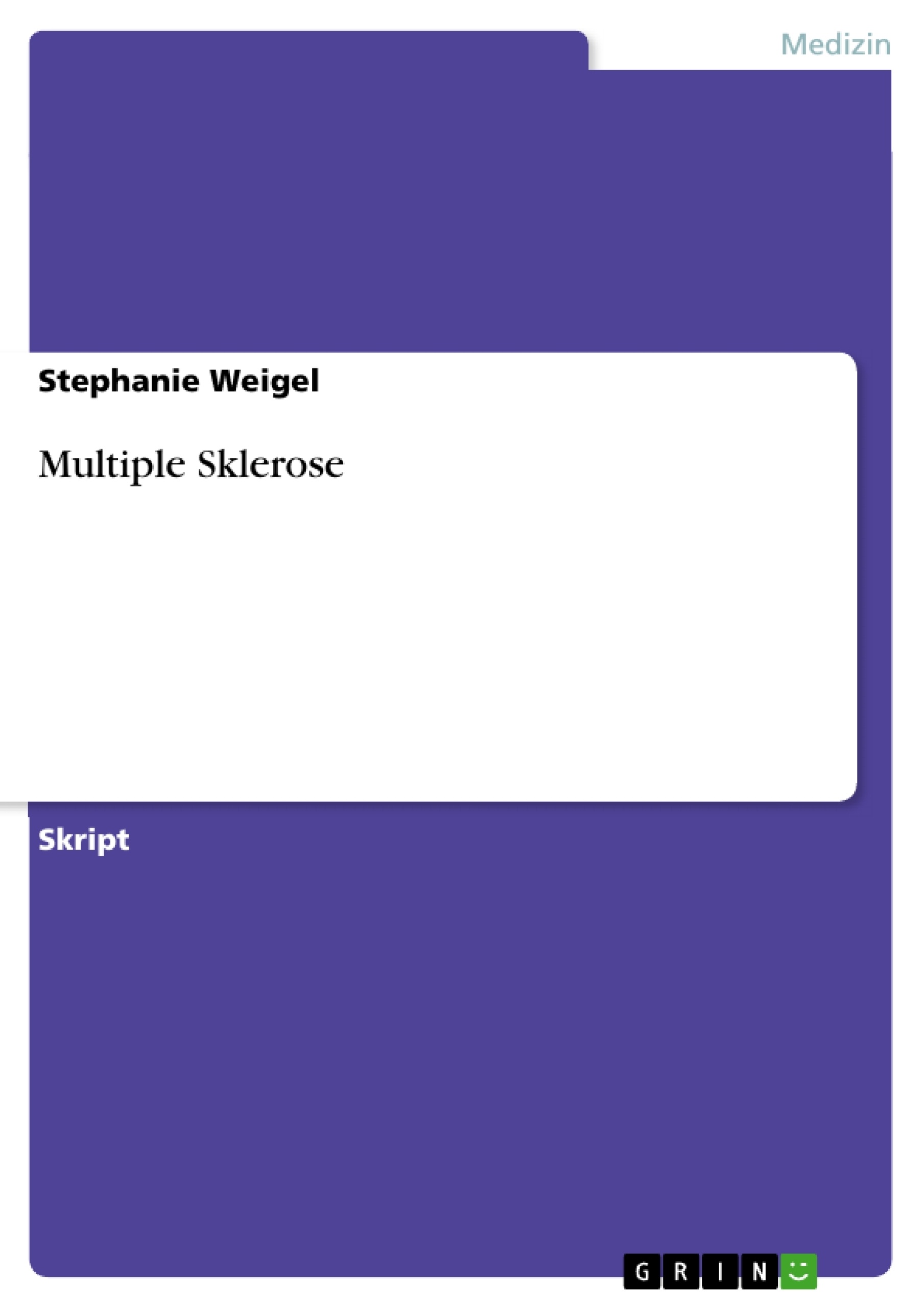Was, wenn Ihr eigener Körper zum Feind wird? Multiple Sklerose (MS), eine heimtückische Erkrankung des zentralen Nervensystems, betrifft Millionen Menschen weltweit und stellt Betroffene sowie ihre Angehörigen vor immense Herausforderungen. Diese umfassende Darstellung beleuchtet die komplexen Facetten der MS, von den rätselhaften Ursachen und vielfältigen Symptomen bis hin zu den neuesten diagnostischen Verfahren und therapeutischen Ansätzen. Tauchen Sie ein in die Pathophysiologie der MS, um die Mechanismen der Entmarkung und die Rolle des Immunsystems zu verstehen. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Verlaufsformen, von schubförmig remittierend bis hin zu chronisch progredient, und lernen Sie, die subtilen Anzeichen und typischen Symptomkombinationen zu erkennen, wie etwa retrobulbäre Neuritis, spastische Paresen oder Kleinhirnfunktionsstörungen. Die detaillierte Beschreibung der Diagnostik, einschliesslich Liquoruntersuchung, evozierter Potentiale und Magnetresonanztomographie (MRT), ermöglicht ein tieferes Verständnis der modernen Diagnosemethoden. Entdecken Sie die aktuellen Therapiemöglichkeiten, von hochdosiertem Cortison und Immunmodulatoren wie Beta-Interferon bis hin zu immunsuppressiven und zytostatischen Therapien, sowie die Bedeutung symptomatischer Behandlungen zur Linderung von Spastik, Depressionen und Blasenstörungen. Dieses Buch dient als unverzichtbarer Ratgeber für Betroffene, Angehörige und medizinisches Fachpersonal, um die Erkrankung besser zu verstehen, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Lebensqualität trotz der Herausforderungen durch MS zu verbessern. Es vermittelt nicht nur fundiertes Wissen über Multiple Sklerose, sondern gibt auch Hoffnung und Unterstützung im Umgang mit dieser komplexen neurologischen Erkrankung und bietet einen umfassenden Überblick über aktuelle Forschungsansätze und Behandlungsmöglichkeiten, einschliesslich der Bedeutung von Früherkennung und individualisierter Therapieansätze, um den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen und die Lebensqualität der Betroffenen nachhaltig zu verbessern, wobei besonderes Augenmerk auf die psychosozialen Aspekte der Erkrankung und die Bedeutung einer ganzheitlichen Betreuung gelegt wird, um den individuellen Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden und ihnen ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Multiple Sklerose
Def.: Multiple Sklerose, auch Encephalomyelitis desseminata / Polysklerose / Pleosklerose genannt, ist eine entzündliche Erkrankung des ZNS mit herdförmiger Entmarkung. Häufigste organische Erkrankung des ZNS.
Prävalenz: 60 - 100 Fällen pro 100 000 Einwohner
Frauen erkranken doppelt so häufig an der schubweisen Verlaufsform Männer, aber gleich häufig an chron. progredienter MS.
Prädilaktionsalter: zw. 20. - 40. Lebensjahr
Nach dem 45 Lebensjahr sinkt die Häufigkeit von Neuerkkrankungen kontinuierlich ab.
Die Ursache der MS ist nicht bekannt. Bei MS sind genetischen Faktoren in der Prädisposition wirksam, wobei mehrere Gene beteiligt sein müssen. Die Konkordanzrate ist bei monozygoten Zwillingen 25 % , bei dizygoten 3 %.
Pathophysiologie:
- Autoreaktive T - Lymphozyten werden z. B. durch einen Virusinfekt, in die Peripherie des Körpers aktiviert.
- Sie docken an bestimmten Rezeptoren von Endothelzellen an u. wandern unter chemotaktischen Einflüssen durch die Blut - Hirn - Schranke ins Hirngewebe.
- Hier kommt es zu einer klonalen Proliferation der T - Zellen, die nach erneuter Aktivierung bestimmte Strukturen des ZNS irrtürmlich als Antigene erkennen.
- Unter diesen Strukturen ist besonders das Myelinprotein zu nennen, eine Komponente des Myelins, aber auch andere Proteine im ZNS sind an der Reaktion beteiligt.
- Die Freisetzung von proinflammatorischen Zytokinen aktiviert andere zelluläre Bestandteile des Immunsystems, z. B. Makrophagen.
- B - Zellen werden aktiviert.
- Zusammenwirken von T.- u. B - Zellen führt zu der entz. Markscheidenschädigung, die neben der gliösen Vernarbung ( ,, Sklerose ,, ) das Charakteristikum der MS ist.
- MS bezieht sich auf die weisse Substanz des gesamten ZNS
- Lipoide Substanzen der Markscheiden werden aufgelöst, wobei Achsenzylinder und Axon zunächst erhalten bleiben.
- Grosse Herde · Funktionsstörung
- Kleine Herde · in stummen Regionen, klinisch unerkannt
- Herde / Plaques: unterschiedlich gross ( Stecknadel - Markstück ), unterschiedlich verteilt
- Frühes Stadium: rötlich geschwollene u. aufgelockerte Markscheiden; Rückbildung mögliche
- Spätes Stadium: Zerfall der Markscheiden u. Ersatz durch Glia · Verhärtung u. Narbenbildung = Sklerose
Bevorzugte Stellen:
- Sehnerven
- Balken
- Hirnstamm
- Insbes. Brücke mit Augenmuskelkernen
- Kleinhirn u. Kleinhirnstiele
- Pyramidenbahn auf jedem Niveau
- Der Boden des IV. Ventrikels
- Hinterstränge des Rückenmarks
Seltener:
- Hirnrinde
- Basaiganglien
- Rückenmarksgrau
Verlaufsformen:
1. Schubweise; mit wachsender Symptomatik
Schubdauer: wenige Tage bis 1 - 2 Wochen
Darauffolgende, meist unvollständige Rückbildung ( Remission )
Intervall bis zum nächsten Schub normalerweise: 1 - 2 Jahre
Möglich auch: wenige Monate - 10-15 J.
2. Chronisch progredient: anfangs Schübe, dann ständig anhaltend o. Rückbildung mit schubartiger Verschlimmerung, häufig bei Patienten mittleren Alters
3. Foudroyante ( plötzlich einsetzende ) Schübe mit schnellem Tod wenige Wochen nach der
1. Manifestation ( SEHR SELTEN!!! )
Äthiologie: vier mögliche Thesen:
1. Virusinfektion im Kindesalter ( Masern - Antikörper / Titer erhöht )
2. Neuroallergische Hypothese ( Plasmazellen im Liquor )
3. Genetische Faktoren ( erhöhte Wahrscheinlichkeit zu erkranken )
4. Myelinvulnerabilität ( Enzymhaushalt gestört )
Symptome:
- Retrobulbäre Neuritis ( Entzündung des hinter dem Augapfel liegenden Teil des N. opticus · Visusabfall ( Sehschärfenabfall ) bis zur völligen Erblindung ( Amaurose ) innerhalb einer Stunden oder Tage, wobei der Fundus ( Augenhintergrund bzw. Augenoberfläche ) unauffällig bleibt
- Restsymptome: totales / relatives Zentralskotom ( Gesichtsfeldausfall )
- Atrophie ( Gewebsrückbildung ) der temporalen Papillenhälfte ( Papille = Diskus n. optici = blinder Fleck = Austrittsstelle der Sehnervenfasern aus der Netzhaut )
- Drehschwindelattacken ohne akustische Begleiterscheinung
- Flüchtige Doppelbilder ( Diplopie = Doppeltsehen )
- Trigeminusneuralgie ( sekundenlange, spontan auftretende Schmerzattacken im Versorgungsgebiet des N. trigeminus )
- Motorische Symptomatik: Zentrale Paresen, Steifigkeit des Ganges, Spastik mit Reflexkloni
- Sensibilitätsstörungen: Taubheit, Pelzigkeit oder Kribbeln vorallem an Händen und Füssen, Nackenbeugezeichen häufig nach Lehrmitte positiv.
- Blasenstörungen: Retention oder Dranginkontinenz.
- Kleinhirnfunktionsstörungen: Charcot - Trias: Nystagmus, Intensionstremor, skandierendes Sprechen
- Psychisches Veränderungen: Euphorie
Typische Symptomkombinationen
- Gefühlsstörungen an den Händen und spastische Paraparese der Beine,
- Spastisch - ataktischer Gang mit Missempfindungen und Blasenstörungen,
- Inkomplettes Querschnittssyndrom mit Nystagmus und skandierendem Sprechen
- Rezidivierende, flüchtige Lähmungen wechselnder Augenmuskelnerven.
Diagnostik:
- Liquoruntersuchung· Lumbalpunktion
- Erhöhtes Gesamteiweiss
- Erhöhtes IgG
- Plasmazellen im Liquor
- Gesamtzellzahl im Liquor etwas erhöht
- Fehlender Bauchhautreflex
- Positives Lhermittesches Zeichen ( auf kräftiges Kopfbeugen nach vorne,
Missempfindungen von Schulter bis zu den Armen ziehend oder über gesammte Wirbelsäule abwärts bis zu den Beinen
- Evozierte ( hervorgerufene ) Potentiale · visuelle E.P.: über der Sehrinde abgeleitete Reizantwort auf optischen Reiz zeigt verlängerte Latenz · auditive E.P- mit Herd im Hirnstamm
- Computeromographie
Röntgenstrahl wird in Abhängigkeit der vorhandenen Struktur innerhalb der Körperschicht, die durchstrahlt wird, verschieden stark abgeschwächt · Sichtbarmachen von Entmarkungsherde
- Magnet - Resonanz - Imaging ( MRI ) Kernspintresonanz
Protonen, im Magnetfeld ausgerichtet, absorbieren elektromagnetische Wellen von bestimmter Frequenz, wodurch ihre Ausrichtung zum äusseren Feld gestört wird; bei Rückkehr in ihren ursprünglichen Zustand senden sie messbare elektromagnetische Strahlung aus
- Auffinden von Plaques von 4*3mm Grösse
- Auffinden von verminderten Hirnvolumen - schmälere Rindenwindungen, verbreiterte Furchen
Differentialdiagnose und Kombination verschiedener Untersuchungen sind nötig, da einzelne Symptome auch auf andere Entmarkungskrankheiten hinweisen könnten. Erst die Kombination verschiedener Symptome sichert die Diagnose MS.
Therapie:
Eine ursächliche Therpie ist bisher nicht möglich. Da die Entzündung wahrscheinlich ( auto- ) immunogen mitbedingt ist, werden Medikamente eingesetzt, die entzündungshemmend wirken und / oder das Immunsystem unterdrücken.
- Hochdosiertes Cortison oder ACTH ( Adreno - corticotropes Hormon )· ( 500 mg i. v. (oder oral ) über 5 Tage dann Ausschleichung ); hierdurch wird die Rückbildung der Symptome beschleunigt, der Krankheitsverlauf insgesamt aber nicht beeinflusst. Daher ist eine Glukokortikoiddauerbehandlung nicht angezeigt · KEINE Dauersteroide
- Beta 1 a Interferon ( Immunmodelatoren ) 1 mal wöchentlich ( regulierend auf Immunsystem)
- Immunsuppression mit Azathioprin ( z. B. Imurek ) oder
- Zytostatische Therapie mit Cyclophosphamid ( z. B. Endoxan )· Da sich hierdurch, wenn auch erst nach Jahren, die Krebsgefahr erhöht, ist die Indikation um so strenger zu stellen, je jünger der Patient ist.
Symptomatische Behandlung:
- Gabe von Baclofen ( z. B. Lioresal ) gegen die Spastik
- Antidepressiva bei reaktiver Depression
- Carbachol ( z. B. Doryl ) bei Blasenentleerungsstörungen
- Carbamazepin ( z. B. Tegretal ) bei Trigeminusneuralgie
Lektüre:
- Poeck - Neurologie
- Pschyrembel
- Pflege heute
Häufig gestellte Fragen zu Multipler Sklerose
Was ist Multiple Sklerose (MS)?
Multiple Sklerose, auch Encephalomyelitis disseminata / Polysklerose / Pleosklerose genannt, ist eine entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems (ZNS), die durch herdförmige Entmarkung gekennzeichnet ist. Sie ist die häufigste organische Erkrankung des ZNS.
Wie häufig ist MS?
Die Prävalenz liegt bei 60 - 100 Fällen pro 100.000 Einwohner.
Wer erkrankt häufiger an MS?
Frauen erkranken doppelt so häufig an der schubweisen Verlaufsform wie Männer, aber gleich häufig an chronisch progredienter MS.
In welchem Alter tritt MS typischerweise auf?
Das Prädilaktionsalter liegt zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr. Nach dem 45. Lebensjahr sinkt die Häufigkeit von Neuerkrankungen kontinuierlich ab.
Was sind die Ursachen von MS?
Die Ursache der MS ist nicht bekannt. Genetische Faktoren spielen eine Rolle in der Prädisposition, wobei mehrere Gene beteiligt sein müssen. Die Konkordanzrate ist bei monozygoten Zwillingen 25%, bei dizygoten 3%.
Wie entsteht die Entmarkung bei MS?
Autoreaktive T-Lymphozyten werden aktiviert und wandern durch die Blut-Hirn-Schranke ins Hirngewebe. Dort kommt es zu einer klonalen Proliferation der T-Zellen, die bestimmte Strukturen des ZNS (insbesondere das Myelinprotein) irrtümlich als Antigene erkennen. Die Freisetzung von proinflammatorischen Zytokinen aktiviert andere zelluläre Bestandteile des Immunsystems, z. B. Makrophagen. B-Zellen werden aktiviert. Das Zusammenwirken von T- und B-Zellen führt zu der entzündlichen Markscheidenschädigung, die neben der gliösen Vernarbung (Sklerose) das Charakteristikum der MS ist.
Welche Bereiche des ZNS sind bevorzugt betroffen?
Bevorzugte Stellen sind: Sehnerven, Balken, Hirnstamm (insbesondere Brücke mit Augenmuskelkernen), Kleinhirn und Kleinhirnstiele, Pyramidenbahn auf jedem Niveau, der Boden des IV. Ventrikels und die Hinterstränge des Rückenmarks. Seltener sind Hirnrinde, Basalganglien und Rückenmarksgrau betroffen.
Welche Verlaufsformen von MS gibt es?
Es gibt drei Hauptverlaufsformen: 1. Schubweise (mit wachsender Symptomatik), 2. Chronisch progredient (anfangs Schübe, dann ständig anhaltend oder Rückbildung mit schubartiger Verschlimmerung) und 3. Foudroyante (plötzlich einsetzende Schübe mit schnellem Tod - sehr selten!).
Welche Theorien gibt es zur Ätiologie von MS?
Es gibt vier mögliche Thesen: 1. Virusinfektion im Kindesalter, 2. Neuroallergische Hypothese, 3. Genetische Faktoren und 4. Myelinvulnerabilität.
Welche Symptome können bei MS auftreten?
Mögliche Symptome sind: Retrobulbäre Neuritis (Sehschärfenabfall), Drehschwindelattacken, flüchtige Doppelbilder, Trigeminusneuralgie, motorische Symptomatik (zentrale Paresen, Spastik), Sensibilitätsstörungen (Taubheit, Kribbeln), Blasenstörungen (Retention oder Dranginkontinenz), Kleinhirnfunktionsstörungen (Nystagmus, Intensionstremor, skandierendes Sprechen) und psychische Veränderungen (Euphorie).
Wie wird MS diagnostiziert?
Die Diagnose erfolgt durch: Liquoruntersuchung (erhöhtes Gesamteiweiss, IgG, Plasmazellen), fehlender Bauchhautreflex, positives Lhermittesches Zeichen, evozierte Potentiale (visuelle und auditive), Computeromographie und Magnetresonanztomographie (MRI). Die Kombination verschiedener Symptome sichert die Diagnose MS.
Wie wird MS behandelt?
Eine ursächliche Therapie ist bisher nicht möglich. Die Behandlung zielt darauf ab, die Entzündung zu hemmen und/oder das Immunsystem zu unterdrücken. Dies geschieht durch: Hochdosiertes Cortison oder ACTH (nur zur Schubbehandlung), Beta-Interferon (Immunmodulatoren), Immunsuppression mit Azathioprin oder zytostatische Therapie mit Cyclophosphamid. Zusätzlich erfolgt eine symptomatische Behandlung mit Baclofen gegen Spastik, Antidepressiva bei Depression, Carbachol bei Blasenentleerungsstörungen und Carbamazepin bei Trigeminusneuralgie.
- Quote paper
- Stephanie Weigel (Author), 2001, Multiple Sklerose, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/100082